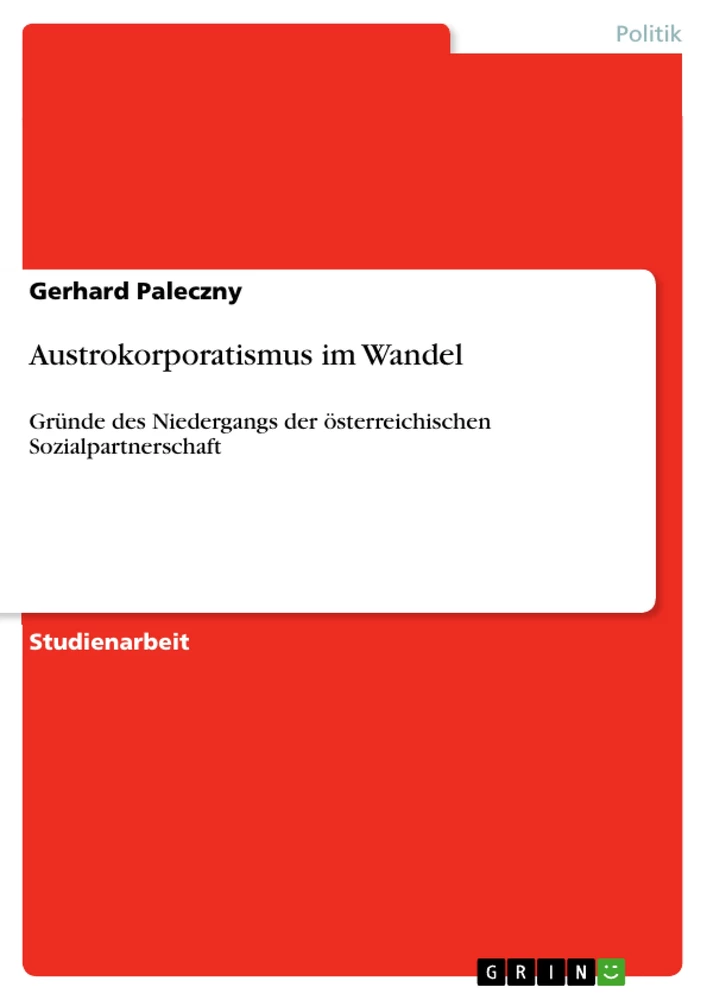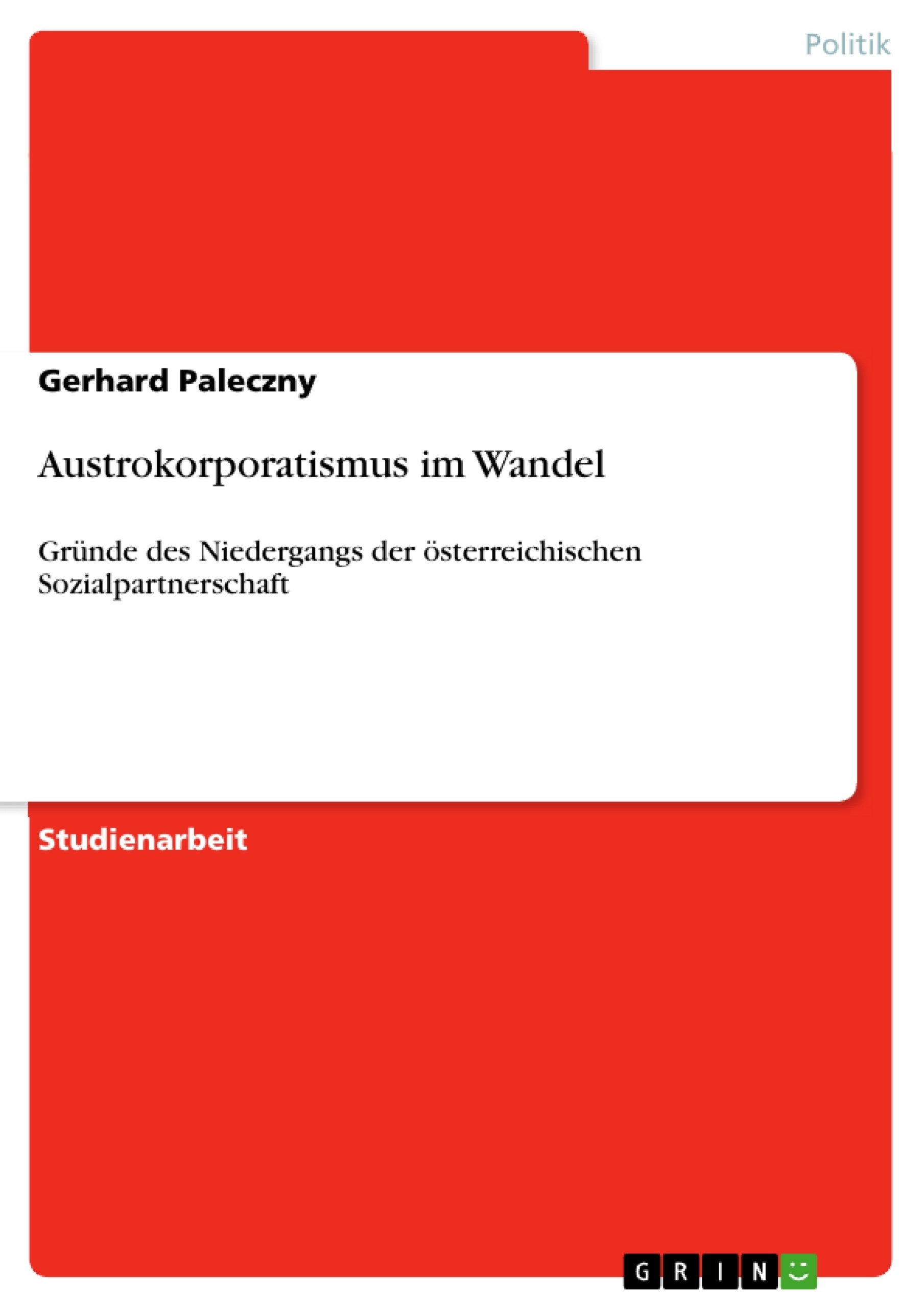Wien, der 4. Februar 2000: Der Koalitionsvertrag wird zwischen der Österreichischen Volkspartei (ÖVP) und der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) unterzeichnet. Eine gesamtpolitische Wende in Österreich? Mitnichten. Zumindest keine nachhaltige, betrachtet man die politische Landschaft aus heutiger Sicht. Denn nur zwei Regierungsperioden später bildete sich wieder eine in Österreich so geschichtsträchtige Große Koalition. Und selbst jetzt, wo diese Konstellation nach einer nur zwei Jahre andauernden Regierungsperiode gescheitert ist, scheint nach den vorgezogenen Nationalratswahlen 2008 eine neuerliche Koalition der Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ) und der Volkspartei als sehr wahrscheinlich – und das, obwohl beide Regierungsparteien bei den Wahlen schwere Verluste hinnehmen mussten.
Der Begriff „Wende“ trifft aber durchaus zu, wenn man das Phänomen betrachtet, welchem die ÖVP-FPÖ-Regierung im Jahr 2000 namentlich den Kampf ansagte: dem „Austrokorporatismus“ , die österreichisch-spezifische Form der Interessenspolitik, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Einkommens-, Wirtschafts-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik erheblich mitbestimmte. Die „Wende“ kann also als Bruch mit der politischen Kultur der Konkordanzdemokratie angesehen werden. Die Sozialpartnerschaft, die jahrzehntelang ein stabiles Element im österreichischen System darstellte, hatte zwar zur Jahrtausendwende ihre Hochblütephase bereits lange hinter sich, die Mitte-Rechts-Regierung nutzte aber die Gunst der Stunde um den Niedergang der Sozialpartnerschaft endgültig einzuläuten. Aber ist der Austrokorporatismus tatsächlich am Ende? Oder steht lediglich eine Neupositionierung der Interessenvertretung bevor?
Die vorliegende Seminararbeit versucht die Frage zu beantworten, wo die Gründe für den sozialpartnerschaftlichen Niedergang zu suchen sind. Dabei stehen zentral vor allem zwei Aspekte im Vordergrund: Einerseits befasst sich die Arbeit mit den Veränderungen des sozialpartnerschaftlichen Gefüges sowie mit den Veränderungen des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Umfeldes, das sich ja besonders in den letzten zwei Jahrzehnten massiv wandelte – nicht zuletzt auch aufgrund Österreichs Beitritt zur Europäischen Union. Anderseits wird das Ausmaß der Zäsuren der schwarz-blau-orangen Regierung in den traditionellen Spielregeln der Interessenspolitik und weiters das daraus folgende verminderte sozialpartnerschaftliche Gestaltungspotential untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Austrokorporatismus - Das österreichische Phänomen Sozialpartnerschaft
- 2.1. Der Begriff Sozialpartnerschaft
- 2.2. Strukturen der Sozialpartnerschaft
- 3. Veränderungen des Umfelds der Sozialpartnerschaft
- 3.1. Veränderungen der politischen Rahmenbedingungen
- 3.2. Sozialpartnerschaft und die Europäische Union
- 3.3. Veränderungen innerhalb der Dachverbände
- 4. Sozialpartnerschaft unter der schwarz-blau/orangen Regierung
- 4.1. Der Regierungswechsel im Jahr 2000
- 4.2. Die offizielle Haltung der ÖVP-FPÖ-Regierung zur Sozialpartnerschaft
- 4.3. Die Reformpolitik der Koalitionsregierung
- 4.4. Die Folgen der Reformpolitik und die Neuorientierung der Dachverbände
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Gründe für den Niedergang der österreichischen Sozialpartnerschaft. Im Fokus stehen die Veränderungen des sozialpartnerschaftlichen Gefüges und des politischen, wirtschaftlichen und sozialen Umfelds, insbesondere seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Weiterhin wird der Einfluss der schwarz-blau-orangen Regierung auf die traditionellen Spielregeln der Interessenspolitik analysiert.
- Veränderungen des sozioökonomischen Umfelds der Sozialpartnerschaft
- Entwicklung und Struktur der österreichischen Sozialpartnerschaft
- Einfluss der schwarz-blau-orangen Regierung auf die Sozialpartnerschaft
- Neuorientierung der Dachverbände
- Zukunft von Sozialpakten und Bündnissen für die Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beschreibt den Kontext des Regierungswechsels 2000 und die damit verbundene „Wende“ im Austrokorporatismus. Sie skizziert die Forschungsfrage und die methodischen Schwerpunkte der Arbeit.
Kapitel 2 (Austrokorporatismus): Dieses Kapitel definiert den Begriff der Sozialpartnerschaft und beschreibt die Strukturen des österreichischen Modells der Interessensvermittlung.2,3
Kapitel 3 (Veränderungen des Umfelds): Dieses Kapitel beleuchtet die tiefgreifenden Veränderungen der Sozialpartnerschaft seit den 1990er Jahren, verursacht durch Veränderungen des sozioökonomischen Umfelds und der Strukturen der beteiligten Dachverbände.4,5,6,7,8
Kapitel 4 (Sozialpartnerschaft unter der schwarz-blau-orangen Regierung): Dieses Kapitel analysiert die Politik der schwarz-blau-orangen Regierung und deren Einfluss auf den Rückgang der sozialpartnerschaftlichen Interessenspolitik.
Schlüsselwörter
Austrokorporatismus, Sozialpartnerschaft, Interessenspolitik, Österreich, ÖVP, FPÖ, Konkordanzdemokratie, Dachverbände, Europäische Union, sozioökonomische Veränderungen, Reformpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Austrokorporatismus“?
Austrokorporatismus bezeichnet das spezifisch österreichische System der Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und dem Staat.
Was änderte sich durch die schwarz-blaue Regierung im Jahr 2000?
Die ÖVP-FPÖ-Regierung unter Wolfgang Schüssel leitete einen Bruch mit der traditionellen Konkordanzdemokratie und der Macht der Sozialpartner ein.
Warum verlor die Sozialpartnerschaft an Bedeutung?
Gründe sind der EU-Beitritt Österreichs, veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und eine bewusste politische Entmachtung durch die Regierung.
Welche Rolle spielen die Dachverbände heute?
Die Arbeit untersucht die notwendige Neupositionierung und die verringerten Gestaltungspotenziale der großen Interessenvertretungen.
Ist der Austrokorporatismus am Ende?
Die Seminararbeit analysiert, ob es sich um einen endgültigen Niedergang oder lediglich um eine zeitgemäße Neuausrichtung handelt.
- Quote paper
- Gerhard Paleczny (Author), 2008, Austrokorporatismus im Wandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119147