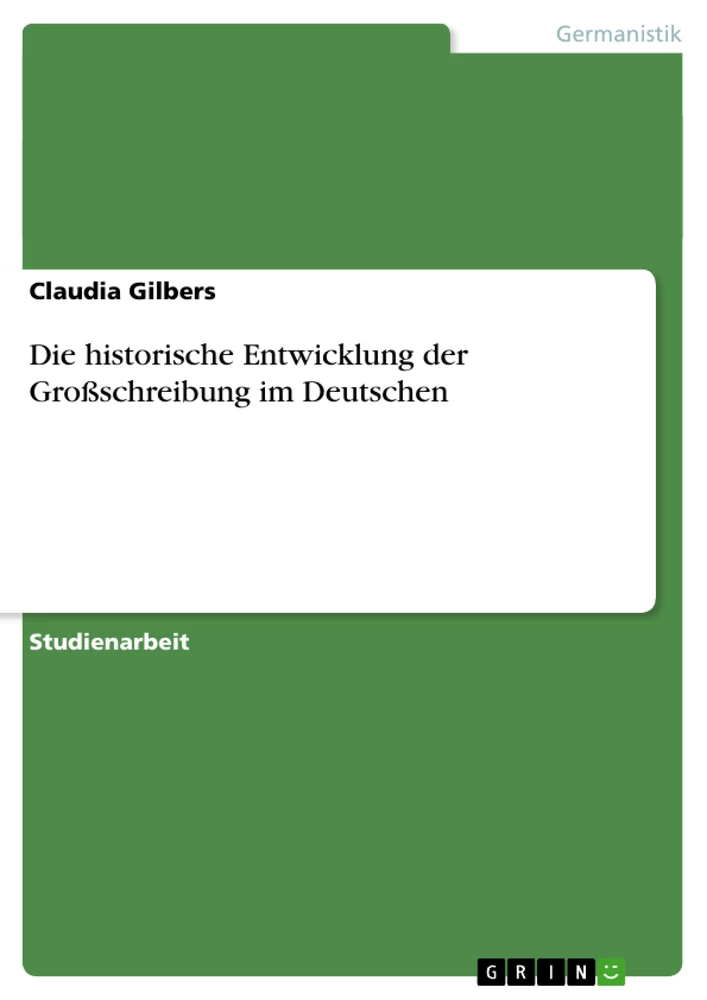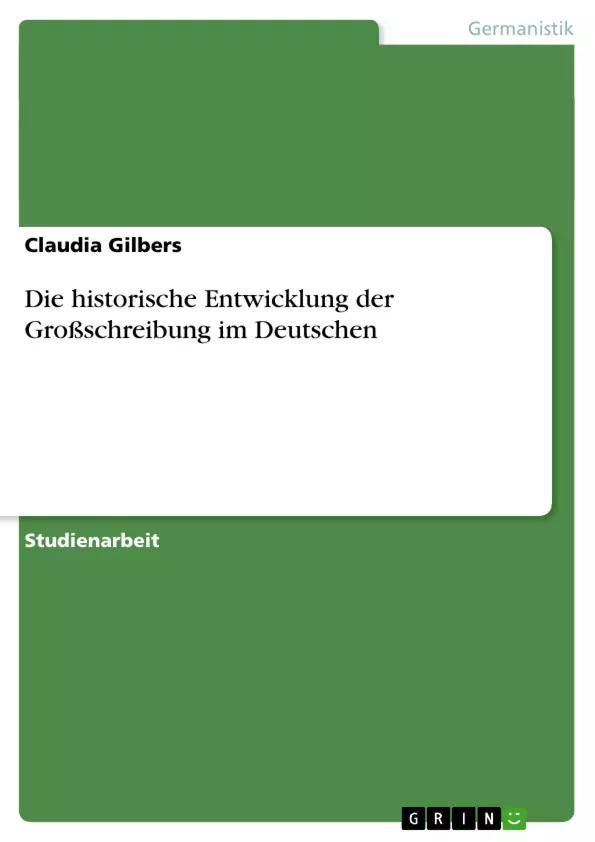Seit der dänischen Rechtschreibreform von 1948 und der damit verbundenen Einführung der gemäßigten Kleinschreibung im Dänischen ist das Deutsche heute die einzige Sprache, in deren Schriftbild große Anfangsbuchstaben in einem so großen Umfang vorhanden sind. Denn im Gegensatz zu anderen Sprachen werden im Deutschen nicht nur Satzanfänge, Eigennamen, Respekt- und Höflichkeitsbekundungen großgeschrieben, sondern auch alle Wörter, die unter der Wortart Substantiv verstanden werden können, also auch Substantivierungen anderer Wortarten. Wohl auch deshalb gehört der Regelapparat zur Groß- und Kleinschreibung zu den problematischsten Bereichen der deutschen Rechtschreibung. Das Erlernen und Vermitteln des umfangreichen Regelsystems mit seinen zahlreichen Einzelrichtlinien zum Festlegen möglichst vieler Grenz- und Problemfälle hat sich längst als sehr schwierig erwiesen und es erscheint deshalb nahezu unmöglich, alle Regeln zur Groß- und Kleinschreibung einwandfrei zu beherrschen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Zur Entwicklung der Großbuchstaben in der Schriftgeschichte
- III. Die Herausbildung und allmähliche Ausweitung der Großschreibung im Deutschen
- a) Die Großschreibung am Anfang von Texten, Absätzen, Strophen und Sätzen
- b) Die Großschreibung im Satzinneren
- IV. Die Entwicklung der Großschreibung von etwa 1500 bis 1700: Die ersten grammatischen Regelwerke
- a) Der schryfftspiegel (1527)
- b) Kolroẞ (1530)
- c) Sattler (1607)
- d) Gueintz (1641)
- e) Ergebnisse
- V. Die Entwicklung der Großschreibung seit etwa 1700: Durchsetzung der generellen Substantivgroßschreibung bei Freyer, Gottsched und Adelung
- a) Freyer (1722)
- b) Gottsched (1748)
- c) Adelung (1788)
- d) Ergebnisse
- VI. Kritik und Reformbestrebungen an den vorherrschenden Großschreibungsregeln im 19. Jahrhundert: Jacob Grimm und die „historische Schule“
- VII. Die weitere Entwicklung der Großschreibung bis zur ersten amtlichen Regelung auf der II. Orthographischen Konferenz von 1901
- VIII. Ausblick und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit verfolgt das Ziel, die historische Entwicklung der Großschreibung im Deutschen von den Anfängen bis zur II. Orthographischen Konferenz von 1901 nachzuzeichnen. Der Fokus liegt dabei auf den wichtigsten Entwicklungslinien und den Einfluss bedeutender Grammatiker und ihrer Werke auf den Schreibgebrauch.
- Entwicklung der Großbuchstaben in der Schriftgeschichte
- Herausbildung und Ausweitung der Großschreibung im Deutschen
- Grammatikalisierung und Normierungsversuche der Großschreibung (1500-1800)
- Kritik und Reformbestrebungen im 19. Jahrhundert
- Entwicklung bis zur II. Orthographischen Konferenz von 1901
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Besonderheit der deutschen Großschreibung im internationalen Vergleich. Sie hebt die Komplexität des Regelapparats hervor und begründet die Notwendigkeit einer historischen Betrachtung der Entwicklung, um die bestehenden Schwierigkeiten zu verstehen. Die Arbeit kündigt die einzelnen Kapitel und ihren Fokus an, wobei der Schwerpunkt auf der Großschreibung im Satzinneren liegt.
II. Zur Entwicklung der Großbuchstaben in der Schriftgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die Ursprünge der Großschreibung in der lateinischen Schrift der römischen Antike. Es beschreibt die Entwicklung von der ursprünglichen Majuskelschrift zur Minuskelschrift und den Verlust der einheitlichen Schrift nach dem Zerfall des römischen Reiches. Der Fokus liegt auf der Darstellung der historischen Wurzeln der heutigen Schreibweise.
III. Die Herausbildung und allmähliche Ausweitung der Großschreibung im Deutschen: Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung der Großschreibung im Deutschen, getrennt nach Großschreibung am Satzanfang und im Satzinneren. Es analysiert die allmähliche Ausbreitung der Großschreibung und die unterschiedlichen Anwendungsbereiche, die sich historisch herausbildeten. Die Unterscheidung dieser beiden Bereiche legt den Grundstein für die spätere Analyse der komplexeren Regeln.
IV. Die Entwicklung der Großschreibung von etwa 1500 bis 1700: Die ersten grammatischen Regelwerke: Kapitel IV befasst sich mit den ersten grammatischen Regelwerken und ihren Ansätzen zur Normierung der Großschreibung im Zeitraum von 1500 bis 1700. Es analysiert die Aussagen wichtiger Grammatiker wie "Der schryfftspiegel", Kolroß, Sattler und Gueintz, diskutiert ihre Vorschläge und deren Einfluss auf den tatsächlichen Schreibgebrauch. Die Kapitel fokussiert auf die frühen Versuche, die Schreibweise zu vereinheitlichen.
V. Die Entwicklung der Großschreibung seit etwa 1700: Durchsetzung der generellen Substantivgroßschreibung bei Freyer, Gottsched und Adelung: Dieses Kapitel behandelt die Durchsetzung der Substantivgroßschreibung im 18. Jahrhundert durch die Arbeiten von Freyer, Gottsched und Adelung. Es analysiert deren Beiträge zur Standardisierung und diskutiert die Auswirkungen ihrer Regelwerke auf den Schreibgebrauch. Der Fokus liegt auf der zunehmenden Vereinheitlichung der Großschreibungsregeln.
VI. Kritik und Reformbestrebungen an den vorherrschenden Großschreibungsregeln im 19. Jahrhundert: Jacob Grimm und die „historische Schule“: Kapitel VI untersucht die Kritik an den bestehenden Regeln im 19. Jahrhundert, exemplarisch dargestellt an den Reformbestrebungen von Jacob Grimm und der „historischen Schule“. Es analysiert die Argumente der Kritiker und deren Einfluss auf die nachfolgende Entwicklung der Großschreibung. Dieses Kapitel verdeutlicht, dass die etablierten Regeln nicht unumstritten waren.
VII. Die weitere Entwicklung der Großschreibung bis zur ersten amtlichen Regelung auf der II. Orthographischen Konferenz von 1901: Das siebte Kapitel beschreibt die Entwicklung der Großschreibung bis zur ersten amtlichen Regelung im Jahr 1901. Es zeichnet die weiteren Veränderungen und Diskussionen nach und bildet den Abschluss der historischen Analyse vor der offiziellen Festlegung der Regeln.
Schlüsselwörter
Großschreibung, Kleinschreibung, deutsche Rechtschreibung, Schriftgeschichte, Grammatikalisierung, Normierung, Regelwerke, Jacob Grimm, Orthographische Konferenz 1901, Substantiv, Satzanfang, Satzinneres, Majuskelschrift, Minuskelschrift.
Häufig gestellte Fragen zur Entwicklung der Großschreibung im Deutschen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die historische Entwicklung der Großschreibung im Deutschen von ihren Anfängen bis zur zweiten Orthographischen Konferenz von 1901. Der Fokus liegt auf den wichtigsten Entwicklungsphasen und dem Einfluss bedeutender Grammatiker und ihrer Werke auf die Schreibgewohnheiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Großbuchstaben in der Schriftgeschichte, die Herausbildung und Ausweitung der Großschreibung im Deutschen, die Grammatikalisierung und Normierungsversuche der Großschreibung (1500-1800), Kritik und Reformbestrebungen im 19. Jahrhundert und die Entwicklung bis zur zweiten Orthographischen Konferenz von 1901.
Welche Grammatiker und Regelwerke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Aussagen wichtiger Grammatiker und ihrer Werke, darunter "Der schryfftspiegel" (1527), Kolroß (1530), Sattler (1607), Gueintz (1641), Freyer (1722), Gottsched (1748) und Adelung (1788). Der Einfluss dieser Werke auf den tatsächlichen Schreibgebrauch wird untersucht.
Welche Rolle spielte Jacob Grimm?
Die Arbeit untersucht die Kritik an den bestehenden Großschreibungsregeln im 19. Jahrhundert, insbesondere die Reformbestrebungen von Jacob Grimm und der „historischen Schule“. Ihre Argumente und deren Einfluss auf die Entwicklung der Großschreibung werden analysiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in acht Kapitel: Einleitung, Entwicklung der Großbuchstaben in der Schriftgeschichte, Herausbildung und Ausweitung der Großschreibung im Deutschen, Entwicklung der Großschreibung von 1500 bis 1700 (mit Analyse verschiedener Regelwerke), Entwicklung der Großschreibung seit 1700 (Freyer, Gottsched, Adelung), Kritik und Reformbestrebungen im 19. Jahrhundert, weitere Entwicklung bis 1901 und Ausblick/Schlussbetrachtung.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die historische Entwicklung der deutschen Großschreibung nachzuzeichnen und die wichtigsten Entwicklungslinien sowie den Einfluss bedeutender Grammatiker auf den Schreibgebrauch zu beleuchten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung der Großschreibung im Satzinneren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Großschreibung, Kleinschreibung, deutsche Rechtschreibung, Schriftgeschichte, Grammatikalisierung, Normierung, Regelwerke, Jacob Grimm, Orthographische Konferenz 1901, Substantiv, Satzanfang, Satzinneres, Majuskelschrift, Minuskelschrift.
Wo liegt der Fokus der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der Großschreibung im Satzinneren und die Analyse der Versuche zur Normierung und Standardisierung der Großschreibung im Laufe der Geschichte.
- Citation du texte
- Claudia Gilbers (Auteur), 2001, Die historische Entwicklung der Großschreibung im Deutschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11916