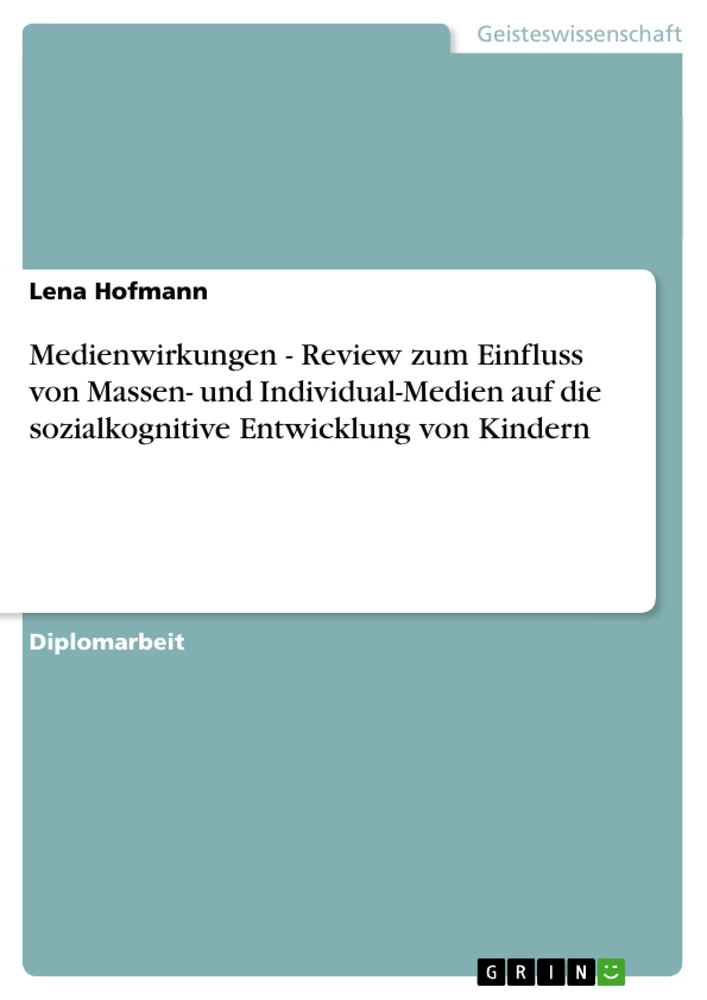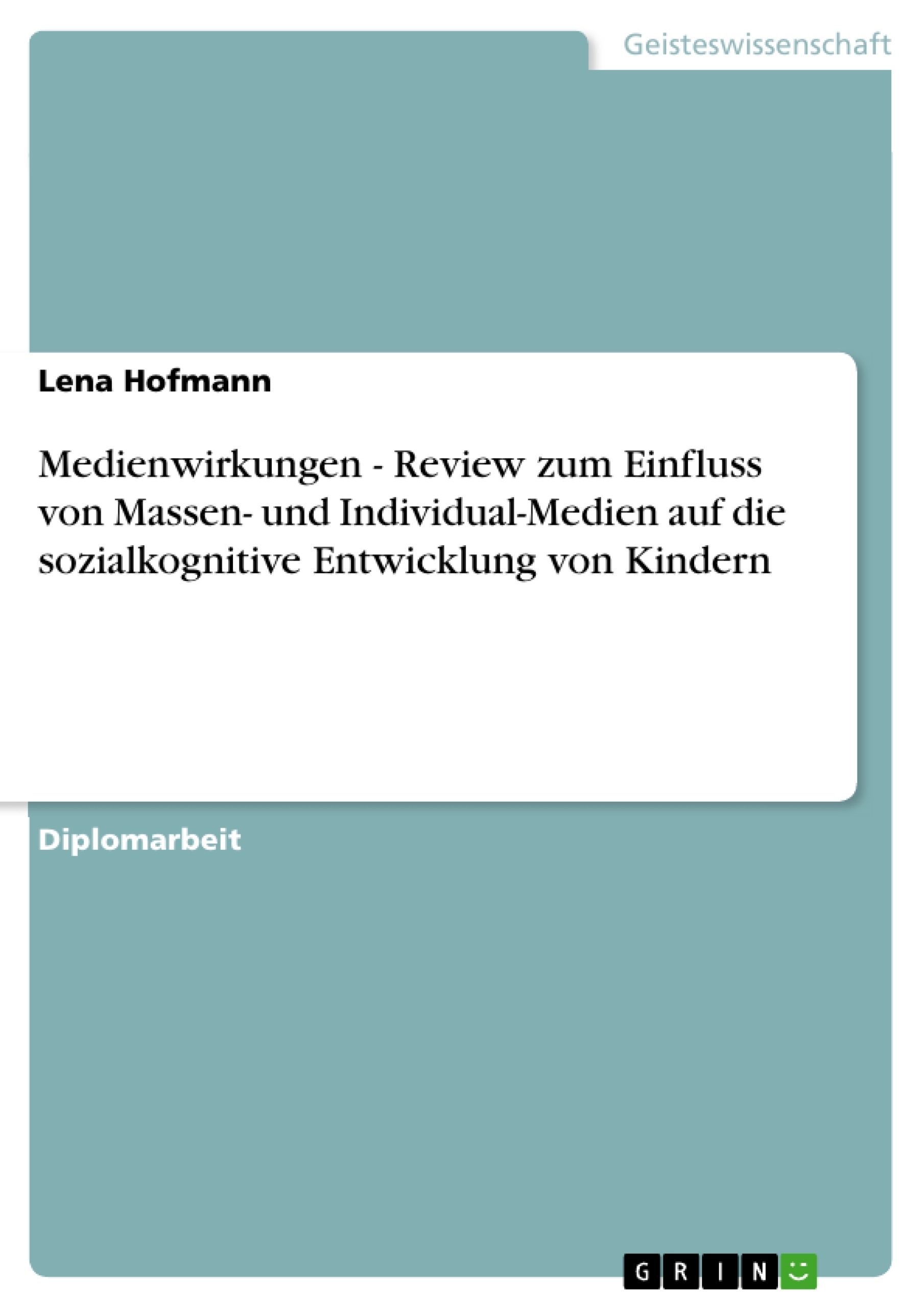Die interdisziplinäre Medienforschung hat im letzten Jahrhundert eine Entwicklung vom einfachen Stimulus-Response-Modell der Medienwirkungen, hin zu differenzierten Modellen der Medienrezeption hinter sich gebracht. Das handlungstheoretische Rezeptionsmodell fällt in die zweite Kategorie und wurde in den 90er Jahren von Charlton und Neumann-Braun entwickelt. Es
geht von einem Rezipienten aus, der - im Kontext seiner Lerngeschichte und aktuellen Situation - aus dem Medienangebot aktiv etwas für ihn thematisch Passendes auswählt und zur Lebensbewältigung und Identitätsbewahrung nutzt.
In der aktuellen öffentlichen Debatte stehen jedoch Aussagen der Hirnforscher Spitzer und Hüther und des Kriminologen Pfeiffer im Vordergrund, die ein bedrohliches Bild der negativen Medienwirkungen zeichnen: Der Konsum von Bildschirmmedien verursache unter anderem Schulversagen, soziale Isolation, Krankheit und schließlich den Tod. Aus dieser Diskrepanz zwischen der Entwicklung der Medienforschung und der aktuellen Debatte ergeben sich die Fragen, inwieweit diese aktuellen und mit modernen wissenschaftlichen Methoden
gewonnenen Aussagen das handlungstheoretische Rezeptionsmodell widerlegen können bzw. vor dem Hintergrund der kognitionswissenschaftlichen Forschung adäquat sind. Die Recherche im Rahmen dieser Arbeit hat gezeigt, dass die zugrunde liegenden Wirkungsmodelle der drei Wissenschaftler zu großen Teilen nicht den Erkenntnissen der Rezeptionsforschung entsprechen und die Datengrundlage, auf die sich die Neurowissenschaftler beziehen, nicht aus
ihrem eigenen Labor stammt. Dementsprechend gering ist die Aussagekraft der aus den Aussagen abgeleiteten Handlungsanweisungen. Während die Methoden neurowissenschaftlich sind, ist die Argumentation mehrheitlich pädagogisch.
Die Kriminologische Forschung von Pfeiffer bewegt sich mehr im Feld der sozialen Ungleichheitsforschung und weniger im Medienforschungsrahmen. Deswegen sollten die aus dieser Forschung stammenden Aussagen eingeschränkt verallgemeinert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Historische Entwicklung der Massenmedienforschung
- 1.1 Phase der wirkungsstarken Medien
- 1.2 Phase der wirkungsschwachen Medien
- 2. Kritik an der Massenmedienwirkungsforschung
- 3. Forschungsansätze
- 3.1 Nutzung
- 3.1.1 Aktuelle Befunde der Mediennutzung bei Kindern
- 3.2 Rezeption
- 3.3 Aneignung
- 3.3.1 Folgekommunikation
- 3.1 Nutzung
- 4. Ansatz der strukturanalytischen Rezeptionsforschung - das handlungstheoretische Rezeptionsmodell
- 4.1 Rezeption
- 4.2 Handlungsleitendes Thema
- 4.3 Aufbau des Modells
- 4.3.1 Strukturmerkmale
- 4.3.2 Prozessmerkmale
- 4.4 Aneignung
- 4.4.1 Vermittlung
- 4.4.2 Involvement
- 4.4.3 Para-soziale Interaktion
- 4.4.4 Folgekommunikation
- 5. Implikationen für die Wirkungsforschung
- 5.1 Begrenzungen von Medienwirkungen
- 5.2 Methodisches Vorgehen
- 6. Fragestellungen
- 7. Aktuelle Forschung
- 7.1 Grundlagenforschung
- 7. Spitzer
- 7.1 Mechanismen des Gehirns
- 7.2 Problematik nach Spitzer
- 7.2.1 Körperliche Folgen
- 7.2.2 Virtuelle Realität
- 7.2.3 Lernen mit dem Computer?
- 7.3 Lösungsansätze nach Spitzer
- 7.4 Kritik
- 7.4.1 Medienwirkungsmodell
- 7.4.2 Methodisches Vorgehen
- 7.4.2.1 Neuroimaging
- 7.4.3 Menschenbild
- 7.4.4 Fazit zur Medienwirkungsforschung von Spitzer
- 7.4.4.1 Abgleich mit dem handlungstheoretischen Struktur- und Prozessmodell
- 7.4.4.2 Aussagekraft
- 8. Hüther
- 8.1 Problematik nach Hüther
- 8.1.1 Gesellschaft und frühkindliche Erfahrungen
- 8.1.2 Gehirnentwicklung
- 8.1.3 Der Computer
- 8.2 Konsequenz
- 8.3 Lösungsansätze nach Hüther
- 8.4 Kritik
- 8.4.1 Medienwirkungsmodell
- 8.4.2 Methodisches Vorgehen
- 8.4.3 Menschenbild
- 8.4.4 Charakteristik von Computerspielen
- 8.4.5 Fazit zur Medienwirkungsforschung von Hüther
- 8.4.5.1 Abgleich mit dem handlungstheoretischen Struktur- und Prozessmodell
- 8.4.5.2 Aussagekraft
- 8.1 Problematik nach Hüther
- 9. Fazit zur Hirnforschung im Rahmen der Medienwirkungsforschung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der etablierten Medienrezeptionsforschung und den aktuellen, teilweise alarmierenden Aussagen von Neurowissenschaftlern und Kriminologen zu den negativen Auswirkungen von Medienkonsum auf Kinder. Ziel ist es, die Aussagen dieser Wissenschaftler im Lichte des handlungstheoretischen Rezeptionsmodells zu überprüfen und deren Aussagekraft zu bewerten.
- Historische Entwicklung der Medienwirkungsforschung
- Das handlungstheoretische Rezeptionsmodell
- Kritik an den Aussagen von Spitzer und Hüther
- Bewertung der methodischen Ansätze
- Implikationen für die Medienwirkungsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Forschungslücke. Kapitel 1 beleuchtet die historische Entwicklung der Massenmedienforschung, von wirkungsstarken zu wirkungsschwachen Modellen. Kapitel 2 widmet sich der Kritik an der traditionellen Massenmedienwirkungsforschung. Kapitel 3 definiert zentrale Begriffe wie Nutzung, Rezeption und Aneignung und präsentiert aktuelle Befunde zur Mediennutzung bei Kindern. Kapitel 4 beschreibt detailliert das handlungstheoretische Rezeptionsmodell. Kapitel 5 diskutiert die Implikationen für die Wirkungsforschung. Die Kapitel 7 und 8 analysieren kritisch die Arbeiten von Spitzer und Hüther, ihre methodischen Ansätze und deren Übereinstimmung mit dem handlungstheoretischen Modell.
Schlüsselwörter
Handlungstheoretisches Rezeptionsmodell, Medienwirkungen, Medienrezeption, Kinder, Spitzer, Hüther, Neurowissenschaften, Kriminologie, Mediennutzung, soziale Kognition.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das handlungstheoretische Rezeptionsmodell?
Dieses Modell geht davon aus, dass Kinder Medieninhalte aktiv auswählen und nutzen, um ihre eigene Identität zu bewahren und Herausforderungen in ihrem Leben zu bewältigen.
Warum werden die Thesen von Manfred Spitzer kritisiert?
Kritiker bemängeln, dass seine Warnungen vor "digitaler Demenz" oft auf einer dünnen Datengrundlage basieren und die aktive Rolle des Nutzers bei der Medienrezeption vernachlässigen.
Welchen Einfluss haben Bildschirmmedien auf die soziale Isolation?
Während einige Forscher vor Isolation warnen, betont die Rezeptionsforschung, dass Medien oft Anlass für Folgekommunikation und soziale Interaktion im realen Leben bieten.
Was bedeutet "Para-soziale Interaktion" im Medienkontext?
Es beschreibt die einseitige Beziehung, die Rezipienten (z. B. Kinder) zu Medienfiguren aufbauen, als wären diese reale soziale Partner.
Wie hat sich die Medienwirkungsforschung historisch entwickelt?
Die Forschung entwickelte sich von einfachen "Stimulus-Response"-Modellen (Medien wirken direkt) hin zu komplexeren Modellen, die den Kontext und die Lerngeschichte des Nutzers einbeziehen.
- Citar trabajo
- Diplom Psychologin Lena Hofmann (Autor), 2008, Medienwirkungen - Review zum Einfluss von Massen- und Individual-Medien auf die sozialkognitive Entwicklung von Kindern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119189