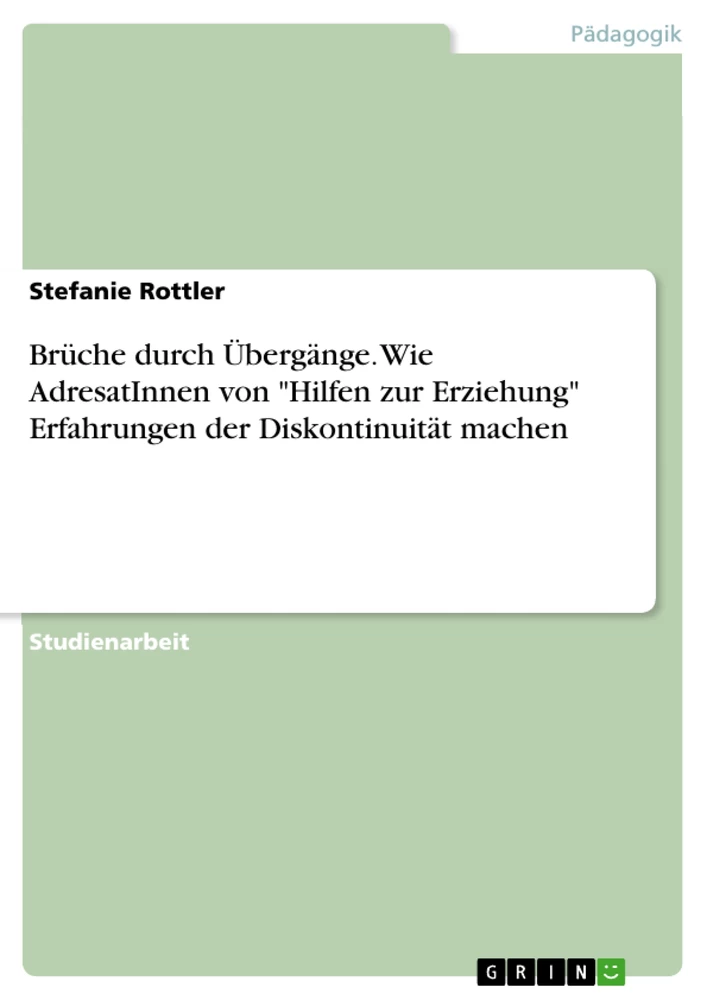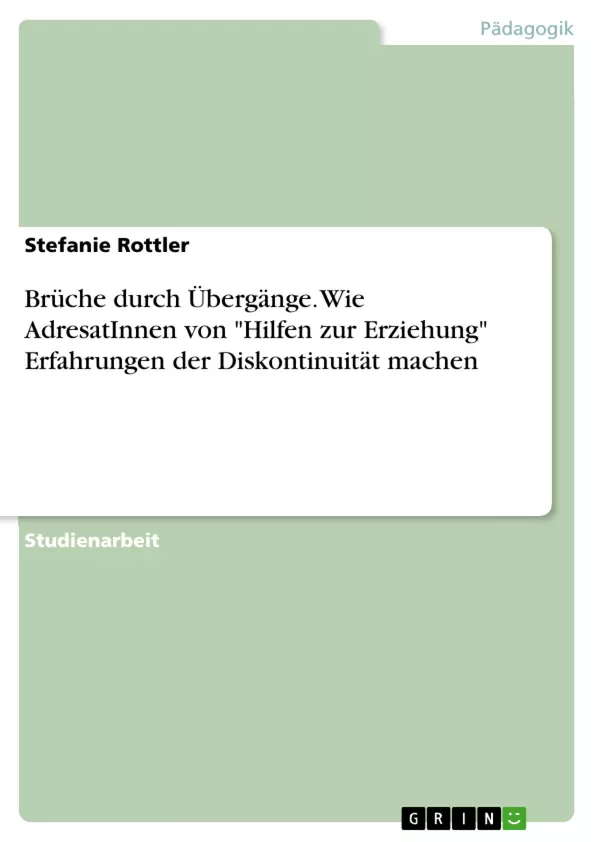Allgemein betrachtet stellen Übergänge im Lebenslauf von Individuen, in besonderer Weise von heranwachsenden jungen Menschen, heutzutage eine Herausforderung dar, sei es beispielsweise der Übergang von einer Kindertageseinrichtung in die Schullaufbahn oder der vom Jugend- ins Erwachsenenalter. Diese Arbeit möchte sich jedoch vielmehr mit jenen spezifischen Übergängen beschäftigen, mit denen sich AdressatInnen von Hilfen zur Erziehung (HzE) konfrontiert sehen – zusätzlich zu den eben erwähnten, alle jungen Menschen betreffenden Übergängen. Die HzE gehören gemäß Sozialgesetzbuch VIII neben vier anderen großen Arbeitsfeldern als sozialstaatliche Leistung der Kinder- und Jugendhilfe an und haben den Auftrag, Personensorgeberechtige mit ihren Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenssituationen mittels geeigneter Hilfeform(en) zu unterstützen.
Hierbei ergibt sich dann ein Übergang, wenn ein im Hilfeplanverfahren als sinnvoll erachteter Wechsel von einem Hilfsangebot zu einem anderen umgesetzt wird. Statistisch betrachtet handelt es sich dabei um ein alltägliches Phänomen in den HzE, da beinahe die Hälfte aller HilfeempfängerInnen nach Beendigung einer Hilfe ein Neue annimmt. Obwohl die unterschiedlichen Hilfeformen, wie zum Beispiel die Heimerziehung, im Laufe der letzten Jahrzehnte zumindest ihren „kontrollierend-restriktiven Charakter“ (Hamberger 2008) verloren haben, so wird die Heimerziehung von AdressatInnen zumeist als kritisches, gar krisenhaftes Lebensereignis wahrgenommen. Dies ist nachvollziehbar, angesichts der Tatsache, dass HilfeempfängerInnen nicht selten ganze Erziehungshilfekarrieren durchleben, in denen die zahlreichen Übergangserfahrungen zwangsläufig zur Unterbrechung der Kontinuität eines geregelten Alltagslebens führen. Wo eine solches Klima der Diskontinuität entsteht, sind ursprünglich unbeabsichtigte Erfahrungen von Brüchen im Alltag der AdressatInnen vorprogrammiert.
Im Folgenden soll anhand einer zunächst knapp rekonstruierten Fallgeschichte einerseits dargestellt werden, wie AdressatInnen der HzE besagte durch institutionelle Übergänge entstandene Brüche erleben, andererseits sollen aber auch daraus resultierende strukturelle und soziale Konsequenzen untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Anmerkung
- 1 Kontextualisierung
- 1.1 Brüche durch strukturelle Diskontinuität
- 1.2 Brüche durch soziale Diskontinuität
- 2 Brüche entstehen
- 2.1 Die Fallgeschichte,,Frau Müller. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf“
- 3 Gelingende Übergänge schaffen
- 4 Abschluss
- 5 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Herausforderungen, die AdressatInnen von Hilfen zur Erziehung (HzE) im Zusammenhang mit Übergängen zwischen verschiedenen Hilfsangeboten erleben. Dabei wird die Frage untersucht, wie diese Übergänge zu Brächen in der Lebenswelt der Betroffenen führen können und welche strukturellen und sozialen Konsequenzen sich daraus ergeben. Im Fokus steht insbesondere die Frage, ob Übergänge in der HzE grundsätzlich problematisch sind oder ob es Wege gibt, sie so zu gestalten, dass sie zu gelingenden Hilfsprozessen führen.
- Erfahrungen von Diskontinuität in den HzE
- Strukturelle und soziale Folgen von Übergängen
- Die Rolle der pädagogischen Fachkräfte bei der Gestaltung von Übergängen
- Möglichkeiten zur Minimierung von Brüchen und zur Förderung gelingender Übergänge
- Kritik an der aktuellen Praxis der HzE und der Notwendigkeit einer stärkeren Berücksichtigung der Bedürfnisse der HilfeempfängerInnen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert den Kontext der Arbeit und beleuchtet die Besonderheiten von Übergängen im Lebenslauf von Kindern und Jugendlichen, insbesondere von AdressatInnen von Hilfen zur Erziehung. Es wird die Bedeutung der HzE als sozialstaatliche Leistung der Kinder- und Jugendhilfe sowie die Häufigkeit von Übergängen innerhalb der HzE hervorgehoben.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Entstehen von Brüchen durch die Fallgeschichte von Tim. Der Fokus liegt dabei auf den Herausforderungen, die Tim durch die verschiedenen Einrichtungen, in denen er sich aufhielt, bewältigen musste. Die Fallgeschichte veranschaulicht die Auswirkungen von strukturellen und sozialen Diskontinuitäten auf die Lebenswelt der AdressatInnen.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Folgen von strukturellen Diskontinuitäten. Es wird gezeigt, wie die fehlende Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Kinder zu einer Verlagerung der Verantwortung von Einrichtung zu Einrichtung führen kann. Dies kann zu einer Hängepartie führen, in der die HilfeempfängerInnen sich als "aussichtsloser Fall" abgestempelt fühlen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Hilfen zur Erziehung, Übergänge, Brüche, Diskontinuität, strukturelle Diskontinuität, soziale Diskontinuität, Erziehungshilfekarrieren, institutionelle Übergänge, Hängepartie, pädagogische Fachkräfte, AdressatInnenperspektive, Lebensgeschichte, Interventionen und gelingende Hilfsprozessen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Hilfen zur Erziehung (HzE)?
HzE sind sozialstaatliche Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII, die Personensorgeberechtigte in prekären Lebenssituationen unterstützen.
Warum werden Übergänge in der HzE oft als „Brüche“ erlebt?
Ein Wechsel zwischen verschiedenen Hilfeformen führt oft zur Unterbrechung der Kontinuität des Alltags und der sozialen Beziehungen, was von den Betroffenen als krisenhaft wahrgenommen wird.
Was versteht man unter einer „Erziehungshilfekarriere“?
Damit ist die Abfolge zahlreicher verschiedener stationärer oder teilstationärer Hilfsmaßnahmen gemeint, die ein junger Mensch im Laufe seiner Entwicklung durchläuft.
Was sind die Folgen struktureller Diskontinuität?
Kinder und Jugendliche können sich als „aussichtsloser Fall“ abgestempelt fühlen, wenn die Verantwortung ständig von einer Einrichtung zur nächsten verlagert wird.
Wie können Übergänge in der Jugendhilfe besser gestaltet werden?
Durch eine stärkere Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse der Adressaten und eine bessere Koordination zwischen den beteiligten Institutionen können Brüche minimiert werden.
- Quote paper
- Stefanie Rottler (Author), 2019, Brüche durch Übergänge. Wie AdresatInnen von "Hilfen zur Erziehung" Erfahrungen der Diskontinuität machen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1192259