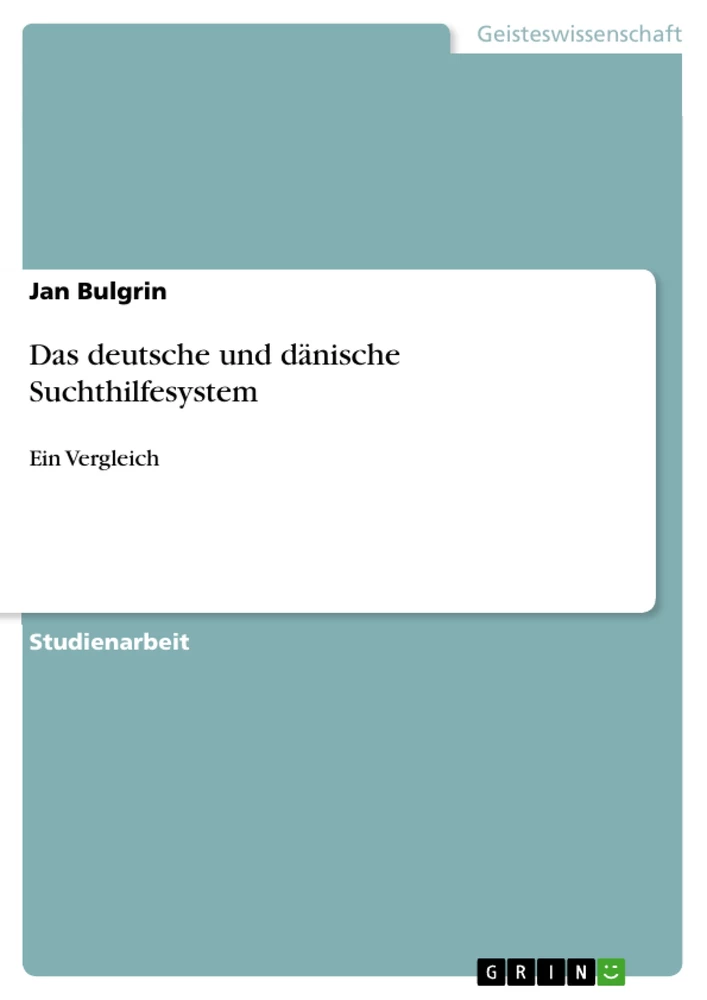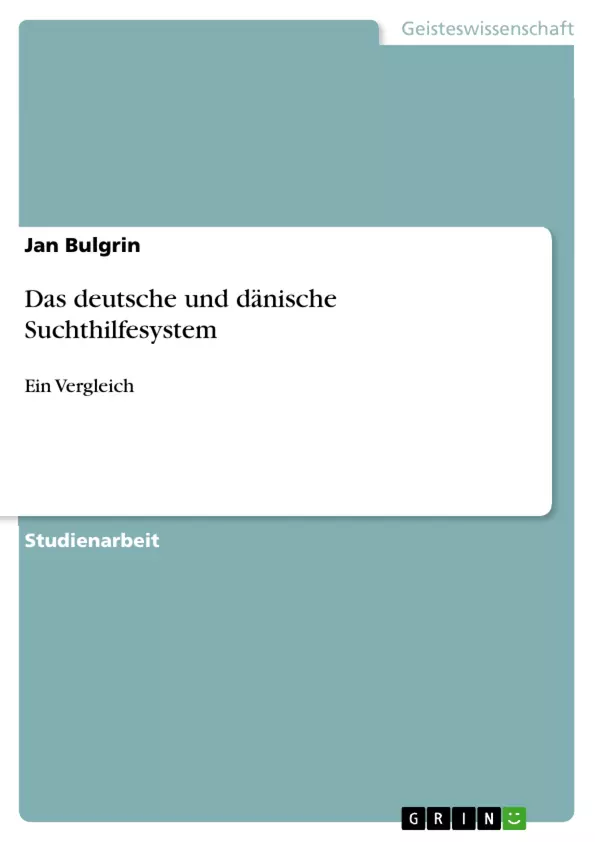Die Suchthilfe ist ein spannendes und beliebtes Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit. In der ambulanten Suchthilfe sind beispielsweise mit 69 % von allen Arbeitenden die SozialarbeiterInnen die am stärksten vertretene Berufsgruppe. Doch wie funktioniert das Suchthilfesystem in Deutschland? Und kann es mit einem anderen europäischen Land verglichen werden?
Um diese Fragestellungen zu bearbeiten, wird in erster Instanz das Suchthilfesystem in Deutschland dargestellt. Um die Vergleichbarkeit mit einem anderen System der Suchthilfe herzustellen, muss der Blick auf die Europäische Union geweitet werden. Diese verfügt in der Drogen- und Suchtpolitik nur über eine begrenzte Zuständigkeit. Denn durch den Vertrag von Lissabon fallen die Politikfelder wie die Gesundheits- und Sozialpolitik in den Kompetenzbereich der Mitglieder. Jedoch gibt die EU eine Strategie vor, die darauf abzielt, das Wohl der Gesellschaft und des Einzelnen zu wahren und zu steigern, die Volksgesundheit zu schützen, der Öffentlichkeit ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten und das Drogenphänomen mit einem ausgewogenen, integrierten und faktengestützten Konzept anzugehen. Um diese zu erfüllen, gibt es die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD). In Bezug auf die EBDD kann also ein Vergleich zwischen zwei europäischen Ländern stattfinden, um die zweite Fragestellung bearbeiten zu können. Meine Wahl ist hierbei auf das deutsche Nachbarland Dänemark gefallen. Das dänische Suchthilfesystem wird dementsprechend als zweiter Punkt dargestellt. Der Vergleich soll im dritten Schritt anhand ausgewählter Indikatoren stattfinden. Die Indikatoren umfassen den Aufbau und die Struktur, Behandlungsangebote und Kosten bzw. Finanzierung des Systems. Hierbei sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Nachbarländer verdeutlicht und ausgewertet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Suchthilfesystem in Deutschland
- Hintergrund und Aufbau des Systems
- Behandlungsangebote und Kosten
- Kritik am deutschen Suchthilfesystem
- Das dänische Suchthilfesystem
- Vergleich zwischen den Suchthilfesystemen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert das deutsche Suchthilfesystem und setzt es in Relation zum dänischen System. Sie untersucht die Strukturen, Behandlungsangebote, Kosten und Finanzierung beider Systeme, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen.
- Aufbau und Struktur des deutschen und dänischen Suchthilfesystems
- Behandlungsangebote und -methoden in Deutschland und Dänemark
- Kosten und Finanzierung der Suchthilfe in beiden Ländern
- Vergleichende Analyse der Systeme hinsichtlich Effektivität und Zugang
- Kritik und Herausforderungen im deutschen und dänischen Suchthilfesystem
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Suchthilfe ein und skizziert die Relevanz des Vergleichs zwischen dem deutschen und dem dänischen System. Die Hausarbeit stellt die Forschungsfrage und die Methode der Analyse vor.
Das Suchthilfesystem in Deutschland
Dieses Kapitel beleuchtet das deutsche Suchthilfesystem, seinen historischen Hintergrund, seine Struktur und die wichtigsten Akteure. Es erläutert die Herausforderungen, die das System zu bewältigen hat, und beleuchtet die aktuelle Debatte um den Abstinenzgedanken.
Das dänische Suchthilfesystem
Das Kapitel konzentriert sich auf das dänische Suchthilfesystem und beschreibt dessen Struktur, Behandlungsangebote und Finanzierung. Es setzt den Fokus auf Besonderheiten und Unterschiede zum deutschen System.
Vergleich zwischen den Suchthilfesystemen
Dieser Abschnitt vergleicht die deutschen und dänischen Systeme anhand ausgewählter Indikatoren wie Aufbau, Behandlungsangebote, Kosten und Finanzierung. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysiert und bewertet.
Schlüsselwörter
Suchthilfe, Drogenabhängigkeit, Alkoholkonsum, Soziales System, Deutschland, Dänemark, Vergleich, Struktur, Behandlungsangebote, Kosten, Finanzierung, Abstinenz, Reintegration.
Häufig gestellte Fragen
Welche Länder werden im Suchthilfesystem verglichen?
Die Arbeit vergleicht das deutsche Suchthilfesystem mit dem dänischen System.
Welche Rolle spielt die EU in der Suchtpolitik?
Die EU hat nur begrenzte Zuständigkeiten, da Gesundheits- und Sozialpolitik in der Kompetenz der Mitgliedstaaten liegen. Sie gibt jedoch Strategien vor und betreibt die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EBDD).
Welche Indikatoren werden für den Systemvergleich genutzt?
Der Vergleich erfolgt anhand von Aufbau und Struktur, Behandlungsangeboten sowie Kosten bzw. der Finanzierung der Systeme.
Wie hoch ist der Anteil an Sozialarbeitern in der deutschen Suchthilfe?
In der ambulanten Suchthilfe in Deutschland stellen Sozialarbeiter mit 69 % die am stärksten vertretene Berufsgruppe dar.
Was ist ein zentraler Kritikpunkt am deutschen System?
Ein wichtiger Diskussionspunkt ist die Debatte um den Abstinenzgedanken und die Herausforderungen bei der Reintegration.
- Citation du texte
- Jan Bulgrin (Auteur), 2022, Das deutsche und dänische Suchthilfesystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1192586