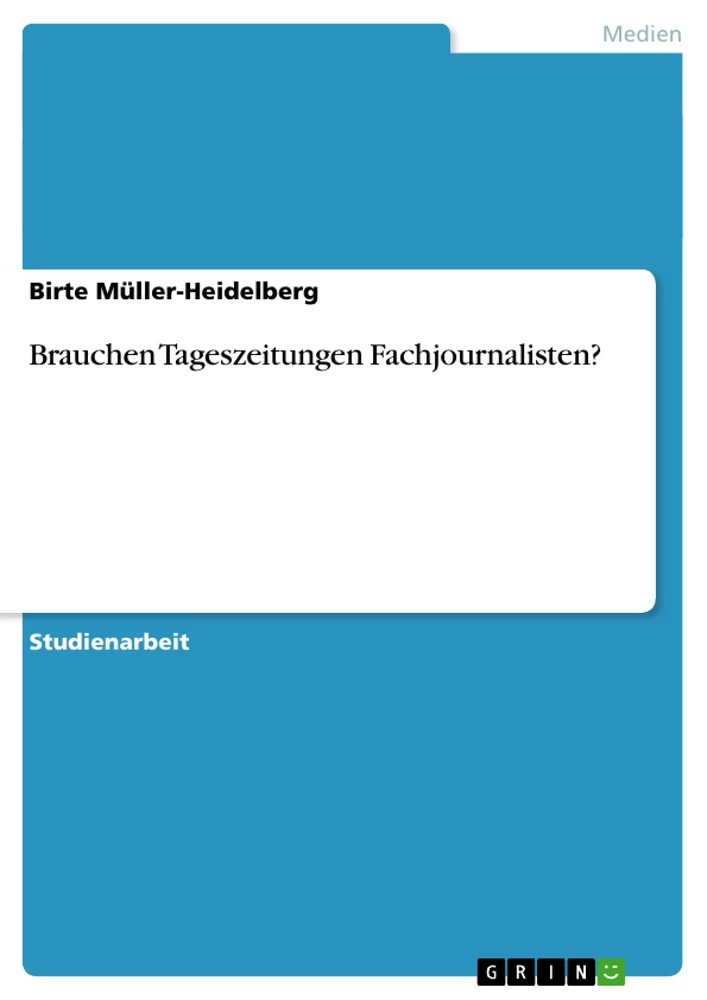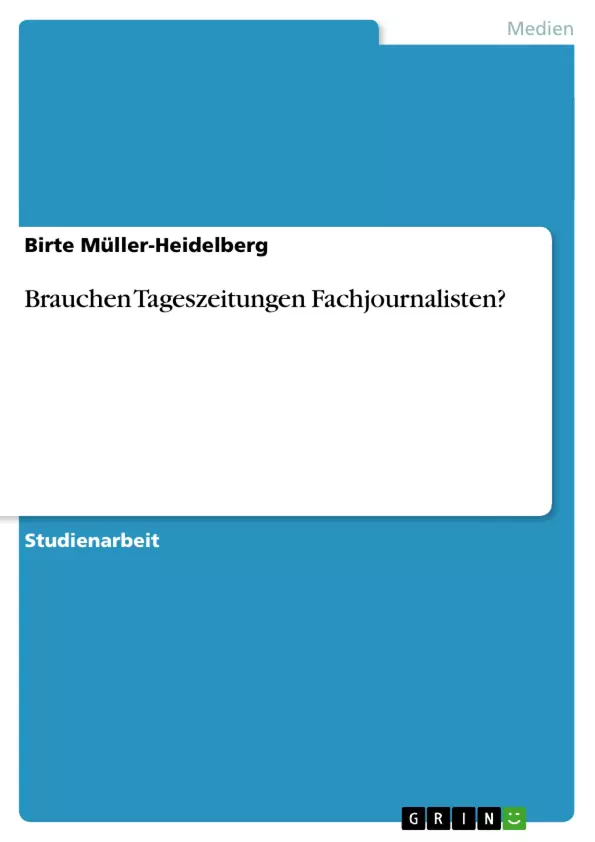Wissen ist wieder sexy. Wissen boomt. Schon Benjamin Franklin (†1790) wusste das. „Eine Investition in Wissen bringt noch immer die besten Zinsen,“ verkündete er und stellte so eine Behauptung in den Raum, die ein gutes Jahrhundert nach seinem Tod wie Makulatur wirkte. 1899 stellte Charles H. Duell, der Leiter des US-Patentamtes, einen Antrag beim New Yorker Bürgermeister, sein Amt zu schließen, da alles erfunden sei, was es zu erfinden gebe. Natürlich stimmte das nicht, der Antrag wurde abgelehnt, aber der Vorfall ist exemplarisch für eine Ära: Wissen wurde langweilig. Statt dessen „amüsierten wir uns zu Tode.“ Heute, gut weitere 100 Jahre später, brachten Formate wie Wer wird Millionär den Wandel. Wissen boomt. Wissen ist wieder sexy.
Nicht nur Quizshows liefern enorme Einschaltquoten, auch Wissensmagazine locken die Zuschauer vor den Fernsehbildschirm. Ursachen dafür gibt es ebenso zahlreiche wie Soziologen, die sie erforschen. Gerd Appenzeller, Redaktionsdirektor des Berliner Tagesspiegels, sieht den Grund unter anderem im generell steigenden Bildungsgrad der Deutschen. Mit zunehmender Bildung steige auch das Interesse für Wissenschaft.
Betroffen vom Boom des Wissens, des Wissenswerten und der Wissenschaft ist aber nicht nur das Fernsehen. Auch im Printbereich lässt sich eine Entwicklung beobachten, die spezialisierten Zeitschriften eine rosige Zukunft verheißt. Fachmedien verzeichnen steigende Leser- und Nutzerzahlen. Eines der bekanntesten Wissensmagazine, P.M., wirbt nicht umsonst mit dem Spruch: „Wissen kommt an.“ Geo, das Flagschiff des Segments Wissen, verzeichnet ebenso wie P.M. seit Jahren konstante Auflagenzahlen; und das, obwohl es dem Medienmarkt in der Gesamtheit schlecht geht. Die amerikanischen Zeitschriften National Geographic und Scientific American finden auch in Deutschland reißenden Absatz; die deutschsprachige Ausgabe des Scientific American, Spektrum der Wissenschaft, hat ebenso wie ihr Konkurrenzheft Bild der Wissenschaft eine Auflage von über 100000.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil A theoretischer Teil
- Wissen als Chance – Tageszeitungen brauchen ein Profil
- Vom Ressort zum Team – die Redaktionen der Tageszeitungen im Wandel
- Definitionen
- Fachjournalist - Versuch einer Definition
- Der Fachjournalist in der Tageszeitung
- Teil B - empirischer Teil
- Problemstellung
- Untersuchung an konkreten Beispielen
- Selektion/Reduktion
- Untersuchung der Stichprobe
- Generalisierung
- Rückbezug auf die Theorie
- Fazit und Prognose
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht, inwiefern Tageszeitungen Fachjournalisten benötigen, um sich im Medienmarkt zu behaupten. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, denen Tageszeitungen im Zeitalter digitaler Medien und schnelllebiger Informationsflüsse gegenüberstehen, und beleuchtet die Rolle von Spezialisierung und Fachwissen in diesem Kontext.
- Entwicklung und Relevanz von Fachjournalismus
- Wandel von Redaktionsstrukturen und Ressortorganisation
- Bedeutung von Expertise und Hintergrundinformationen
- Der Einfluss des Wissenschafts- und Fachjournalismus auf die Medienlandschaft
- Analyse der Relevanz von Fachjournalisten für Tageszeitungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den aktuellen Boom des Wissens und die wachsende Bedeutung von Wissensmagazinen dar. Sie argumentiert, dass Tageszeitungen mit dem Tempo der neuen Medien nicht mithalten können und sich daher neue Profile schaffen müssen, um sich zu behaupten. Die Arbeit betrachtet den Fachjournalismus als eine Möglichkeit, sich vom überquellenden Markt der Informationen abzuheben.
Kapitel 1 „Wissen als Chance – Tageszeitungen brauchen ein Profil“ analysiert die Herausforderungen, denen Tageszeitungen im digitalen Zeitalter gegenüberstehen, und betont die Notwendigkeit, sich von reinem Nachrichtenjournalismus zu entfernen. Der Fachjournalismus wird als ein möglicher Weg zur Profilierung vorgestellt.
Kapitel 2 „Vom Ressort zum Team – die Redaktionen der Tageszeitungen im Wandel“ untersucht die Veränderung von Redaktionsstrukturen und den Übergang von klassischen Ressorts hin zu spezialisierten Fachgruppen. Die Arbeit betrachtet diesen Wandel als Reaktion auf die wachsende Bedeutung von Spezialwissen und die Notwendigkeit, mit komplexen Themen effektiv umzugehen.
Der empirische Teil der Arbeit analysiert die Rolle des Fachjournalismus in konkreten Beispielen. Kapitel 4 „Problemstellung“ formuliert die Fragestellung der Untersuchung. Kapitel 5 „Untersuchung an konkreten Beispielen“ untersucht eine Stichprobe, um die Bedeutung von Fachjournalisten in der Praxis zu beleuchten.
Das Kapitel „Fazit und Prognose“ fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht Schlussfolgerungen über die Relevanz von Fachjournalisten für Tageszeitungen.
Schlüsselwörter
Tageszeitungen, Fachjournalismus, Redaktionsstrukturen, Wissensboom, Spezialisierung, Expertenteams, Ressortorganisation, Medienwandel, Hintergrundinformationen, Informationsflüsse, digitale Medien.
Häufig gestellte Fragen
Warum benötigen Tageszeitungen heute Fachjournalisten?
In einer Zeit der Informationsflut und schneller digitaler Medien müssen sich Tageszeitungen durch Tiefe, Expertise und Hintergrundinformationen profilieren. Fachjournalisten bieten das notwendige Spezialwissen, um komplexe Themen verständlich und exklusiv aufzubereiten.
Was ist mit dem "Wissensboom" gemeint?
Wissen gilt heute als attraktiv ("sexy"). Formate wie Quizshows und Wissensmagazine (z.B. Geo, P.M.) verzeichnen trotz Medienkrise hohe Reichweiten, was ein gesteigertes Bildungsinteresse der Gesellschaft widerspiegelt.
Wie verändern sich die Redaktionsstrukturen in Zeitungen?
Es findet ein Wandel von klassischen, starren Ressorts hin zu flexiblen Expertenteams statt. Diese Teams können fachübergreifend an komplexen Themen arbeiten und so die Qualität der Berichterstattung steigern.
Welchen Einfluss hat der Bildungsgrad auf den Medienkonsum?
Mit steigendem Bildungsgrad wächst das Interesse an wissenschaftlichen und spezialisierten Inhalten. Dies bietet Tageszeitungen die Chance, durch qualitativen Fachjournalismus neue Leserschichten zu binden.
Können Tageszeitungen mit dem Tempo digitaler Medien mithalten?
Rein zeitlich ist das kaum möglich. Daher liegt die Strategie nicht in der Schnelligkeit, sondern in der Einordnung und Analyse, wofür spezialisierte Fachjournalisten unerlässlich sind.
- Citation du texte
- Birte Müller-Heidelberg (Auteur), 2003, Brauchen Tageszeitungen Fachjournalisten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11925