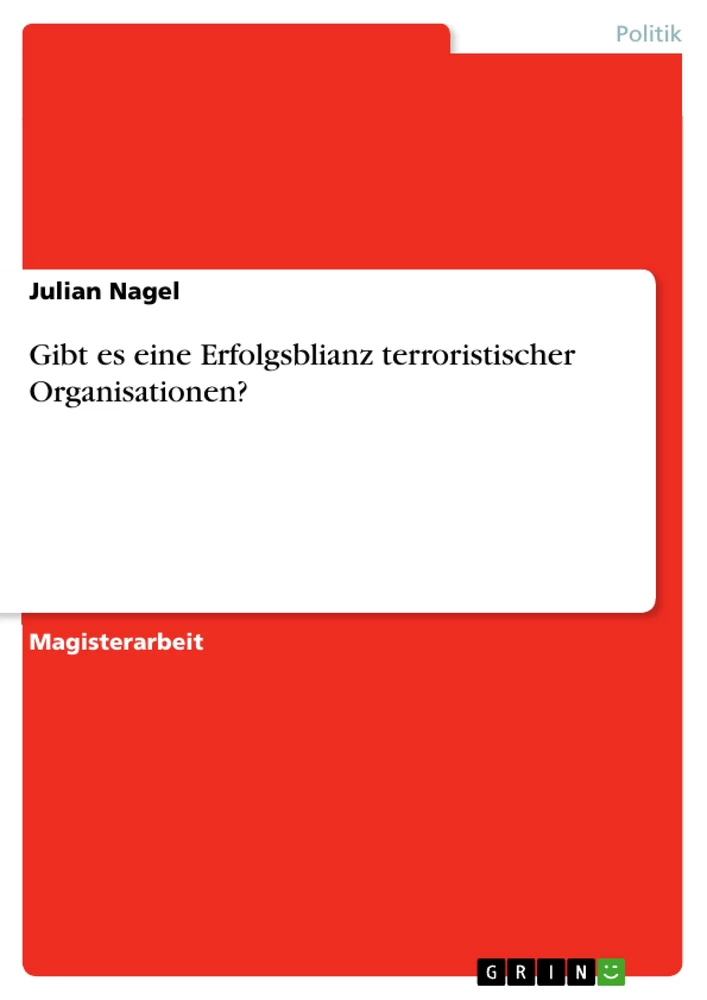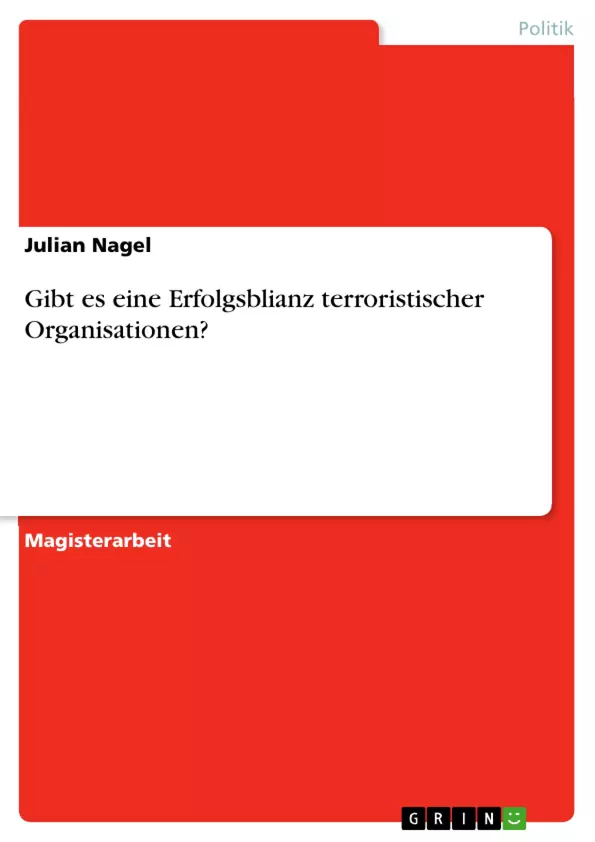Mit den Anschlägen auf das World Trade Center am 11.09.2001 ist das Wort Terrorismus zu einem der wichtigsten in der Politik und in der Politikwissenschaft geworden. Zahlreiche Aufsätze und Bücher wurden infolge der Anschläge veröffentlicht, welche sich mit Terrorismus befassen. Jedoch gab es nur selten eine wirklich strategische Befassung mit dem Phänomen Terrorismus in Bezug auf seine Vorgehensweise. Fest zu stellen ist hierbei, dass klassische Strategien, wie man sie für den konventionellen Krieg entwickelt hatte, keine oder nur in wenigen Anteilen Anwendung finden konnten. Dabei hat sich Terrorismus bzw. haben sich terroristische Organisationen als strategische Denker in einem Konflikt bewiesen. Nur, wenn dies festgestellt und angenommen wird, kann es eine analytische Betrachtung des Phänomens geben.
Im Folgenden soll dabei festgestellt werden, wie sich dieses strategische Vorgehen von terroristischen Organisationen darstellt. Dazu ist es zunächst unabdingbar, eine Definition festzulegen, welche für diese Arbeit Gültigkeit besitzt. Des Weiteren ist es wichtig, den Terrorismus, wie er hier verstanden werden soll, von anderen Phänomenen abzugrenzen. Eine solch präzise Eingrenzung ist von Nöten, da nur so erfasst werden kann, was zu Terrorismus hinzuzuzählen ist, und für welche Organisationen die Analyse gel-ten soll.
Im Anschluss an eine Eingrenzung des Begriffs wird in dieser Arbeit dann ein Modell vorgestellt, welches aufzeigt, wie Terroristen strategisch vorgehen, um ihre Ziele zu erreichen. Das Modell hat jedoch keine Gültigkeit für alle Formen des Terrorismus und bezieht sich nur auf ethno-nationalistischen und religiös- fundamentalistischen Terrorismus.
Es wird in dem Modell davon ausgegangen, dass Terrorismus drei große Strategiekategorien verfolgt. Diese sind: die Kommunikations-, die Provokations-, und die Radikalisierungsstrategie. Alle drei haben dabei eine eigenständige Intention und verfolgen verschiedene Ziele. Sie machen das Kernstück des Modells für terroristische Strategien aus. Neben diesen drei Elementen gibt es aber in der terroristischen Strategie noch zusätzlich den Faktor Zeit, sowie ein übergeordnetes Ziel, welches Terroristen immer verfolgen. Grundsätzlich versucht Terrorismus immer in irgendeiner Form eine politi-sche Ordnung zu verändern.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Arbeitsdefinition Terrorismus
- 3. Abgrenzung Terrorismus und sinnverwandte Phänomene
- 3.1. Terrorismus und Terror
- 3.2. Terrorismus und Guerilla
- 3.3. Terrorismus und Kriminalität
- 4. Kategorien des Terrorismus
- 4.1. Ethno-nationalistischer Terrorismus
- 4.2. Sozialrevolutionärer Terrorismus
- 4.3. Rechtsextremistischer Terrorismus
- 4.4. Religiös-fundamentalistischer Terrorismus
- 5. Eine Strategietheorie über das Handeln terroristischer Organisationen
- 5.1. Die Kommunikationsstrategie
- 5.1.1. Kategorien der Kommunikationsstrategie
- 5.1.2. Ziele der Kommunikationsstrategie
- 5.1.3. Misserfolg der Kommunikationsstrategie
- 5.2. Die Provokationsstrategie
- 5.2.1. Kategorien der Provokationsstrategie
- 5.2.2. Ziele der Provokationsstrategie
- 5.2.3. Misserfolg der Provokationsstrategie
- 5.3. Radikalisierung und politische Partizipation
- 5.3.1. Ziele der Radikalisierung und der politischen Partizipation
- 5.3.2. Misserfolg der Radikalisierung und der politischen Partizipation
- 5.4. Das übergeordnete Ziel: Die Veränderung der bestehenden Ordnung
- 5.4.1. Misserfolg des Ziels eine bestehende Ordnung zu verändern
- 5.5. Der Faktor Zeit in der terroristischen Strategie
- 5.1. Die Kommunikationsstrategie
- 6. Fallbeispiel: Al-Qaida im Irak
- 6.1. Die Kommunikationsstrategie von AQI
- 6.1.1. Ziele der Kommunikationsstrategie von AQI
- 6.2. Die Provokationsstrategie von AQI
- 6.2.1. Ziele der Provokationsstrategie von AQI
- 6.3. Erfolg und Misserfolg der Kommunikations- und der Provokationsstrategie
- 6.4. Die Radikalisierungsstrategie von AQI und dessen Misserfolg
- 6.5. Das übergeordnete Ziel von AQI und der Faktor Zeit
- 6.1. Die Kommunikationsstrategie von AQI
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Strategien terroristischer Organisationen und analysiert, ob es eine messbare „Erfolgsbilanz“ gibt. Es wird ein strategisches Modell vorgestellt, das die Vorgehensweise ethno-nationalistischer und religiös-fundamentalistischer Terrorgruppen beschreibt.
- Definition und Abgrenzung von Terrorismus
- Strategische Kategorien terroristischen Handelns (Kommunikation, Provokation, Radikalisierung)
- Der Faktor Zeit und das übergeordnete Ziel der Veränderung bestehender Ordnungen
- Fallstudie Al-Qaida im Irak (AQI) als Beispiel für religiös-fundamentalistischen Terrorismus
- Analyse von Erfolg und Misserfolg terroristischer Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und begründet die Notwendigkeit einer strategischen Betrachtung von Terrorismus. Kapitel 2 definiert den Begriff Terrorismus und grenzt ihn von verwandten Phänomenen ab. Kapitel 3 bis 4 kategorisieren verschiedene Formen des Terrorismus. Kapitel 5 stellt ein strategisches Modell vor, das die Kommunikations-, Provokations- und Radikalisierungsstrategien terroristischer Organisationen beschreibt, sowie deren Ziele und potenzielle Misserfolge. Kapitel 6 untersucht Al-Qaida im Irak (AQI) als Fallbeispiel, analysiert deren Strategien und deren Erfolg bzw. Misserfolg.
Schlüsselwörter
Terrorismus, Terrorismusstrategien, Kommunikationsstrategie, Provokationsstrategie, Radikalisierung, ethno-nationalistischer Terrorismus, religiös-fundamentalistischer Terrorismus, Al-Qaida im Irak (AQI), Erfolgsbilanz, strategische Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Welche drei Hauptstrategien verfolgen terroristische Organisationen?
Das vorgestellte Modell unterscheidet zwischen der Kommunikationsstrategie, der Provokationsstrategie und der Radikalisierungsstrategie.
Was ist das übergeordnete Ziel von Terrorismus?
Grundsätzlich versucht Terrorismus immer, eine bestehende politische oder gesellschaftliche Ordnung grundlegend zu verändern.
Wie unterscheidet sich Terrorismus von Guerilla-Kämpfen?
Die Arbeit bietet eine präzise Abgrenzung zwischen Terrorismus und sinnverwandten Phänomenen wie Terror, Guerilla und allgemeiner Kriminalität.
Welche Rolle spielt der Faktor Zeit in der terroristischen Strategie?
Zeit wird als strategisches Element betrachtet, da terroristische Gruppen oft auf langfristige Zermürbung und verzögerte politische Reaktionen setzen.
Welches Fallbeispiel wird in der Arbeit analysiert?
Die Strategien werden am Beispiel von Al-Qaida im Irak (AQI) und deren Erfolg bzw. Misserfolg untersucht.
Für welche Arten von Terrorismus gilt das vorgestellte Modell?
Das Modell bezieht sich primär auf ethno-nationalistischen und religiös-fundamentalistischen Terrorismus.
- Citar trabajo
- Julian Nagel (Autor), 2008, Gibt es eine Erfolgsblianz terroristischer Organisationen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119356