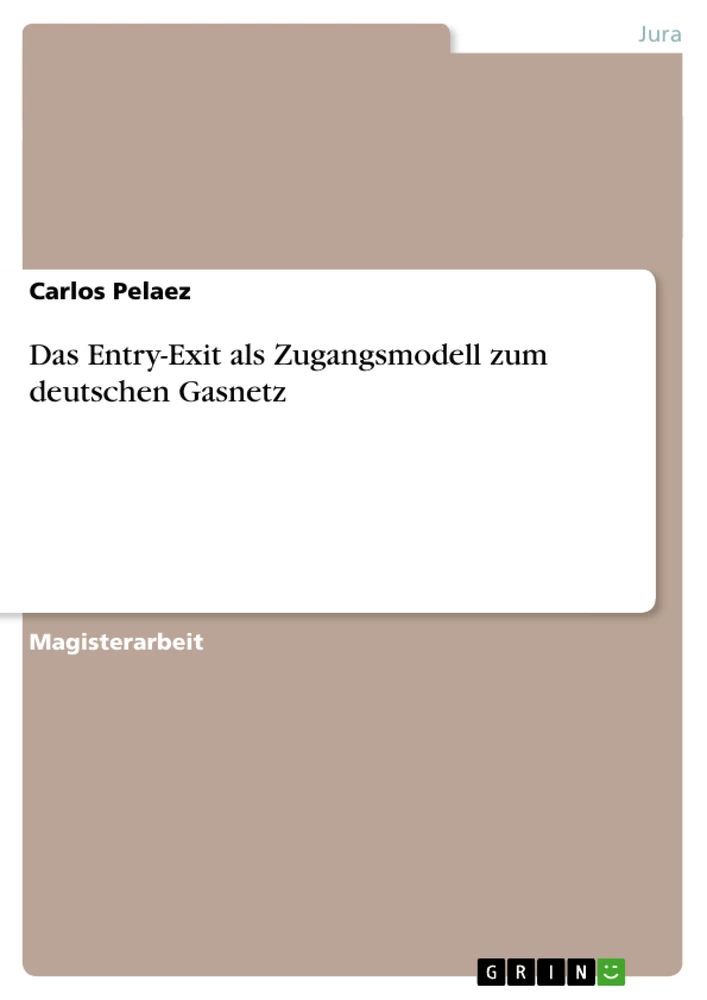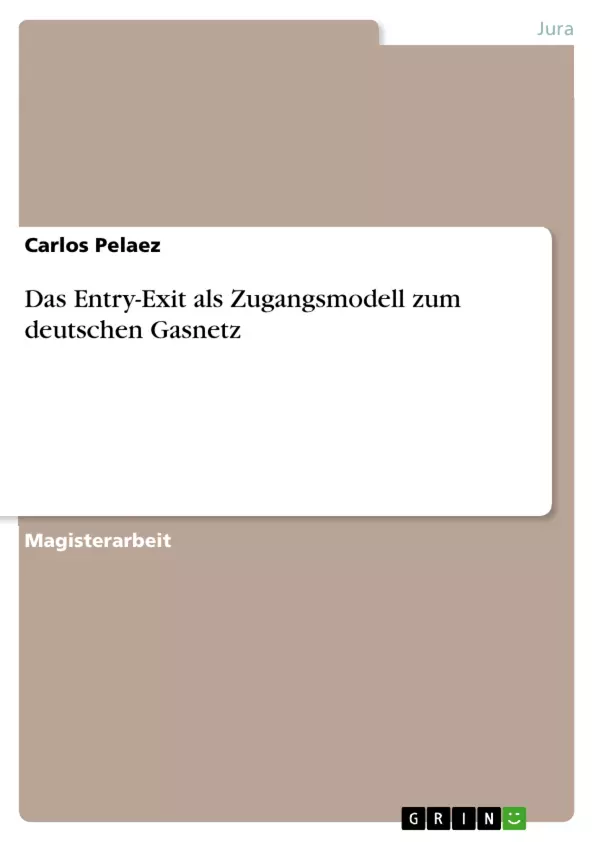Aufgrund seiner relativen Umweltfreundlichkeit und vielfältigen Einsetzbarkeit gilt das Erdgas als einer der bevorzugten Energieträger. Dies ist einer der Gründe für die zunehmende Erdgasnachfrage, die auf den Energiemärkten weltweit zu beobachten ist. Die sichere und preiswerte Versorgung mit Erdgas ist daher zu einem wichtigen Ziel deutscher und europäischer Energiepolitik geworden. Dem steht jedoch entgegen, dass das Prinzip der Leitungsgebundenheit die Bildung monopolischer Strukturen am Gasmarkt begünstigt. Das bedeutet, dass die Inhaber der Gasnetze ihre Verfügungs- und Steuerungsmacht ausnutzen können, um Preise und Bedingungen des Erdgasbezugs ihren Interessen gemäß zu gestalten. Die Zielsetzung des Mitte der 80er Jahre initiierten Prozess der Liberalisierung der europäischen Energiemärkte ist es daher, diese monopolischen Strukturen durch die Ermöglichung von mehr Wettbewerb aufzubrechen. Dabei werden der Parallelleitungsbau und der Netzzugang als die beiden wesentlichen Instrumente zur Öffnung des Markts angesehen. Obwohl beide Instrumente aufgrund der EU-Richtlinien von 1998 Eingang in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gefunden haben, zeigte die Praxis, dass der Parallelleitungsaufbau insbesondere wegen des hohen Kapitalbedarfs und Umweltbelastungen wenig praktikabel war. Das führte mit der Richtlinie 2003/55//EG (Beschleunigungsrichtlinie) zu einer Korrektur: nunmehr wird einem funktionellen Zugang zum Gasnetz für alternative Gaslieferanten der Vorzug gegeben. Die bloße Implementierung des Rechts auf Netzzugang hatte sich allerdings als nicht ausreichend erwiesen, um die Liberalisierung des Gasmarkts in einem erwünschten Maß voranzubringen. Es hatte sich gezeigt, dass auch die konkrete Ausgestaltung des Netzzugangs geregelt werden musste. Dies umfasst die Definition eines nationalen Zugangsmodells, das mit den europarechtlichen Vorgaben übereinstimmt. In Deutschland hat der Gesetzgeber einen rechtlichen Rahmen zur Einführung eines sogenannten Entry-Exit Modells geschaffen, dabei aber einen Spielraum zur Aushandlung bestimmter Details zwischen Regulierungsbehörde und den anderen Akteuren der Gaswirtschaft gelassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Teil A: Das deutsche Erdgasnetz
- Struktur
- Funktion
- Eigentum und Betrieb
- Gesamtnetzdienstleistung
- Netzverbund
- Rechtliche Betrachtung des Netzverbunds
- Zusammenfassung
- Teil B: Netzzugang in der Gaswirtschaft
- Das Problem der monopolischen Stellung der Gasversorgungsunternehmen
- Natürliches Monopol
- Natürliches Monopol am vorgelagerten Markt (Durchleitungsmarkt)
- Natürliches Monopol am nachgelagerten Markt
- Monopol in den verschiedenen Netzstufen
- Natürliches Monopol
- Alternativen für die Einführung von Wettbewerb zum Gasmarkt
- Parallelleitungsbau
- Umwelttechnische Bewertung
- Wirtschaftliche Bewertung
- Rechtliche Bewertung
- Parallelleitungsbau
- Netzzugang
- Konzeptuelle Entwicklungen des Netzzugangs in der Europäischen Union
- Rezeption des Netzzugangskonzepts in Deutschland
- Ein neuer Begriff des Netzzugangs
- Das Problem der monopolischen Stellung der Gasversorgungsunternehmen
- Teil C: Die Vorgaben der Richtlinie 2003/55/EG
- Einführung
- Die Beschleunigungsrichtlinie – Instrumente zur Liberalisierung des Gasmarkts
- Neuregulierung des Netzzugangs
- Die Akteure des Zugangs
- Die Organisation des Netzzugangs
- Methodenregulierung im Vorab
- Die Einzelentgeltregulierung
- Die Regulierungsbehörde - Gewährleistung einer gut funktionierenden Zugangsorganisation
- Die Aufsicht der Regulierungsbehörde über den Netzbetrieb
- Entscheidungsmöglichkeit der Regulierungsbehörde aufgrund von Beschwerden durch Netznutzer
- Die Entflechtung (Unbundling) als wichtiges Instrument zur Durchsetzung des Netzzugangs
- Die gesellschaftsrechtliche Entflechtung
- Entflechtung hinsichtlich der Organisation
- Entflechtung der Rechnungslegung
- Neuregulierung des Netzzugangs
- Zugangsmodell
- Teil D: Die Umsetzung der Beschleunigungsrichtlinie in das deutsche Recht
- Die Verbändevereinbarungen (VV)
- Die Energierechtsreform von 2005 hinsichtlich der Umsetzung der Beschleunigungsrichtlinie
- Die Vorschriften des neuen EnWG bezüglich des Netzzugangs
- Entflechtung
- Netzzugang
- Anspruchsgrundlage
- Ausgestaltung des Netzzugangs
- Gasnetzzugangverordnung (GasNZV)
- Netzentgelte
- Regulierungsbehörde
- Das EnWG 2005 und die Gasverordnungen als rechtlicher Rahmen für ein bestimmtes Netzzugangsmodell
- Teil E: Das Entry-Exit Modell
- Tatbestandsmerkmale des Entry-Exit Modells
- Nur zwei Verträge
- Inhalt der Verträge
- Handel von Kapazitäten
- Entgelt - Entfernungsunabhängigkeit
- Nur zwei Verträge
- Diskussionspunkte in Bezug auf das Entry-Exit Modell
- Marktgebiete/Regelzonen
- Virtuelle Handelspunkte
- Lieferantenwechsel
- Einzelbuchung von Kapazitäten (Optionsmodell)
- Die Abweichung des Entry-Exit Modells nach dem Vorschlag der Bundesnetzagentur mit dem Entry-Exit Modell des EnWG 2005
- Übereinstimmung des Entry-Exit Modells nach dem Vorschlag der Bundesnetzagentur mit der Beschleunigungsrichtlinie
- Das Entry-Exit Modell gemäß des aktuellen Vorschlags der Bundesnetzagentur auf dem Prüfstand des europäischen Primärrechts
- Das Entry-Exit Modell als deutsche Maßnahme zur Erfüllung europarechtlicher Verpflichtungen
- Das vorgeschlagene Entry-Exit Modell und das Ziel der Gemeinschaft nach Art. 4 und 98 EG-Vertrag
- Die Applikation des Art. 10 Abs. 2 EG-Vertrag
- Tatbestandsmerkmale des Entry-Exit Modells
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Eignung des in Deutschland diskutierten Entry-Exit-Modells zur Förderung von Wettbewerb auf dem Erdgasmarkt. Sie analysiert die Struktur des deutschen Erdgasnetzes, die Herausforderungen des Netzzugangs und die Vorgaben der EU-Beschleunigungsrichtlinie.
- Struktur und Charakteristika des deutschen Erdgasnetzes
- Analyse des Netzzugangs als Instrument zur Marktöffnung
- Bewertung der EU-Richtlinien und deren Umsetzung in deutsches Recht
- Detaillierte Betrachtung des Entry-Exit-Modells
- Rechtliche Übereinstimmung des Entry-Exit-Modells mit europäischem und nationalem Recht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Relevanz des Themas und die Zielsetzung der Arbeit. Teil A präsentiert die Struktur und Funktionsweise des deutschen Erdgasnetzes. Teil B beleuchtet die Problematik monopolischer Strukturen und alternative Lösungsansätze wie den Netzzugang. Teil C analysiert die Vorgaben der EU-Beschleunigungsrichtlinie zur Liberalisierung des Gasmarkts und verschiedene Instrumente wie die Entflechtung. Teil D beschreibt die Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht, insbesondere durch das EnWG 2005. Teil E stellt das Entry-Exit-Modell vor und diskutiert seine verschiedenen Aspekte, ohne jedoch auf die Schlussfolgerungen einzugehen.
Schlüsselwörter
Erdgasmarkt, Netzzugang, Entry-Exit-Modell, Monopol, Liberalisierung, Beschleunigungsrichtlinie, EU-Recht, EnWG, Regulierung, Wettbewerb.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Entry-Exit-Modell im Gasmarkt?
Das Entry-Exit-Modell ist ein Netzzugangsmodell, bei dem Transportkapazitäten unabhängig vom physischen Weg an Einspeise- (Entry) und Ausspeisepunkten (Exit) gebucht werden.
Warum wird der Gasmarkt liberalisiert?
Ziel ist es, monopolistische Strukturen der Netzbetreiber aufzubrechen und Wettbewerb durch den freien Zugang alternativer Gaslieferanten zum bestehenden Netz zu ermöglichen.
Was bedeutet „Entflechtung“ (Unbundling) im EnWG?
Entflechtung bezeichnet die Trennung von Netzbetrieb und Gasvertrieb, um Diskriminierung zu verhindern und faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.
Welche Rolle spielt die EU-Beschleunigungsrichtlinie 2003/55/EG?
Diese Richtlinie gab den rechtlichen Rahmen für die Öffnung der europäischen Energiemärkte vor und verpflichtete die Mitgliedstaaten zur Einführung regulierter Netzzugangsmodelle.
Was ist ein virtueller Handelspunkt im Gasnetz?
Ein virtueller Handelspunkt ermöglicht den Gashandel innerhalb eines Marktgebiets, ohne dass eine physische Übergabe an einem spezifischen Knotenpunkt erfolgen muss.
- Arbeit zitieren
- LLM Carlos Pelaez (Autor:in), 2006, Das Entry-Exit als Zugangsmodell zum deutschen Gasnetz, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119365