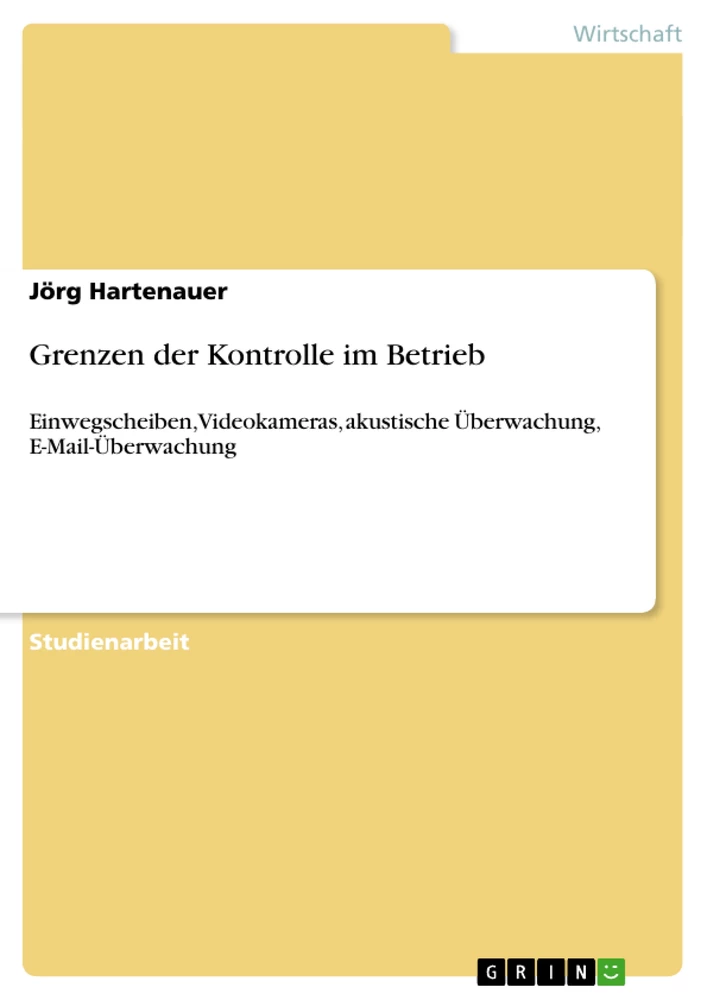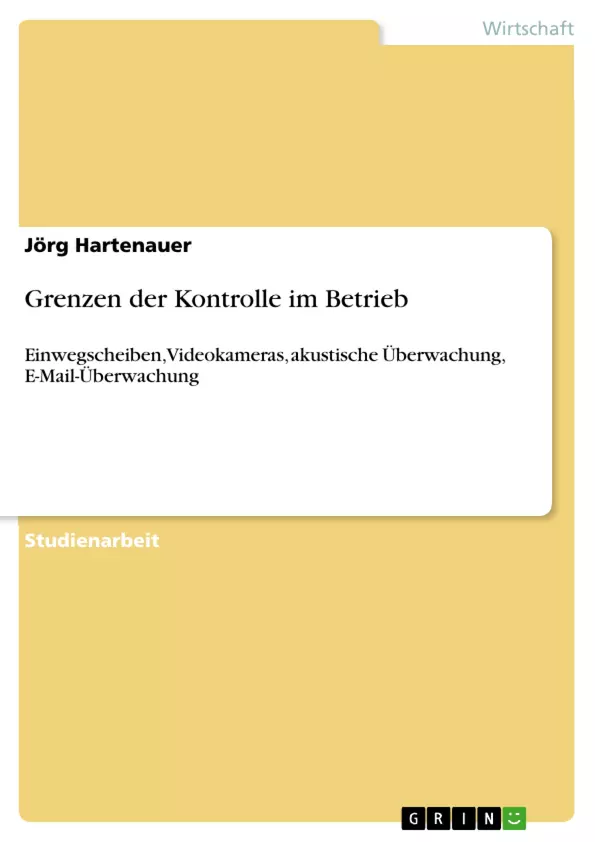In deutschen Firmen betragen die Schäden, die durch vorsätzliches kriminelles Fehlverhalten von Mitarbeitern entstehen, je nach Quelle zwischen 3 und 15 Milliarden Euro pro Jahr. Im Jahr 2000 gab es in Deutschland rund 90.000 registrierte Fälle von Wirtschaftskriminalität. Bei dieser Vielzahl von Vergehen verwundert es nicht, dass Arbeitgeber nach Möglichkeiten suchen, ihr Unternehmen vor solchen finanziellen Schäden zu schützen. Ein häufig beschrittener Weg ist die Überwachung der Arbeitnehmer mit der Hilfe technischer Einrichtungen. Sie dient jedoch nicht nur einer Prävention von Straftaten, sondern auch eine Kontrolle des Arbeitsverhaltens könnte ohne Weiteres möglich sein. Da solche Maßnahmen aber nicht nur (durch das Bewusstsein mehr oder weniger ständiger Kontrolle) Druck auf die Überwachten verursachen, sondern auch die allgemeinen Persönlichkeitsrechte tangieren oder verletzen, sind ihnen durch verschiedene Gesetze Grenzen gesetzt.
Auch handeln Arbeitnehmer, die sich einer Kontrolle bewusst sind, verkrampfter. Dadurch können dem Unternehmen indirekt Schäden entstehen, da die Arbeitsleistung niedriger ist als bei unbeobachteten Arbeitnehmern. Daher liegt es auch Interesse des Arbeitgebers, die Maßnahmen zur Kontrolle der eigenen Mitarbeiter nicht zu stark auszubauen. Entscheidend ist die Frage, wie die Interessen und Grundrechte der Arbeitnehmer und die ebenso berechtigten Interessen und Grundrechte des Arbeitgebers gegeneinander abgewogen werden können.
In dieser Hausarbeit werde ich kurz die wichtigsten gesetzlichen Regelungen vorstellen, um dann einige konkrete Möglichkeiten der Überwachung in ihrer Funktion und in ihrer rechtlichen Zulässigkeit näher zu betrachten. Dadurch soll die Frage geklärt werden, wie weit die Kontrolle von Mitarbeitern in der Praxis tatsächlich gehen darf, in welchen Punkten die Rechte der Arbeitnehmer überwiegen, aber auch in welchen Situationen der Unternehmer als schutzwürdiger als der Arbeitnehmer eingestuft wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Gründe für die Kontrolle von Mitarbeitern
- 2 Rechtliche Grundlagen
- 2.1 Grundgesetz
- 2.2 Bundesdatenschutzgesetz
- 2.3 Betriebsverfassungsgesetz
- 3 Überwachungseinrichtungen und ihre Anwendbarkeit
- 3.1 Einwegscheiben
- 3.1.1 Funktionsbeschreibung
- 3.1.2 Rechtliche Bewertung
- 3.2 Videokameras
- 3.2.1 Funktionsbeschreibung
- 3.2.2 Rechtliche Bewertung
- 3.3 Akustische Überwachung
- 3.3.1 Einführung
- 3.3.2 Rechtliche Bewertung
- 3.3.3 Telefonische Überwachung
- 3.4 E-Mail-Überwachung
- 3.4.1 Funktionsbeschreibung
- 3.4.2 Rechtliche Bewertung
- 3.1 Einwegscheiben
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die rechtlichen Grenzen der Mitarbeiterkontrolle in Unternehmen anhand verschiedener technischer Überwachungsmöglichkeiten wie Einwegscheiben, Videokameras, akustische Überwachung und E-Mail-Überwachung. Die Arbeit analysiert die gesetzlichen Regelungen und deren Anwendung in der Praxis.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Mitarbeiterüberwachung
- Funktionsweise und rechtliche Zulässigkeit verschiedener Überwachungstechniken
- Abwägung der Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
- Konkrete Beispiele und Fallstudien zur Mitarbeiterkontrolle
- Auswirkungen von Überwachung auf die Arbeitsleistung und das Arbeitsklima
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die Gründe für die Kontrolle von Mitarbeitern, ausgehend von den hohen finanziellen Schäden durch Wirtschaftskriminalität. Es wird jedoch auch auf die potenziellen negativen Auswirkungen von Überwachung auf die Arbeitsleistung und das Arbeitsklima hingewiesen.
Kapitel 2 beschreibt die relevanten rechtlichen Grundlagen, beginnend mit dem Grundgesetz und seinen Garantien der Menschenwürde und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Es werden das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) als wichtige Rechtsgrundlagen erläutert.
Kapitel 3 analysiert verschiedene Überwachungstechniken (Einwegscheiben, Videokameras, akustische Überwachung und E-Mail-Überwachung) im Hinblick auf ihre Funktionsweise und rechtliche Zulässigkeit. Es wird jeweils eine detaillierte Beschreibung und eine rechtliche Bewertung der einzelnen Methoden gegeben.
Schlüsselwörter
Mitarbeiterkontrolle, Überwachung, Datenschutz, Grundgesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Betriebsverfassungsgesetz, Videokameras, Akustische Überwachung, E-Mail-Überwachung, Rechtliche Zulässigkeit, Arbeitnehmerrechte, Arbeitgeberinteressen, Wirtschaftskriminalität.
Häufig gestellte Fragen
Welche gesetzlichen Grundlagen regeln die Mitarbeiterüberwachung in Deutschland?
Die wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen finden sich im Grundgesetz (Persönlichkeitsrechte), im Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).
Ist die Überwachung von Mitarbeitern mittels Videokameras erlaubt?
Die Zulässigkeit von Videokameras hängt von einer Interessenabwägung ab. Sie ist oft zur Prävention von Straftaten erlaubt, darf aber nicht die allgemeinen Persönlichkeitsrechte der Arbeitnehmer unverhältnismäßig verletzen.
Darf der Arbeitgeber E-Mails der Beschäftigten kontrollieren?
Die rechtliche Bewertung der E-Mail-Überwachung ist komplex und hängt unter anderem davon ab, ob die private Nutzung des Dienst-Accounts erlaubt oder untersagt ist.
Welche Auswirkungen hat ständige Kontrolle auf die Arbeitsleistung?
Studien zeigen, dass sich Arbeitnehmer unter Beobachtung oft verkrampfter verhalten, was die Arbeitsleistung senken und dem Unternehmen indirekt schaden kann.
Wie hoch ist der Schaden durch Wirtschaftskriminalität in deutschen Firmen?
Die Schäden durch vorsätzliches kriminelles Fehlverhalten von Mitarbeitern werden je nach Quelle auf jährlich 3 bis 15 Milliarden Euro geschätzt.
- Citation du texte
- Jörg Hartenauer (Auteur), 2004, Grenzen der Kontrolle im Betrieb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119368