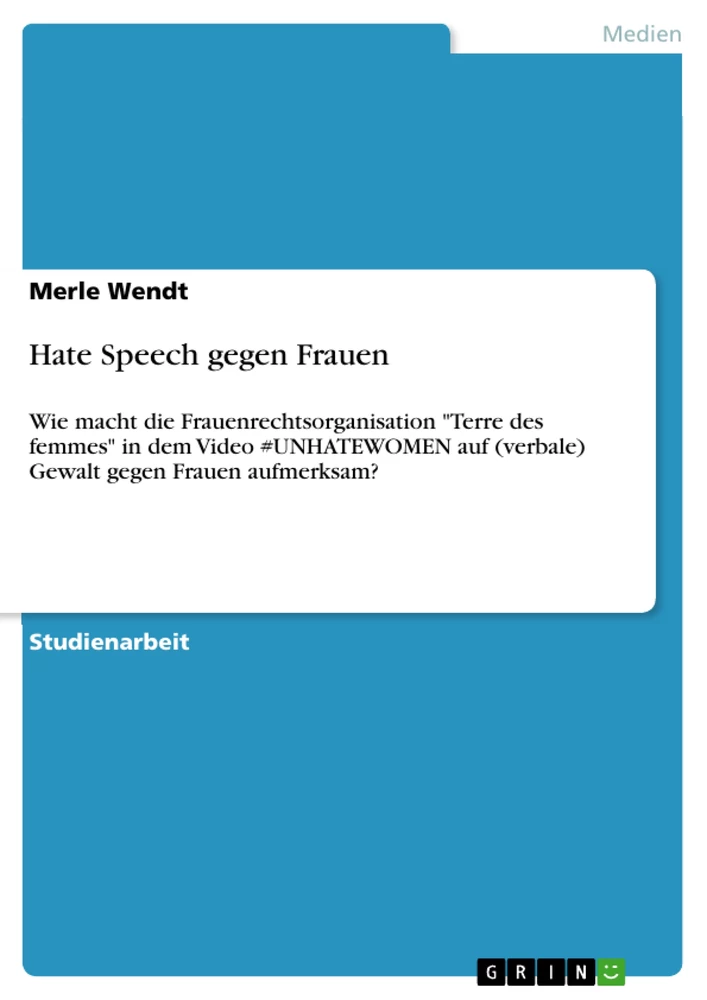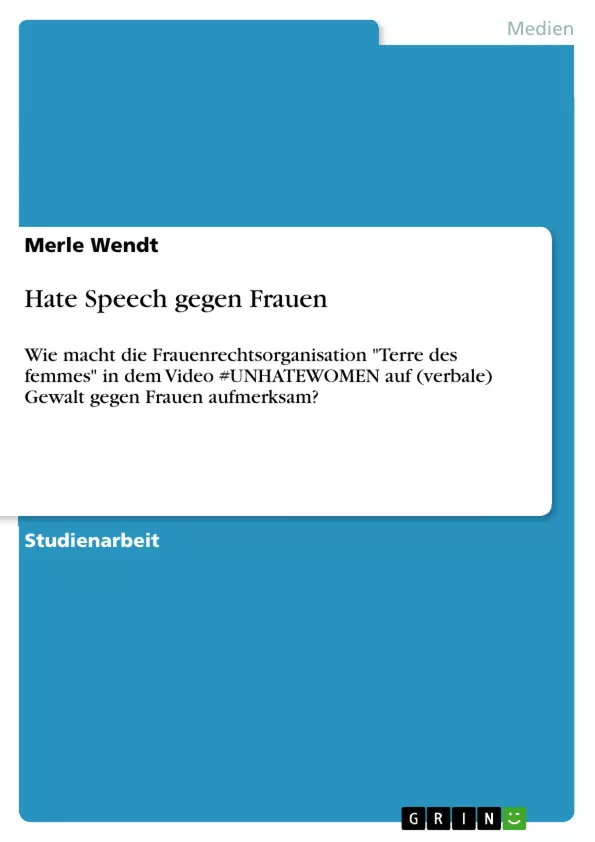Im Rahmen der vorliegenden Seminararbeit soll anhand des Videos der Online-Kampagne #UNHATEWOMEN, die Anfang 2020 startete, untersucht werden, wie die Nicht-Regierungs-Organisation Terre des femmes Frauenverachtung und -diskriminierung in den Medien thematisiert.
Im Verlauf der Arbeit soll die Forschungsfrage „Wie macht die Frauenrechtsorganisation Terre des femmes in dem Video ihrer Online-Kampagne #UNHATEWOMEN auf (verbale) Gewalt gegen Frauen aufmerksam?“ beantwortet werden.
In den Medien, insbesondere in den sozialen Netzwerken, erfahren viele Frauen und Mädchen verbale Erniedrigung und brutale Beleidigungen – dies bezieht sich auf bestimmte Annahmen, wie eine Frau zu sein hat, ihr Äußeres oder aber auch ihr Verhalten. Es soll verdeutlicht werden, dass frauenverachtende Sprache nicht nur gesellschaftlich inakzeptabel ist, sondern schnell auch zu physischer und psychischer Gewalt werden kann. Ziel der Kampagne ist es somit, auf jegliche Formen von Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Darüber hinaus soll die Sichtbarmachung des Ausmaßes von Alltagssexismus auf die Dringlichkeit, nachhaltig Veränderung in Politik und Gesellschaft zu schaffen, hinweisen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gender Media Studies
- 2.1. Feministische Öffentlichkeiten und die Sichtbarmachung geschlechtsbezogener Gewalt
- 2.1.1. Feministische Auseinandersetzungen mit geschlechtsbezogener Gewalt
- 2.1.2. Feministische Öffentlichkeiten online
- 3. Hate Speech gegen Frauen
- 4. Methodik
- 5. Darstellung der Ergebnisse
- 6. Analyse der Ergebnisse
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit untersucht die Online-Kampagne #UNHATEWOMEN der Frauenrechtsorganisation Terre des femmes. Ziel ist es, zu analysieren, wie die Organisation im Video der Kampagne auf verbale Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht.
- Feministische Öffentlichkeiten im Kontext von Geschlechtergewalt
- Hate Speech gegen Frauen in digitalen Medien
- Semiotische Medienanalyse des #UNHATEWOMEN-Videos
- Sichtbarmachung und Sensibilisierung für Alltagssexismus
- Die Rolle von Medien in der Konstruktion von Geschlechterbildern
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und stellt die Organisation Terre des femmes sowie die Relevanz von geschlechtsbezogener Gewalt vor. Kapitel 2 befasst sich mit den Gender Media Studies und beleuchtet die Entwicklung feministischer Öffentlichkeiten im Kampf gegen Geschlechtergewalt. Im dritten Kapitel werden die Hintergründe und Inhalte von Hate Speech gegen Frauen thematisiert, wobei insbesondere die Ergebnisse einer Datenanalyse über Sexismus im Deutschrap betrachtet werden. Kapitel 4 erläutert die Methodik der semiotischen Medienanalyse, die zur Analyse des #UNHATEWOMEN-Videos eingesetzt wird.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit konzentriert sich auf die Themen Hate Speech gegen Frauen, Gender Media Studies, feministische Öffentlichkeiten, semiotische Medienanalyse, Online-Kampagnen, #UNHATEWOMEN, Terre des femmes, Gewalt gegen Frauen, Alltagssexismus und digitale Medien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Kampagne #UNHATEWOMEN?
Die Kampagne von Terre des femmes zielt darauf ab, auf verbale Gewalt, Frauenverachtung und Alltagssexismus in Medien und sozialen Netzwerken aufmerksam zu machen.
Wie wird "Hate Speech" gegen Frauen definiert?
Es umfasst verbale Erniedrigung, brutale Beleidigungen und Diskriminierung, die sich auf das Aussehen, Verhalten oder die gesellschaftliche Rolle von Frauen beziehen.
Welche Rolle spielt Sprache bei Gewalt gegen Frauen?
Frauenverachtende Sprache ist oft der Vorläufer von psychischer und physischer Gewalt und trägt zur Normalisierung von Sexismus bei.
Was untersucht die semiotische Medienanalyse in dieser Arbeit?
Sie analysiert die Zeichen, Symbole und die filmische Gestaltung des Kampagnenvideos, um die Wirkung der Botschaft zu ergründen.
Warum ist feministische Öffentlichkeit online so wichtig?
Digitale Räume ermöglichen es, geschlechtsbezogene Gewalt sichtbar zu machen und politischen Druck für nachhaltige Veränderungen zu erzeugen.
- Citation du texte
- Merle Wendt (Auteur), 2020, Hate Speech gegen Frauen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1195492