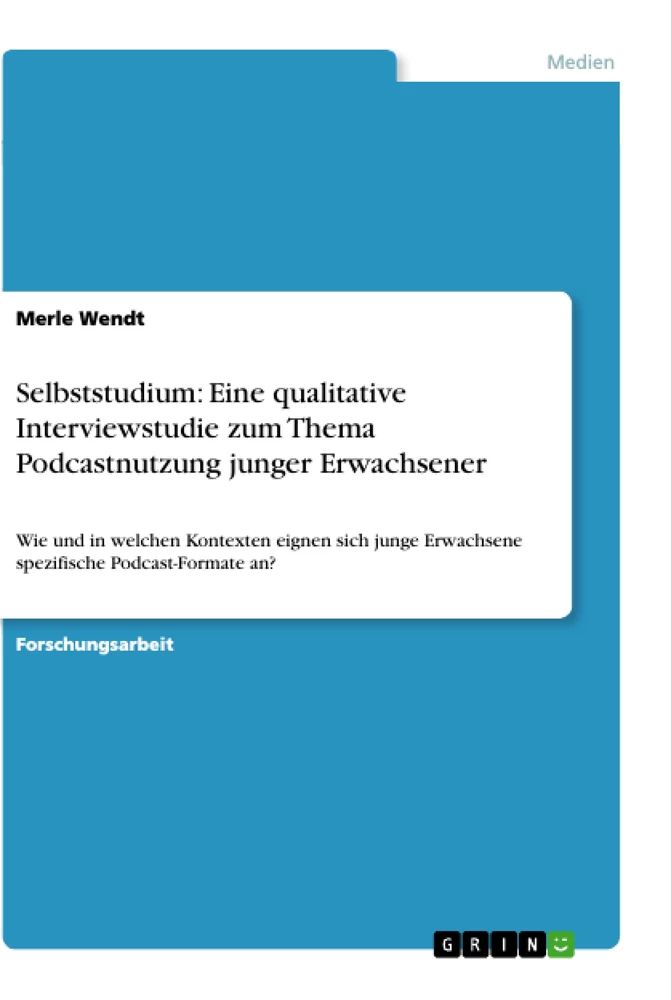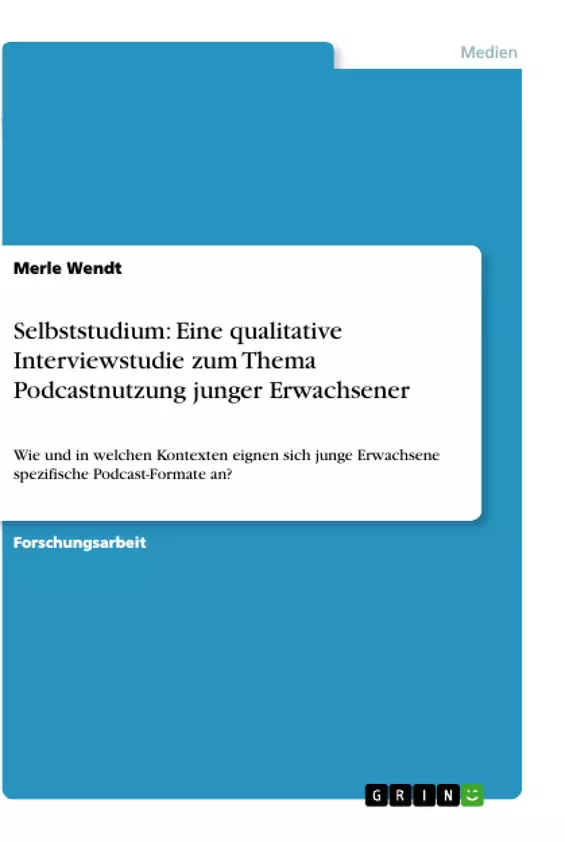Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll die Podcastnutzung junger Erwachsener qualitativ erforscht werden. Trotz der gestiegenen Relevanz von Podcasts ist die Thematik wissenschaftlich bislang unzureichend erforscht. So existieren neben repräsentativen Studien zur Podcastnutzung Studien, die größtenteils auf dem Uses-and-Gratifications-Ansatz basieren und mittels Online-Befragung durchgeführt wurden. Aus diesem Grund ist die qualitative Studie relevant, da sie zu neuen Ergebnissen im Bereich der Mediennutzungs- und Aneignungsforschung beitragen kann. Ziel ist es, herauszufinden, welche Podcastgenres und -formate sich die jungen Erwachsenen in welchen Kontexten aneignen und weshalb sie dies tun. In diesem Zusammenhang soll die Einbettung der Podcasts in ihren Alltag untersucht werden und die Bedeutung spezifischer Medien und -inhalte aus der Perspektive der NutzerInnen betrachtet und interpretiert werden. Anschließend sollen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den jungen Erwachsenen herausgearbeitet werden. Im Verlauf der Arbeit soll die Forschungsfrage „Wie und in welchen Kontexten eignen sich junge Erwachsene spezifische Podcast-Formate an?“ beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Domestizierungsansatz
- 2.1 Domestizierung 2.0 (Hartmann)
- 2.1.1 Dimensionen der Domestizierung
- 3. Podcasts
- 3.1 Podcastnutzung (in Deutschland)
- 3.2 Beliebte Podcastformate und -genres (in Deutschland)
- 3.3 Nutzungssituationen
- 3.4 Nutzungsmotive
- 4. Methodik
- 5. Darstellung der Ergebnisse
- 5.1 Podcastformate und -genres
- 5.2 Nutzungssituation Zuhause
- 5.3 Nutzungssituation Unterwegs
- 5.4 Nutzungsmotiv Unterhaltung
- 5.5 Nutzungsmotiv Mehrwert
- 5.6 Sozialer Kontext
- 5.7 Stimmung
- 5.8 Interaktion
- 6. Analyse der Ergebnisse
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende qualitative Interviewstudie analysiert die Podcastnutzung junger Erwachsener im Kontext ihrer Lebenswelt und zielt darauf ab, zu verstehen, wie und in welchen Situationen sie Podcast-Formate auswählen und in ihren Alltag integrieren.
- Der Domestizierungsansatz 2.0 als theoretischer Rahmen der Studie
- Analyse der Podcastgenres und -formate, die junge Erwachsene bevorzugen
- Nutzungssituationen und -motive im häuslichen und mobilen Kontext
- Die Rolle sozialer und emotionaler Faktoren bei der Podcastnutzung
- Die Bedeutung von Podcasts für die Lebensgestaltung und Identitätsfindung junger Erwachsener
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beleuchtet die Relevanz von Podcasts im Kontext der Mediennutzung junger Erwachsener.
Kapitel 2 stellt den Domestizierungsansatz, den theoretischen Rahmen der Studie, vor und diskutiert seine Weiterentwicklung durch Maren Hartmann.
Kapitel 3 thematisiert Podcasts, ihre Verbreitung und Beliebtheit in Deutschland. Es werden gängige Podcastformate, Nutzungssituationen und -motive beleuchtet.
Kapitel 4 erläutert die Methodik der Studie, insbesondere die leitfadengestützten Einzelinterviews und die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse.
Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Studie, gegliedert in Kategorien wie Podcastformate, Nutzungssituationen, Nutzungsmotive, sozialer Kontext und Stimmung.
Schlüsselwörter
Podcast, Podcastnutzung, junge Erwachsene, Domestizierungsansatz 2.0, qualitative Interviewstudie, Medienaneignung, Lebenswelt, Nutzungssituationen, Nutzungsmotive, sozialer Kontext, Stimmung.
Häufig gestellte Fragen
Warum nutzen junge Erwachsene Podcasts?
Hauptmotive sind Unterhaltung, persönlicher Mehrwert (Information/Bildung) sowie die Möglichkeit, Podcasts flexibel in den Alltag zu integrieren, etwa beim Pendeln oder bei der Hausarbeit.
Was ist der Domestizierungsansatz 2.0?
Dieser theoretische Rahmen untersucht, wie neue Medien (wie Podcasts) in den privaten Alltag und die Lebenswelt der Nutzer "gezähmt" und fest integriert werden.
In welchen Situationen werden Podcasts meistens gehört?
Die Nutzung findet sowohl zu Hause (zur Entspannung) als auch unterwegs (in der Bahn, im Auto oder beim Sport) statt.
Welche Podcast-Genres sind in Deutschland besonders beliebt?
Besonders populär sind Formate aus den Bereichen Comedy, True Crime, Nachrichten und Ratgeber-Themen.
Welche Rolle spielt die Stimmung bei der Podcast-Wahl?
Die Wahl des Podcasts hängt oft von der aktuellen emotionalen Verfassung ab; Nutzer suchen gezielt Inhalte, die ihre Stimmung entweder spiegeln oder verbessern.
- Quote paper
- Master of Arts Merle Wendt (Author), 2021, Selbststudium: Eine qualitative Interviewstudie zum Thema Podcastnutzung junger Erwachsener, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1195493