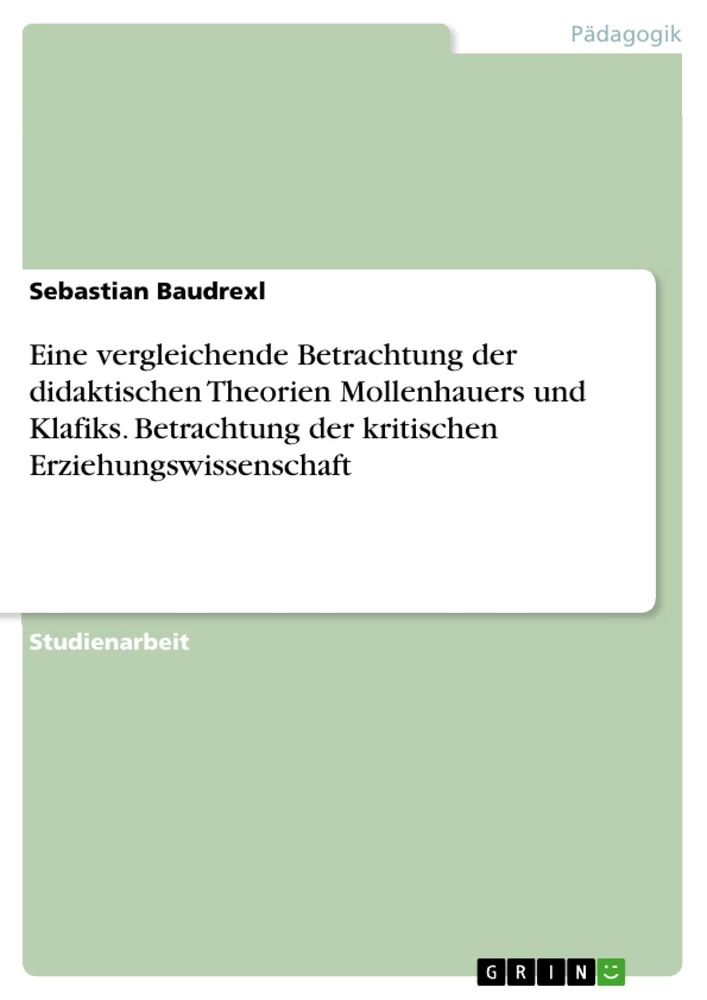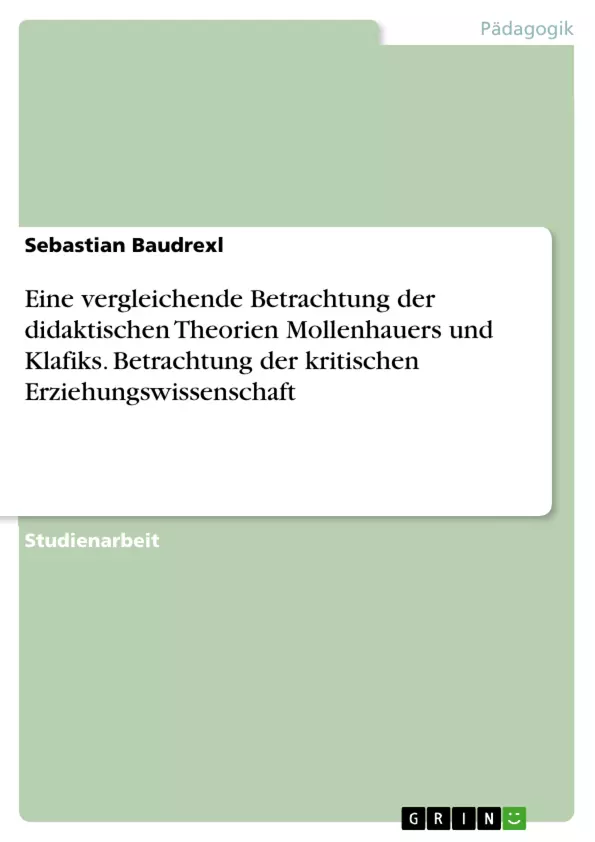Die folgende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie sich der Begriff der Didaktik bei Klafki und Mollenhauer definieren lässt und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sich in einer vergleichenden Betrachtung erkennen lassen. Bevor sich mit den beiden zentralen Theoretikern beschäftigt werden kann, soll ein kurzer Einblick in die kritische Erziehungswissenschaft gegeben werden. Anschließend wird sich dem Didaktik-Begriff von Klafki und Mollenhauer gewidmet. Als Primärliteratur dienen einerseits die Veröffentlichungen „Studien zur Bildungstheorie und Didaktik (1963) und das Nachfolgewerk aus dem Jahr 2007 und andererseits die „Vergessenen Zusammenhänge“ (2008). Aus diesen Werken werden, mithilfe von Sekundärliteratur, die didaktischen Verständnisse der beiden Autoren herausgearbeitet. Abschließend wird ein Vergleich der beiden Theoretiker vollzogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken.
- Kritische Erziehungswissenschaft – Ein Überblick
- Wolfgang Klafki
- Zur Herangehensweise einer Begriffsdefinition der Didaktik Klafkis.
- Biographischer Hintergrund.
- Kritisch-konstruktive Didaktik.
- Gegenstandsbereich und Aufgabenfeld der kritisch-konstruktiven Didaktik.
- Die Didaktische Analyse als Praxisbezug der kritisch-konstruktiven Didaktik Klafkis ...
- Klaus Mollenhauer
- Zur Herangehensweise einer Begriffsdefinition der Didaktik Mollenhauers
- Biographischer Hintergrund...
- Repräsentation als didaktischer Begriff Mollenhauers
- Comenius als Begründer einer Weltordnung.
- Diego Velázquez und die Metapher des Spiegels.
- Die Kindsperspektive Johann Heinrich Pestalozzis.
- Zusammenfassender Begriff der Didaktik Mollenhauers in Vergessene Zusammenhänge
- Vergleichende Darstellung von Mollenhauers und Klafkis Didaktik
- Unterschiede in der Theorie der Didaktik.
- Gemeinsamkeiten in der Theorie der Didaktik.
- Abschließende Gedanken..
- Quellennachweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den didaktischen Theorien von Wolfgang Klafki und Klaus Mollenhauer im Kontext der kritischen Erziehungswissenschaft. Sie analysiert die Definition des Didaktik-Begriffs bei beiden Theoretikern, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Ansätzen herauszuarbeiten. Die Arbeit basiert auf den zentralen Werken beider Autoren und bezieht sich dabei auf Sekundärliteratur, um ein umfassendes Verständnis ihrer didaktischen Konzepte zu ermöglichen.
- Die Definition des Begriffs Didaktik bei Klafki und Mollenhauer
- Die kritisch-konstruktive Didaktik von Wolfgang Klafki
- Die Repräsentationsdidaktik von Klaus Mollenhauer
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Theorie der Didaktik bei Klafki und Mollenhauer
- Die Relevanz beider Theorien für die heutige Bildungspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der kritischen Erziehungswissenschaft und stellt die Bedeutung von Klafki und Mollenhauer in diesem Kontext dar. Anschließend wird die kritisch-konstruktive Didaktik von Wolfgang Klafki behandelt, wobei seine biographischen Einflüsse, seine Definition von Bildung und die wichtigsten Elemente seiner Theorie beleuchtet werden. Der nächste Abschnitt widmet sich der Repräsentationsdidaktik von Klaus Mollenhauer. Hier wird seine Definition des Begriffs Didaktik unter Bezugnahme auf seine biographischen Einflüsse und seine zentrale These der Repräsentation diskutiert.
Im letzten Kapitel werden die beiden Theorien vergleichend dargestellt. Dabei werden die Unterschiede in der Theorie der Didaktik sowie die Gemeinsamkeiten in ihren Ansätzen analysiert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themen der kritischen Erziehungswissenschaft, Didaktik, Bildungstheorie, Repräsentation, Wolfgang Klafki, Klaus Mollenhauer, kritisch-konstruktive Didaktik, Vergleichende Betrachtung, Emanzipation, Demokratisierung, Selbstbestimmung, Gesellschaft und Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die "kritisch-konstruktive Didaktik" von Wolfgang Klafki?
Ein Ansatz, der Bildung als Befähigung zur Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidarität versteht und die didaktische Analyse in den Mittelpunkt stellt.
Was versteht Klaus Mollenhauer unter "Repräsentation"?
Repräsentation bezeichnet die Auswahl und Darstellung von Kulturgütern für die nachfolgende Generation als zentralen Akt der Erziehung.
Welche Gemeinsamkeiten haben Klafki und Mollenhauer?
Beide Theoretiker sind der kritischen Erziehungswissenschaft zuzuordnen und betonen die emanzipatorische Funktion von Bildung.
Was ist die "Didaktische Analyse" nach Klafki?
Ein Verfahren für Lehrer, um den Bildungswert eines Unterrichtsinhalts anhand von Kategorien wie Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung zu prüfen.
Wie beeinflusst die Kindsperspektive Mollenhauers Theorie?
Mollenhauer greift unter anderem auf Pestalozzi zurück, um die Bedeutung der Wahrnehmung und Erfahrungswelt des Kindes in der Didaktik zu unterstreichen.
- Quote paper
- Sebastian Baudrexl (Author), 2021, Eine vergleichende Betrachtung der didaktischen Theorien Mollenhauers und Klafiks. Betrachtung der kritischen Erziehungswissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1195768