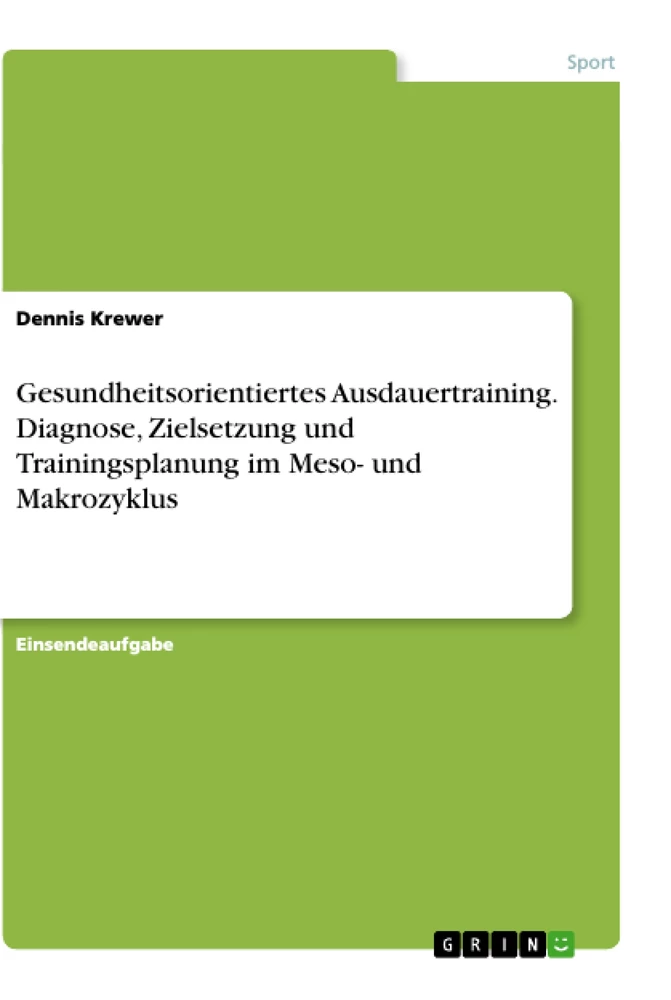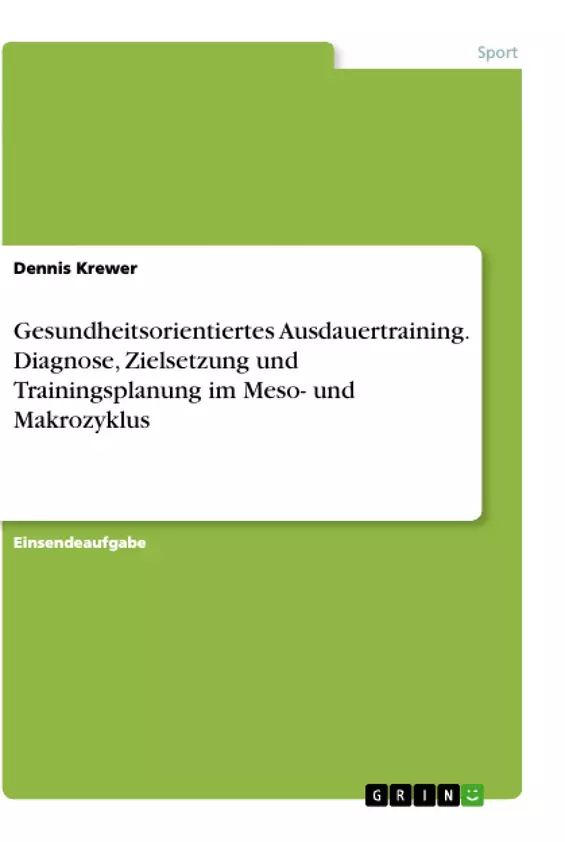Diese Arbeit behandelt das gesundheitsorientierte Ausdauertraining mit einem Fokus auf die Diagnose, Zielsetzung und Planung im Meso- und Makrozyklus.
Inhaltsverzeichnis
- DIAGNOSE
- Allgemeine und biometrische Daten
- Bewertung des Blutdrucks und des Ruhepulses
- Leistungsdiagnostik/Ausdauertestung
- Begründung der Auswahl des Ausdauertests
- Darstellung des Testverlaufs
- Bewertung des Testergebnisses
- Gesundheits- und Leistungsstatus der Person
- ZIELSETZUNG/PROGNOSE
- TRAININGSPLANUNG MESOZYKLUS
- Grobplanung Mesozyklus
- Detailplanung Mesozyklus
- Begründung zum Mesozyklus
- Begründung zum angestrebten wöchentlichen Belastungsumfang
- Begründung zu den ausgewählten Trainingsmethoden
- Begründung zur Belastungsprogression
- Begründung zu den angesteuerten Trainingsbereichen
- Begründung der ausgewählten Ausdauergeräte bzw. Bewegungsformen
- LITERATURRECHERCHE
- Studie 1
- Studie 2
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Dokument befasst sich mit der Erstellung eines individuellen Trainingsplans für eine Person mit dem Ziel, ihre Ausdauerleistungsfähigkeit zu verbessern. Die Arbeit umfasst eine umfassende Diagnose, die Analyse von Blutdruck und Ruhepuls sowie eine Ausdauertestung. Basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen wird ein Trainingsplan für einen Mesozyklus erstellt, der eine detaillierte Begründung für den Belastungsumfang, Trainingsmethoden und -bereiche beinhaltet. Die Arbeit befasst sich zudem mit relevanten Studien und deren Erkenntnissen.
- Individuelle Ausdauerdiagnostik und -testung
- Erstellung eines individuellen Trainingsplans für einen Mesozyklus
- Begründung und wissenschaftliche Fundierung der Trainingsmethoden und -bereiche
- Analyse relevanter Studien und deren Erkenntnisse
- Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Diagnose der Kundin. Hier werden allgemeine und biometrische Daten erhoben und der Blutdruck und Ruhepuls bewertet. Anschließend erfolgt eine Ausdauertestung mit dem WHO-Test. Im zweiten Kapitel werden die Ziele des Trainingsplans definiert und eine Prognose für den Trainingsfortschritt erstellt. Das dritte Kapitel beinhaltet die detaillierte Planung des Mesozyklus, die sowohl eine Grob- als auch eine Detailplanung umfasst. Die ausgewählten Trainingsmethoden, der Belastungsumfang und die Belastungsprogression werden begründet und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen untermauert.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Ausdauertraining, Mesozyklus, Trainingsdiagnostik, WHO-Test, Belastungsumfang, Trainingsmethoden, wissenschaftliche Fundierung, Studienanalyse, individuelle Trainingsplanung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des gesundheitsorientierten Ausdauertrainings?
Das Hauptziel ist die Verbesserung der Ausdauerleistungsfähigkeit zur Förderung der allgemeinen Gesundheit und Prävention von Krankheiten.
Welcher Ausdauertest wird in der Arbeit verwendet?
In der Arbeit wird der WHO-Test (Stufentest auf dem Fahrradergometer) zur Leistungsdiagnostik eingesetzt.
Was beinhaltet die Diagnosephase vor dem Training?
Sie umfasst die Erhebung biometrischer Daten wie Blutdruck und Ruhepuls sowie eine Analyse des aktuellen Gesundheits- und Leistungsstatus.
Wie ist ein Mesozyklus im Trainingsplan aufgebaut?
Ein Mesozyklus umfasst meist mehrere Wochen und beinhaltet eine Grob- sowie Detailplanung der Belastungsumfänge, Intensitäten und Trainingsmethoden.
Warum ist die Belastungsprogression wichtig?
Eine schrittweise Steigerung der Belastung ist notwendig, um kontinuierliche Anpassungsprozesse des Körpers und damit Leistungssteigerungen zu erzielen.
Welche biometrischen Daten sind für die Trainingsplanung relevant?
Besonders der Ruhepuls und der Blutdruck geben wichtige Hinweise auf die Belastbarkeit und den aktuellen Fitnesszustand der Person.
- Quote paper
- Dennis Krewer (Author), 2017, Gesundheitsorientiertes Ausdauertraining. Diagnose, Zielsetzung und Trainingsplanung im Meso- und Makrozyklus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1195902