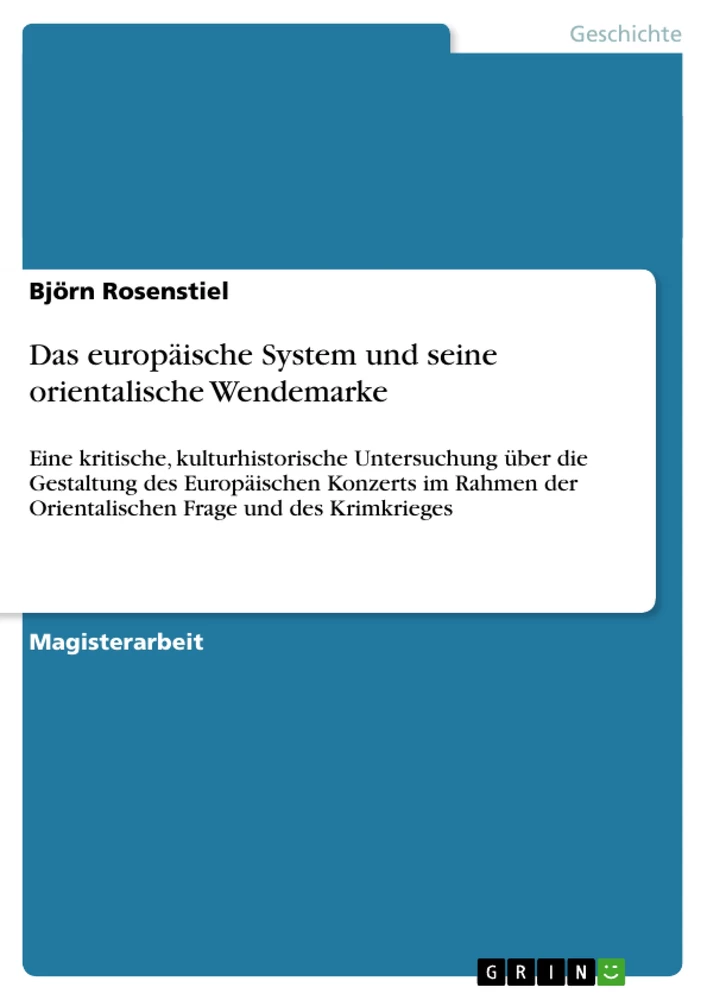Es war ein denkwürdiger Versuch, dass die Großmächte England, Russland, Österreich und Preußen, diese aus der Koalition gegen Napoleon hervorgegangene Allianz, schließlich auch den Verlierer Frankreich beitreten ließen. Dieses seit 1814/15 Gestalt annehmende System, das als „concert européene“ in die Geschichte einging, sollte im Sinne des „principiis obsta“ dazu beitragen, Streitigkeiten so früh wie möglich zu schlichten und Kriege, wenn sie denn ausbrechen sollten, noch im Keim zu ersticken, um so auf das Ökonomischste dem Frieden und Wohlstand zu dienen.
Unter Historikern wie Paul W. Schroeder gilt das Wiener System als ein Meilenstein auf dem Weg zu geregelten internationalen Beziehungen, weshalb in diesem Zusammenhang auch gerne von einer Transformation europäischer Politik resp. einer Weiterentwicklung der politischen Praxis des 18. Jahrhunderts zu neuen Formen der Konfliktbewältigung gesprochen wird. Rückblickend kann gewiss einiges als gelungen angesehen werden, doch die politische Ordnung, die im Jahre 1815 der gesellschaftlichen Realität nur noch leidlich adäquat war, büßte aufgrund der unaufhaltsamen Veränderungen in den Gesellschaften ihre Nützlichkeit immer mehr ein. M.a.W.: Das System verlor zusehends an Wirkkraft.
Doch waren es dabei nicht nur gesellschaftliche, innenpolitische Veränderungen, die auf die Beziehungen der Großmächte und ihr fragiles politisches Gleichgewicht einwirkten. Betrachtet man die in der Zeit zwischen 1830 und 1878 abgehaltenen Konferenzen, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die komplizierte und verworrene Orientalische Frage resp. der osmanische Rückzug aus den eroberten Gebieten und der damit einhergehende Verfall des Osmanischen Reiches die europäische Staatenwelt außerordentlich häufig beschäftigt hat. Ja, sie lag offenbar geradezu im Mittelpunkt der Bemühungen des „Europäischen Konzerts“, den Frieden in Krisen internationalen Ausmaßes zu bewahren. Dabei standen wohl nicht zuletzt Verachtung, Hass und Furcht vor dem Osmanischen Reich hinter dem unwiderstehlichen Drang, sich auf Kosten des osmanischen Staates, der im 19. Jahrhundert zusehends schwächer wurde, zu bereichern.
Dass die nach 1815 währende Friedenszeit durch den Krimkrieg beendet wurde, der als russisch-osmanischer Krieg begann, scheint demnach kein Zufall gewesen zu sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Tour d'horizon - Die Großmächte und das Osmanische Reich (1774-1798)
- 2.1. Vom Abwehrkampf zum Eroberungsfeldzug
- 2.2. Napoleon in Ägypten
- 3. Europäisches Konzert und Orientalisches Gleichgewicht
- 3.1. Die Neuordnung der Staatenwelt nach 1815
- 3.2. Die Orientalische Frage
- 3.2.1. Rückzug, Verfall und Reformen
- 3.2.2. Explosiver Balkan-Nationalismus
- 3.2.3. Das Eingreifen der Großmächte
- 3.3. Die doppelte Nahostkrise (1831-1841)
- 4. Der Krimkrieg (1853-1856) – Die Wasserscheide des Konzerts
- 4.1. Diplomatischer Auftakt 1841-1853
- 4.1.1. Kranker Mann am Bosporus
- 4.1.2. Leiningen- und Menshikov-Mission
- 4.1.3. Die Wiener Note vom Juli 1853
- 4.2. Diplomatie und Krieg
- 4.2.1. Vom russisch-osmanischen Krieg
- 4.2.2. zum Krimkrieg
- 4.3. Kriegsziele und Frieden
- 4.3.1. Wiener Konferenz 1855
- 4.3.2. Der Pariser Frieden 1856
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht kritisch und kulturhistorisch die Gestaltung des Europäischen Konzerts im Kontext der Orientalischen Frage und des Krimkriegs. Sie analysiert, inwieweit der Krimkrieg eine Zäsur für das europäische System darstellte und ob das Konzert der europäischen Mächte der Komplexität internationaler Politik gerecht werden konnte.
- Das Europäische Konzert nach dem Wiener Kongress
- Die Orientalische Frage und ihre Auswirkungen auf das europäische Gleichgewicht
- Der Krimkrieg als Höhepunkt der Orientalischen Frage
- Die Rolle der Großmächte (England, Russland, Österreich, Preußen, Frankreich)
- Analyse der diplomatischen und militärischen Entwicklungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung stellt das europäische System nach dem Wiener Kongress vor und argumentiert, dass dessen Wirkkraft durch gesellschaftliche Veränderungen und die Orientalische Frage geschwächt wurde. Der Krimkrieg wird als Höhepunkt der Orientalischen Frage und möglicher Wendepunkt des Systems präsentiert.
Kapitel 2 (Tour d'horizon): Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Beziehungen der Großmächte zum Osmanischen Reich im 18. Jahrhundert, von Abwehrkämpfen bis hin zu Eroberungsfeldzügen, unter besonderer Berücksichtigung des russisch-türkischen Krieges von 1768-1774 und des Vertrags von Küçük Kainardşe.
Kapitel 3 (Europäisches Konzert): Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung des Europäischen Konzerts nach 1815 nach, erläutert die Orientalische Frage in ihren verschiedenen Phasen und beleuchtet die doppelte Nahostkrise von 1831-1841 als Beispiel für die Regulationsfunktion des Systems.
Kapitel 4 (Der Krimkrieg): Dieser Abschnitt beschreibt den diplomatischen Auftakt zum Krimkrieg, die Kriegshandlungen und die Friedensverhandlungen. Der Fokus liegt auf der Analyse der Auswirkungen des Krieges auf das europäische System.
Schlüsselwörter
Europäisches Konzert, Orientalische Frage, Krimkrieg, Großmächte, Osmanisches Reich, internationales Gleichgewicht, Diplomatie, Imperialismus, Wiener Kongress, Küçük Kainardşe Vertrag.
Häufig gestellte Fragen
Was war das "Europäische Konzert" des 19. Jahrhunderts?
Es war ein diplomatisches System der Großmächte (England, Russland, Österreich, Preußen, Frankreich) nach 1815, um Konflikte frühzeitig zu schlichten und das politische Gleichgewicht in Europa zu wahren.
Was versteht man unter der "Orientalischen Frage"?
Die Orientalische Frage bezeichnete das politische Problem des Verfalls des Osmanischen Reiches und das Ringen der europäischen Großmächte um Einfluss auf dessen Gebiete.
Warum gilt der Krimkrieg (1853–1856) als Wendepunkt?
Der Krimkrieg beendete die lange Friedensperiode nach 1815 und zerstörte die Solidarität der Großmächte, was zum Scheitern des bisherigen "Europäischen Konzerts" führte.
Welche Rolle spielte der Nationalismus auf dem Balkan?
Der aufkommende Nationalismus in den osmanischen Provinzen führte zu Instabilität und bot den Großmächten Vorwände für Interventionen, was das europäische Gleichgewicht gefährdete.
Was wurde im Pariser Frieden von 1856 festgelegt?
Der Vertrag sicherte die Integrität des Osmanischen Reiches zu, neutralisierte das Schwarze Meer und markierte das vorläufige Ende der russischen Expansion im Nahen Osten.
- Citation du texte
- Magister Artium Björn Rosenstiel (Auteur), 2006, Das europäische System und seine orientalische Wendemarke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119598