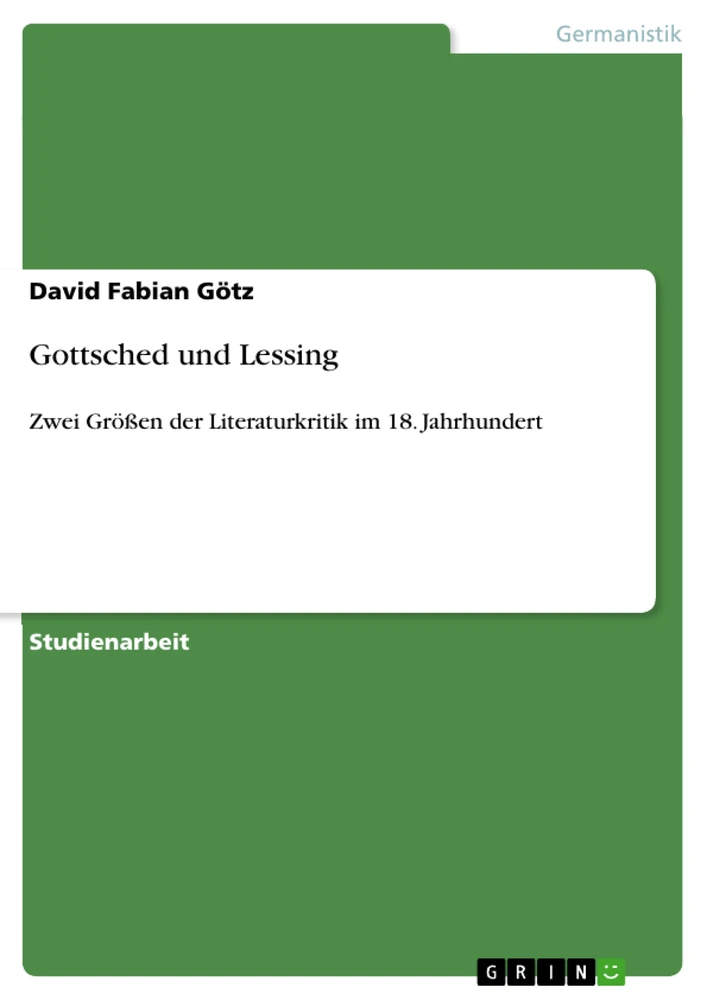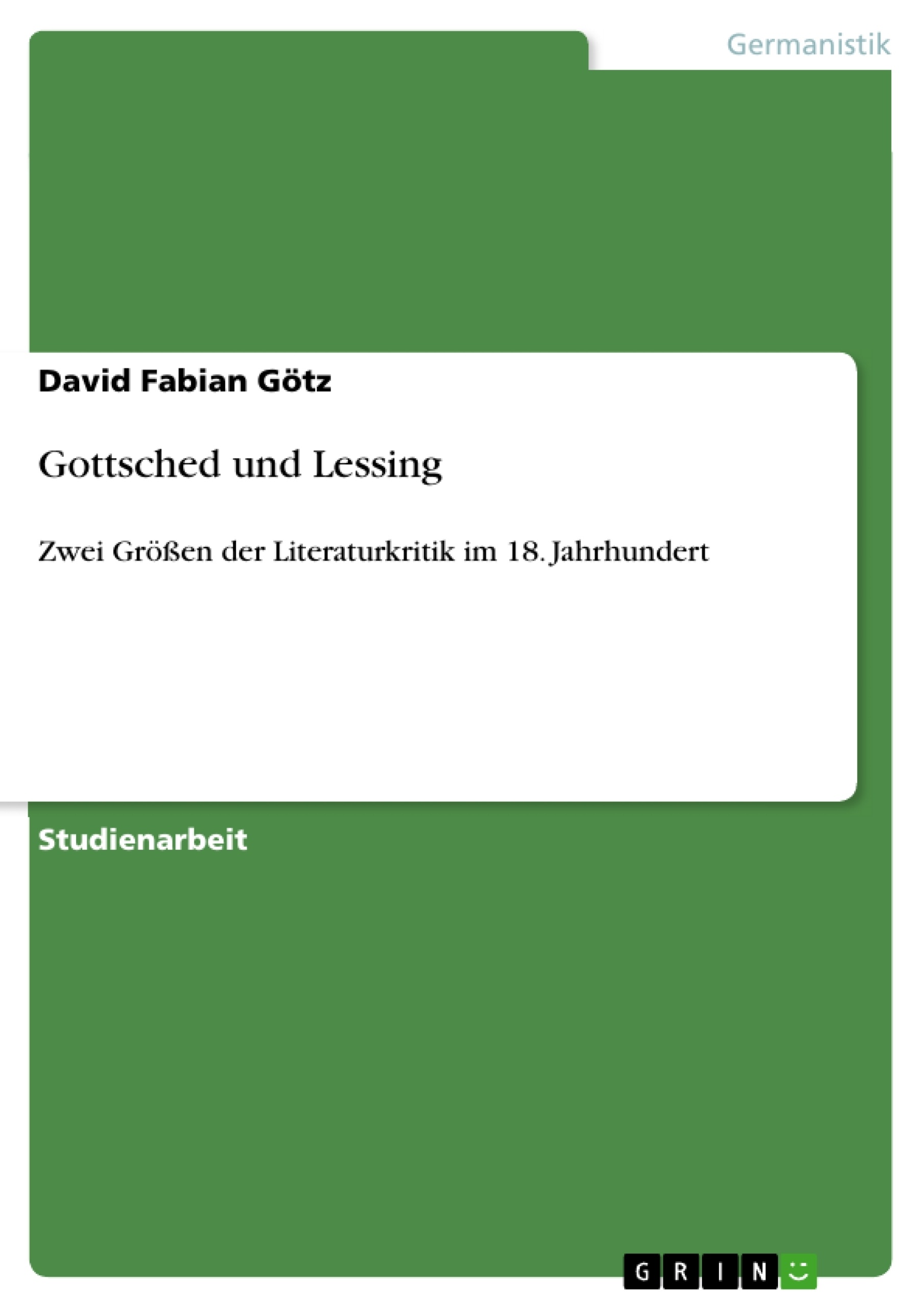Noch heute gilt teilweise das Bild, welches Lessing der Nachwelt vom Kunstrichter Gottsched hinterlassen hat, wenngleich die neuere Forschung beginnt den Weg zu einer gerechteren Beurteilung Gottscheds zu beschreiten. Der Beschäftigung mit Gottsched haftete bis ins 20. Jahrhundert sogar ein schaler Beigeschmack an1. Der Todesstoß, den Lessing gegen Gottsched in seinem viel zitierten 17. Literaturbrief führte, ist bis heute – trotz einiger Bestrebungen – nicht ausreichend revidiert worden. Zu einer Rettung Gottscheds ist es noch ein weiter Weg.
Zweifelsohne kann man Gotthold Ephraim Lessing als eine – wenn nicht sogar die – Größe der Literaturkritik im 18. Jahrhundert charakterisieren. Gottsched als eine solche zu bezeichnen bedarf wohl einiger Rechtfertigung. Beide Kritiker unterscheiden sich nicht zuletzt durch die Sprache, die jeweils gewählten Medien und die Methodik ihrer Kritik. Die sprachliche Brillianz, mit welcher Lessing seine Gegner oftmals mundtot machte, ist wohl gerade keine Beschreibung von Gottscheds Kritik. Gottsched legte vielmehr Wert auf ein System der Kritik. Während Lessing in Briefform und mit verschiedenen Rezensionen die jeweiligen Gegner seiner Kritik unterzog, unternahm Gottsched – ganz im Geiste Opitz' – den Versuch, ein System der verschiedenen Gattungen zu verfertigen und dadurch Kritik zu betreiben. Bereits im Ansatz der Kritiken wird deutlich, dass die ohnehin vorhandene Schwierigkeit eines Vergleichs beider Kritiker sowohl durch die Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Generationen als auch durch den Unterschied der Definition „Kritik“ gemehrt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Kunstrichterfehde zwischen Leipzig und Zürich
- Lessings Anfänge als Kritiker
- Lessings Position im Literaturbetrieb
- Kritik an Gottsched und Bodmer
- Ein Vade mecum
- England versus Frankreich. Oder: Der Tod eines Kunstrichters
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Verhältnis von Gottsched und Lessing als zwei bedeutende Figuren der deutschen Literaturkritik des 18. Jahrhunderts. Ziel ist es, ihre unterschiedlichen Positionen und Methoden im Kontext der Kunstrichterfehde und der Entwicklung der deutschen Literatur zu beleuchten.
- Der Einfluss von Gottsched und Lessing auf den deutschen Literaturbetrieb
- Die Kontroverse zwischen Leipzig und Zürich im 18. Jahrhundert
- Die Entwicklung der Literaturkritik von Gottsched zu Lessing
- Die Rezeption von Gottscheds Werk und die Frage seiner Würdigung
- Die Rolle von Vernunft und Phantasie in der Literaturkritik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung präsentiert die beiden zentralen Figuren der Arbeit, Gottsched und Lessing, sowie deren Bedeutung für die Literaturkritik des 18. Jahrhunderts. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Ansätze beider Kritiker, wobei Gottsched Wert auf ein systematisches Vorgehen legte, während Lessing eine eher polemische und scharfe Kritik pflegte.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Kunstrichterstreit zwischen Gottsched und den Schweizer Kritikern. Die Arbeit stellt heraus, dass Lessing in dieser Kontroverse eine unabhängige Position einnahm und sich keiner der beiden Parteien anschloss.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit Lessings Anfängen als Kritiker. Es analysiert seine Position im Literaturbetrieb und beleuchtet seine Kritik an Gottsched und Bodmer. Die Arbeit zeigt, dass Lessing sich als unabhängiger Denker profilierte und sich nicht dem dogmatischen Denken der Zeit anschloss.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen deutscher Literaturkritik, Kunstrichterstreit, Gottsched, Lessing, Vernunft, Phantasie, Nachahmung der Natur, Systematik, Polemik, und Literaturbetrieb.
- Quote paper
- David Fabian Götz (Author), 2008, Gottsched und Lessing, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119600