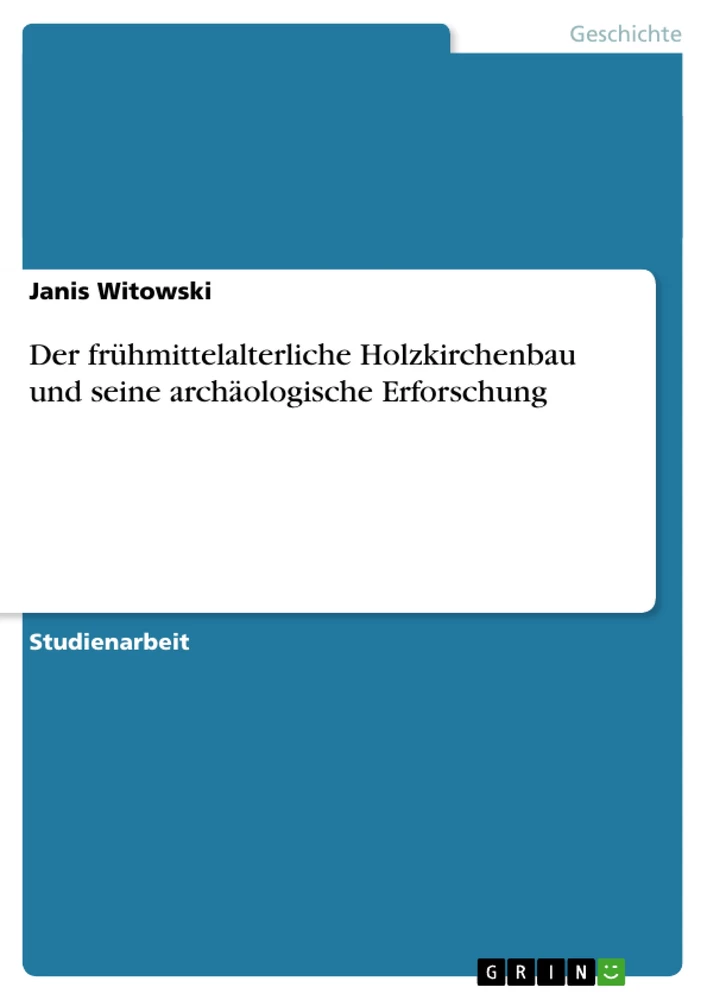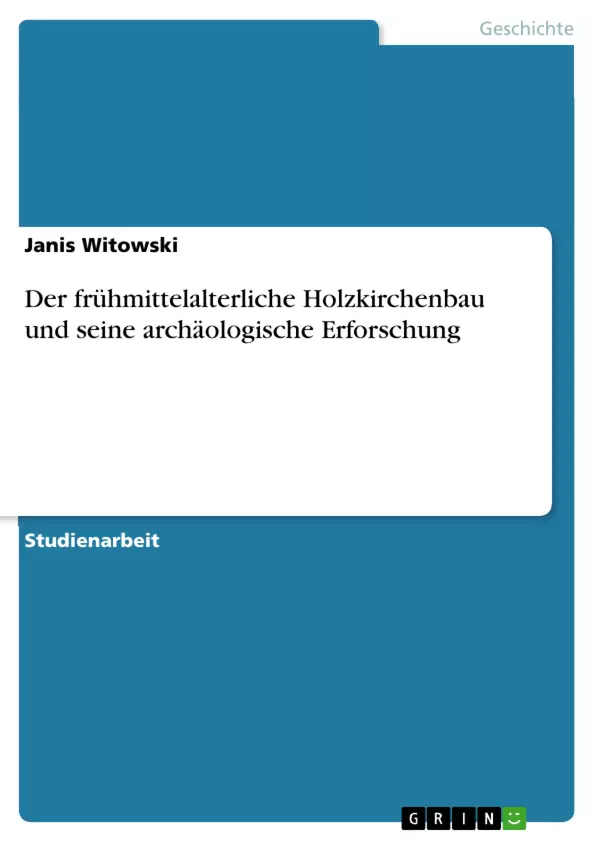Im 21. Jahrhundert erscheint das Mittelalter als eine weit entfernte, fremde Epoche. Dennoch stößt
man auf Urlaubsreisen oder Städtetouren sehr häufig auf die architektonischen Spuren einer Zeit,
die auf die meisten Menschen der Gegenwart grausam, unkultiviert und dunkel wirkt.
Ganz im Gegensatz dazu würdigten die Romantiker des 19. Jahrhunderts mittelalterliche
Burgruinen als Symbole einer verwunschenen, idealen Vergangenheit, bestaunt täglich eine Vielzahl
von Touristen die gewaltigen Dome in Mainz, Köln oder Speyer. Insbesondere die Sakralbauten
beeindrucken den Betrachter als Denkmäler mittelalterlicher Baukunst und Prachtempfindung.
Obgleich die Bauwerke in späteren Jahrhunderten meist umgebaut oder restauriert worden sind,
bildet das Baumaterial den uneingeschränkten Garant für deren Langlebigkeit. Stein erwies sich als
überaus haltbar und witterungsbeständig und ermöglichte damit eine intensive Erforschung der
Gebäude durch Architekten, Archäologen und Kunsthistorikern.
Lange Zeit jedoch vernachlässigte man darüber hinaus einen Bereich der Kirchenbauforschung, der
in Mittel- und Nordeuropa das sakrale Bauwesen des Frühmittelalters wesentlich bestimmte: Die
Holzkirchen wurden -nach bescheidenen Anfängen in Skandinavien- erst im vorigen Jahrhundert in
die historische und archäologische Betrachtung miteinbezogen. Durch intensive Grabungen ist
diesem Manko abgeholfen worden. Obwohl selten ein mittelalterlicher Holzkirchenbau die Zeiten
überdauert hat und die Fundlage oft nur Vermutungen zu lässt, ist der Forschung die Bedeutung und
der Erkenntnisgehalt solcher Bauwerke bewusst geworden.
Die vorliegende Arbeit rückt die archäologische Betrachtung der Holzkirchenbauten in den
Vordergrund. Basierend auf dem umfangreichen Werk Claus Ahrens’ Die frühen Holzkirchen
Europas soll versucht werden, einen kurzen Abriss zu wesentlichen Forschungsbereichen zu geben.
Den Schwerpunkt bildet hierbei zum einen die allgemeine Charakteristik der Bautypen, zum
anderen der archäologische Umgang mit den Befunden und die Deutung der selben.
Die zu behandelnden Beispiele stammen meist aus England, Skandinavien und Nord- und
Süddeutschland. Eine geographische Einschränkung auf die oben genannten Regionen erwies sich
als unabdingbar, da die Ausführungen den vorgegebenen Rahmen dieser Arbeit von acht Seiten
zweifellos gesprengt hätten.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Missionen des frühen Mittelalters als Bedingung für den Holzkirchenbau in Mittel- und Nordeuropa
- Die mittelalterliche Holzkirche als Gegenstand der archäologischen Untersuchung
- Forschungsgeschichte
- Grabungsbefunde als archäologische Quelle
- Typische Bauarten mittelalterlicher Holzkirchen
- Die Funktion der frühmittelalterlichen Holzkirchen
- Aus Holz wird Stein - Die Holzkirche im hohen und späten Mittelalter
- Nachwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die archäologische Erforschung frühmittelalterlicher Holzkirchenbauten in Mittel- und Nordeuropa. Sie konzentriert sich auf die Charakteristik der Bautypen und den archäologischen Umgang mit den Funden. Der Fokus liegt auf Beispielen aus England, Skandinavien und Nord- und Süddeutschland.
- Der Zusammenhang zwischen der Christianisierung und dem Holzkirchenbau.
- Die Forschungsgeschichte der archäologischen Untersuchung von Holzkirchen.
- Typische Bauarten und Funktionen frühmittelalterlicher Holzkirchen.
- Die Rolle des Holzes als Baumaterial im Kontext der verfügbaren Ressourcen.
- Der Übergang vom Holz- zum Steinbau im späteren Mittelalter.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort gibt einen Überblick über die Bedeutung der archäologischen Erforschung von Holzkirchen im Frühmittelalter. Das zweite Kapitel behandelt den Zusammenhang zwischen der Christianisierung Mittel- und Nordeuropas und dem Bau von Holzkirchen, betont die Rolle der fränkischen und iro-fränkischen Missionierung und die Bedeutung des leicht verfügbaren Baumaterials. Kapitel drei beleuchtet die Forschungsgeschichte der Holzkirchenarchäologie, beginnend mit frühen Funden und deren Interpretation, und geht auf die Bedeutung von Grabungsbefunden ein.
Schlüsselwörter
Frühmittelalter, Holzkirchenbau, Archäologie, Christianisierung, Missionierung, Grabungsbefunde, Bautypen, Holz als Baumaterial, Skandinavien, England, Deutschland.
- Citar trabajo
- Janis Witowski (Autor), 2008, Der frühmittelalterliche Holzkirchenbau und seine archäologische Erforschung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119684