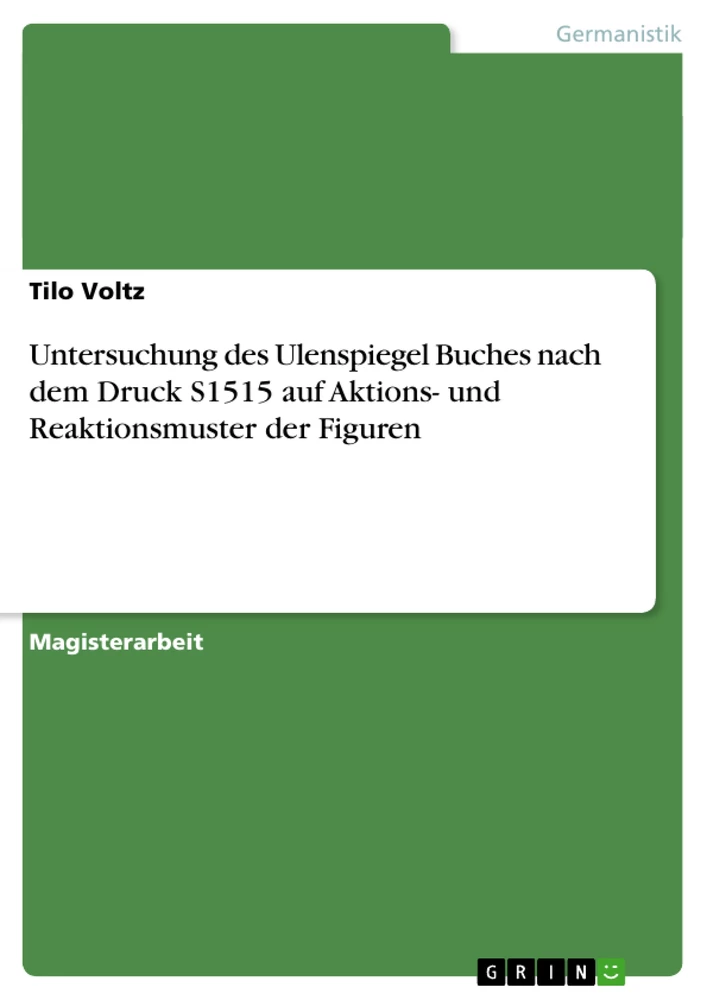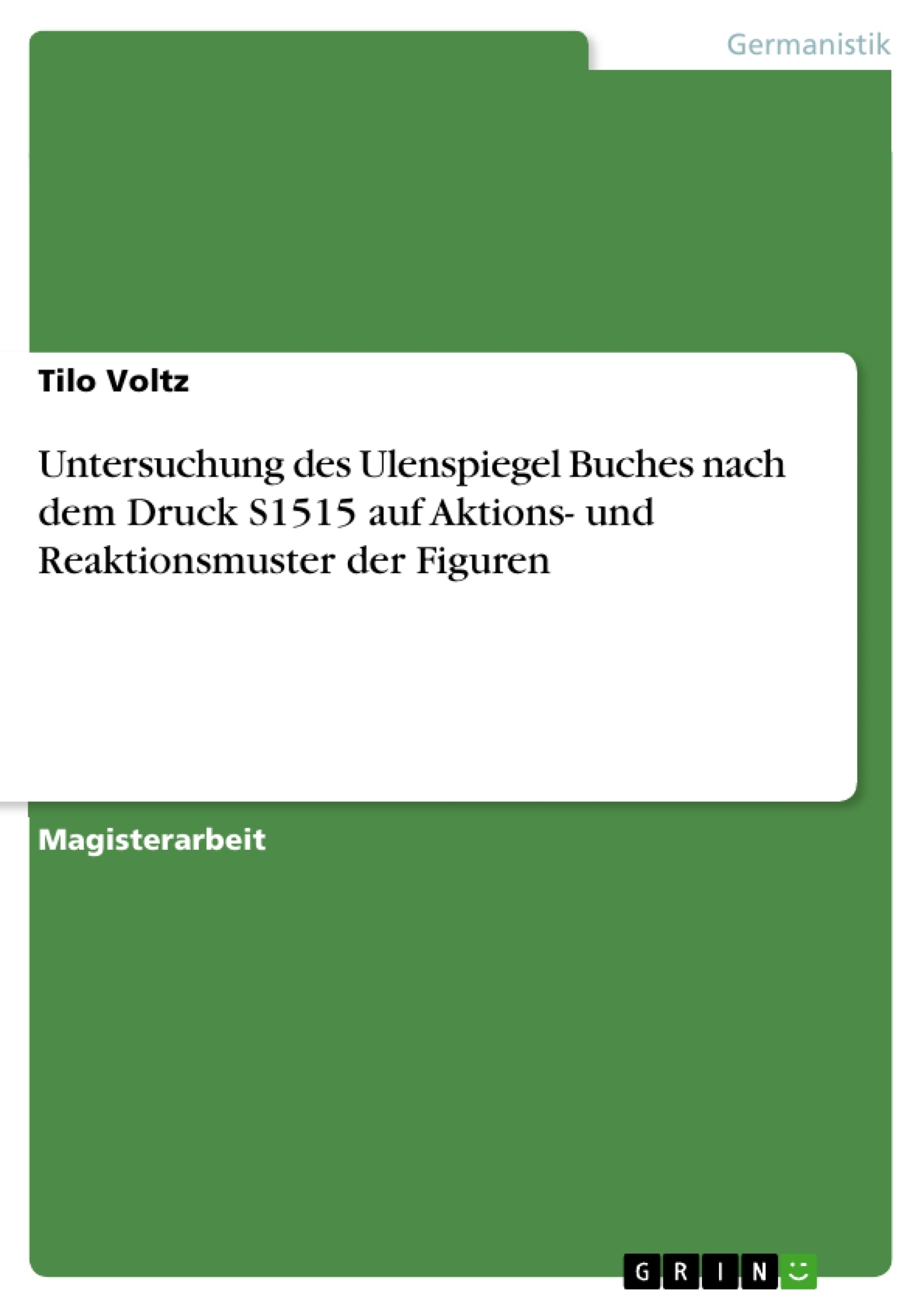Till Eulenspiegel ist jedem Deutschen bekannt. Als listiger Schalk geistert er seit Generationen durch die deutsche Literatur. Doch das Original und dessen Verhaltensweise in den ersten Ausgaben des Ulenspiegel-Buches ähneln kaum dem listigen Schalk, von dem die Eltern ihren Kindern heute vorlesen. Seit ihrer Entstehung in der frühen Neuzeit durchliefen das Buch und dessen Titelheld zahlreiche bildhafte und poetische Metamorphosen1. Am Ende wurden beide zu dem Kinder- und Lesebuch, von dem jeder schon einmal gehört hat. Über die Jahrhunderte hinweg wurde die Figur Eulenspiegel auf unterschiedlichste Weise interpretiert. Auflistungen der zahlreichen teilweise widersprüchlichen Deutungen sind mittlerweile zu einem Topos wissenschaftlicher Abhandlungen zum Ulenspiegel geworden. Dem entgegen sei an dieser Stelle darauf verzichtet und auf Untersuchungen von Bollenbeck, Petzold, Röcke und zahlreichen Anderen verwiesen. Trotz seiner vermeintlichen Mehrdeutigkeit ist es der Narr Till Eulenspiegel, der die Geschichten des Buches miteinander verknüpft. Als agierende Figur ist er in allen 95 Historien der frühesten Drucke vertreten, welche in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstanden. Seine Biografie bildet den Rahmen der Schwankreihung. Kaum verwundert es daher, dass die Bemühungen der Forschung sich bisher auf eine Interpretation der Titelfigur konzentrierten. Doch was geschieht, wenn man den Fokus nicht auf den Schwankhelden legt?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielstellung
- Aufbau der Arbeit
- Begriffsklärung, Thesenfindung und Vorgehensweise
- Begriffsklärungen
- Allgemein
- Schwankobjekte
- Handlung der Figuren - Aktion der Figuren
- Aktionsmuster – Erkenntnisfähigkeit – Reaktionsmuster
- Historien - Lehrhaftigkeit
- Schwank
- Schwankroman
- Quellen
- Ur-Ulenspiegel
- Straßburger Druck 1510/11
- Straßburger Druck 1515
- Straßburger Druck 1519
- Fazit
- Thesenfindung
- Autorwerk
- Schriftliche Fixierung einer mündlichen Tradition
- Autorbegriff
- These der vorliegenden Arbeit
- Vorgehensweise
- Fünf Analysekategorien
- Beispiel einer Historienanalyse
- Die Schwankobjekte im Ulenspiegelbuch
- Gliederung
- Fürsten / Adelige
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit Adelige
- Exkurs: Habgier
- städtische Obrigkeit
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit städtische Obrigkeit
- Exkurs: Unvorsichtigkeit
- Gelehrte
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit Gelehrte
- Exkurs: Hochmut
- Händler / Kaufleute
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit Händler / Kaufleute
- Exkurs: Einfalt
- Handwerker
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit Handwerker
- Exkurs: Torheit
- Wirte
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit Wirte
- Exkurs: korrektes Verhalten bei Überlistung
- Gehilfen / Bedienstete
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit Gehilfen
- Bauern
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit Bauern
- Pfaffen
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit Pfaffen
- Frauen
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit Frauen
- 'Krüppel'
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit 'Krüppel'
- Menge
- Gruppierung der Schwankobjekte
- Direkte Opfer
- Mittel zum Zweck
- Auftraggeber
- Fazit Menge
- Ergebnisse
- Aktionsmuster
- Erkenntnisfähigkeit
- Reaktionsmuster
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht den Straßburger Druck des Ulenspiegelbuches von 1515, indem sie die Aktions- und Reaktionsmuster der Figuren analysiert. Ziel ist es, ein tiefergehendes Verständnis der Figuren und ihrer Interaktionen im Kontext des Schwanks zu gewinnen.
- Analyse der Aktionsmuster der Figuren im Ulenspiegelbuch (1515).
- Untersuchung der Reaktionen der jeweiligen Opfer auf Till Eulenspiegels Aktionen.
- Klassifizierung der Figuren nach sozialen Gruppen und deren Rolle im Erzählkontext.
- Erarbeitung von typischen Handlungsmustern und deren Wiederkehr.
- Beurteilung des Werkes im Kontext der mündlichen Tradition und des Autorbegriffs der damaligen Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die Zielsetzung der Arbeit, die auf der Analyse der Aktions- und Reaktionsmuster der Figuren im Straßburger Druck des Ulenspiegelbuches von 1515 basiert. Sie beschreibt den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über die methodischen Vorgehensweisen. Der Fokus liegt auf der Erforschung der Interaktionen der Figuren und der damit verbundenen gesellschaftlichen und literarischen Kontexte.
Begriffsklärung, Thesenfindung und Vorgehensweise: Dieses Kapitel legt die methodischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden zentrale Begriffe wie "Schwank", "Schwankroman", "Aktion", "Reaktion" und "Historien" definiert und im Kontext des Ulenspiegelbuches erläutert. Die zentralen Thesen werden formuliert, insbesondere die These bezüglich des Ulenspiegelbuches als schriftliche Fixierung einer mündlichen Tradition. Die Vorgehensweise wird detailliert beschrieben, einschließlich der fünf Analysekategorien, die zur Untersuchung der Figuren und ihrer Interaktionen verwendet werden.
Die Schwankobjekte im Ulenspiegelbuch: Dieser umfangreiche Kapitel analysiert die verschiedenen Gruppen von Figuren im Ulenspiegelbuch, die als Opfer von Till Eulenspiegels Streichen dienen. Es werden systematisch Fürsten/Adelige, städtische Obrigkeit, Gelehrte, Händler/Kaufleute, Handwerker, Wirte, Gehilfen/Bedienstete, Bauern, Pfaffen, Frauen, „Krüppel“ und die „Menge“ untersucht. Für jede Gruppe werden die Gruppierungen der Schwankobjekte, die direkten Opfer, die als Mittel zum Zweck verwendeten Figuren, die Auftraggeber und ein Fazit beschrieben. Zusätzlich werden Exkurse zu den wiederkehrenden Motiven wie Habgier, Unvorsichtigkeit, Hochmut, Einfalt und Torheit eingefügt.
Schlüsselwörter
Till Eulenspiegel, Ulenspiegelbuch, Straßburger Druck 1515, Aktionsmuster, Reaktionsmuster, Schwank, Schwankroman, Figurencharakterisierung, soziale Gruppen, mündliche Tradition, Autorbegriff, literaturwissenschaftliche Analyse.
Häufig gestellte Fragen zum Ulenspiegelbuch (Magisterarbeit)
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert den Straßburger Druck des Ulenspiegelbuches von 1515. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der Aktions- und Reaktionsmuster der Figuren, um ein tiefergehendes Verständnis ihrer Interaktionen im Kontext des Schwanks zu gewinnen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Aktionsmuster der Figuren im Ulenspiegelbuch (1515) zu analysieren, die Reaktionen der Opfer auf Till Eulenspiegels Aktionen zu untersuchen, Figuren nach sozialen Gruppen zu klassifizieren und typische Handlungsmuster zu erarbeiten. Zusätzlich wird das Werk im Kontext der mündlichen Tradition und des damaligen Autorbegriffs betrachtet.
Welche Methoden werden in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet fünf Analysekategorien zur Untersuchung der Figuren und ihrer Interaktionen. Zentrale Begriffe wie "Schwank", "Schwankroman", "Aktion", "Reaktion" und "Historien" werden definiert und im Kontext des Ulenspiegelbuches erläutert. Die Analyse basiert auf dem Straßburger Druck von 1515.
Welche Figuren werden analysiert?
Die Arbeit analysiert systematisch verschiedene Gruppen von Figuren im Ulenspiegelbuch, die als Opfer von Till Eulenspiegels Streichen dienen. Dies umfasst Fürsten/Adelige, städtische Obrigkeit, Gelehrte, Händler/Kaufleute, Handwerker, Wirte, Gehilfen/Bedienstete, Bauern, Pfaffen, Frauen, „Krüppel“ und die „Menge“. Für jede Gruppe werden Gruppierungen der Schwankobjekte, direkte Opfer, Mittel zum Zweck, Auftraggeber und ein Fazit beschrieben. Zusätzliche Exkurse beleuchten wiederkehrende Motive wie Habgier, Unvorsichtigkeit, Hochmut, Einfalt und Torheit.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse zu den Aktionsmustern, der Erkenntnisfähigkeit und den Reaktionsmustern der Figuren. Ein abschließendes Fazit fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Begriffsklärung, Thesenfindung und Vorgehensweise, ein umfangreiches Kapitel zur Analyse der Schwankobjekte im Ulenspiegelbuch und abschließende Ergebnisse. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die Struktur.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Till Eulenspiegel, Ulenspiegelbuch, Straßburger Druck 1515, Aktionsmuster, Reaktionsmuster, Schwank, Schwankroman, Figurencharakterisierung, soziale Gruppen, mündliche Tradition, Autorbegriff, literaturwissenschaftliche Analyse.
Auf welchen Quellen basiert die Arbeit?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Straßburger Drucke des Ulenspiegelbuches (1510/11, 1515, 1519) und den "Ur-Ulenspiegel".
Welche These wird in der Arbeit vertreten?
Eine zentrale These der Arbeit ist die Betrachtung des Ulenspiegelbuches als schriftliche Fixierung einer mündlichen Tradition.
- Citar trabajo
- Tilo Voltz (Autor), 2007, Untersuchung des Ulenspiegel Buches nach dem Druck S1515 auf Aktions- und Reaktionsmuster der Figuren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119705