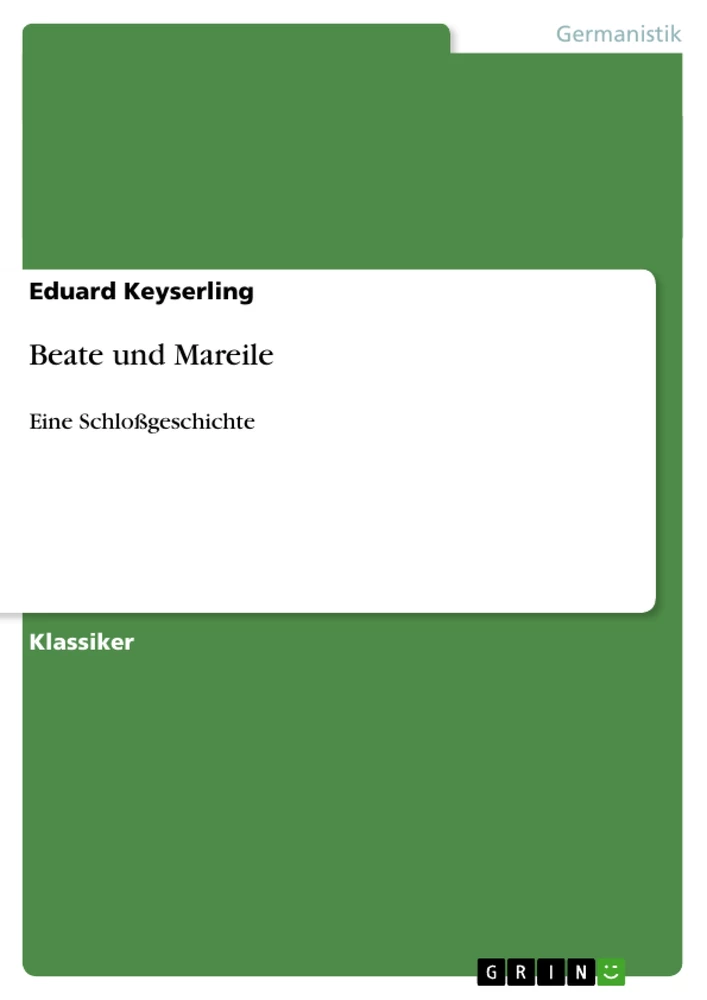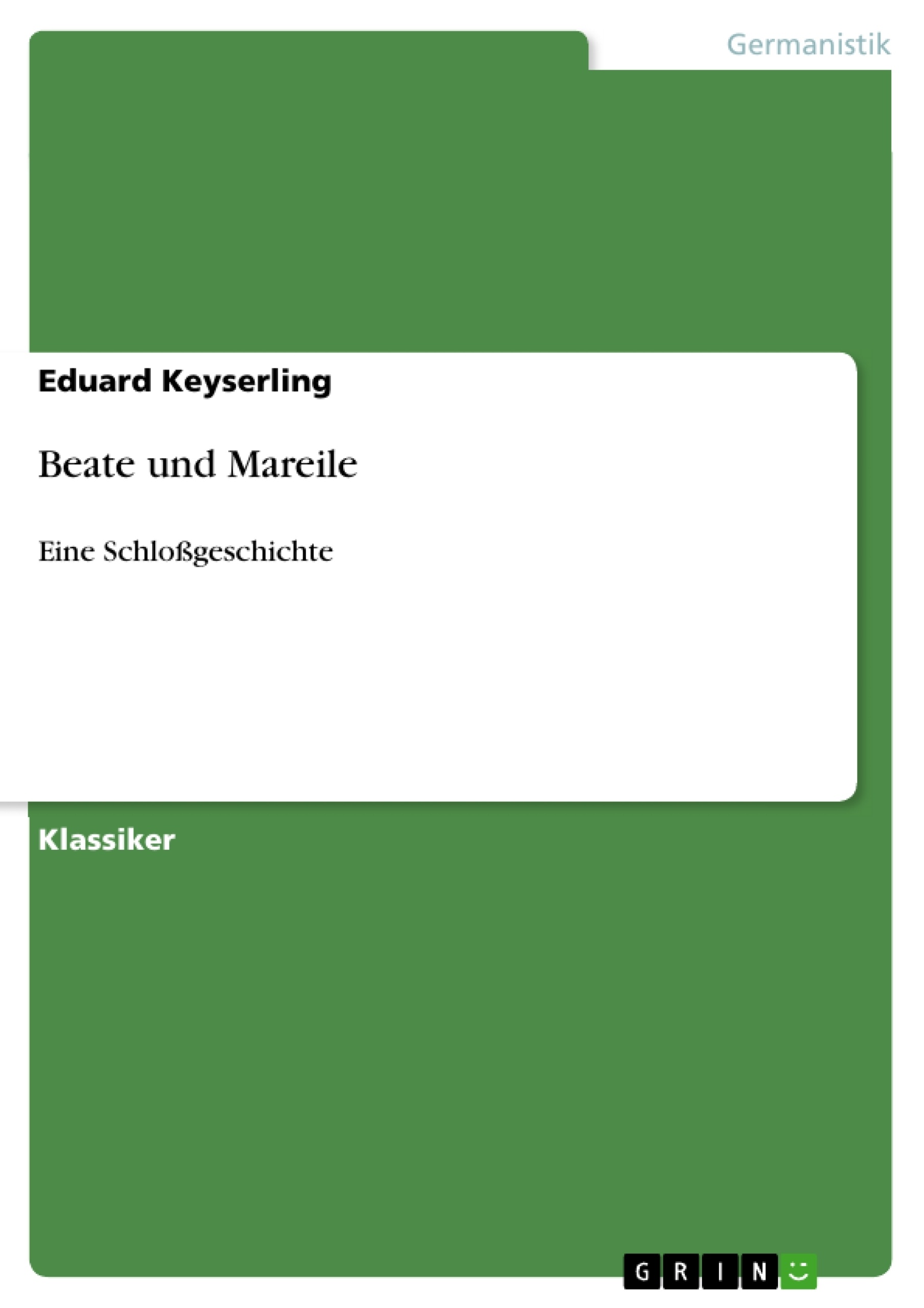Aus dem Badezimmer erscholl ein gleichmäßiges Plätschern. Günther von Tarniff saß in seinem rotgelben Badebassin. Die lauwarme Dusche wurde in der Morgensonne ganz blank – fließendes Kristall. Das war so hübsch und angenehm, daß Günther sich nicht davon trennen konnte. Er saß da schon geraume Zeit und registrierte die behaglichen Empfindungen, die über seinen Körper hinglitten … wachsam und aufmerksam, wie er jedes angenehme Gefühl in sich zu verfolgen pflegte, als müßte aus dieser Addition sich ein Glück herausrechnen lassen.
»Ziehen Herr Graf die neuen Weißen an?« fragte Peter aus dem Nebenzimmer.
»Ja. Gefallen sie dir nicht?« rief Günther zurück.
»'ne neue Mode. Wird man sehen,« meinte Peter.
Nun mußte Günther heraus. Peter rieb ihn behutsam mit einem weichen Tuch ab. Günther pflegte seinen Körper wie ein Brahmane. Er bewunderte ihn und achtete ihn, als die Tafel, auf der das Leben viele, wichtige Genüsse zu verzeichnen hat.
»Frau Gräfin waren schon auf, bei der Morgenandacht,« berichtete Peter. »Ja, bei den alten Herrschaften im Flügel ist Morgenandacht mit den Leuten vom Alten Testament, wie die Amalie sagt.«
»Teufel. Dann sind wir hier das Neue Testament – was? Bedeutend freche Jungfrau, die Amalie. Und du?«
»Gott, ich« Peter zog die Augenbrauen über den kleinen litauer Augen empor: »Heute bin ich dabei gewesen. So 'n mal. Sonst, der Beckmann geht nich –«
»– So – der Beckmann ist dein Dienerideal? – Gott mit dem dummen Gesicht«
Als Peter seinem Herrn das Beinkleid reichte, nahm er ein anderes Thema auf: »Schön is hier Das Haus, der Garten. Alles gehört uns«
»Ja,« meinte Günther und hielt im Ankleiden inne, um seine Bemerkung Peter eindringlich mitzuteilen: »Wie dieser Anzug. Alles weich – lose. Nicht? Und die Uniform war steif – und eng. Nun also. Wenn man den Dienst aufgibt und nach Kaltin zieht, dann zieht man eben die Uniform aus und dies hier an«
Peter war voller Bewunderung: »Wie spitzig der Herr Graf das sagen Ja, so 'n Kopf, wie unser Graf Aber so stramm war unser Dienst nicht.«
»Ach was, Dienst Das Leben, verstehst du? Die Zeit vergeht und noch zu wenig, zu wenig …«
»Weiber,« half Peter ein.
»Ja, auch das. Das ist vorüber. Hier ist Ruhe.«
»Gott sei Dank,« schloß Peter die Unterhaltung.
Günther war fertig und stellte sich vor den Spiegel.
Erstes Kapitel
Aus dem Badezimmer erscholl ein gleichmäßiges Plätschern. Günther von Tarniff saß in seinem rotgelben Badebassin. Die lauwarme Dusche wurde in der Morgensonne ganz blank –
fließendes Kristall. Das war so hübsch und angenehm, daß Günther sich nicht davon trennen konnte. Er saß da schon geraume Zeit und registrierte die behaglichen Empfindungen, die über seinen Körper hinglitten … wachsam und aufmerksam, wie er jedes angenehme Gefühl in sich zu verfolgen pflegte, als müßte aus dieser Addition sich ein Glück herausrechnen lassen.
»Ziehen Herr Graf die neuen Weißen an?« fragte Peter aus dem Nebenzimmer.
»Ja. Gefallen sie dir nicht?« rief Günther zurück.
»'ne neue Mode. Wird man sehen,« meinte Peter.
Nun mußte Günther heraus. Peter rieb ihn behutsam mit einem weichen Tuch ab. Günther pflegte seinen Körper wie ein Brahmane. Er bewunderte ihn und achtete ihn, als die Tafel, auf der das Leben viele, wichtige Genüsse zu verzeichnen hat.
»Frau Gräfin waren schon auf, bei der Morgenandacht,« berichtete Peter. »Ja, bei den alten Herrschaften im Flügel ist Morgenandacht mit den Leuten vom Alten Testament, wie die Amalie sagt.«
»Teufel. Dann sind wir hier das Neue Testament – was? Bedeutend freche Jungfrau, die Amalie. Und du?«
»Gott, ich« Peter zog die Augenbrauen über den kleinen litauer Augen empor: »Heute bin ich dabei gewesen. So 'n mal. Sonst, der Beckmann geht nich –«
»– So – der Beckmann ist dein Dienerideal? – Gott mit dem dummen Gesicht«
Als Peter seinem Herrn das Beinkleid reichte, nahm er ein anderes Thema auf: »Schön is hier Das Haus, der Garten. Alles gehört uns«
»Ja,« meinte Günther und hielt im Ankleiden inne, um seine Bemerkung Peter eindringlich mitzuteilen: »Wie dieser Anzug. Alles weich – lose. Nicht? Und die Uniform war steif – und eng. Nun also. Wenn man den Dienst aufgibt und nach Kaltin zieht, dann zieht man eben die Uniform aus und dies hier an«
Peter war voller Bewunderung: »Wie spitzig der Herr Graf das sagen Ja, so 'n Kopf, wie unser Graf Aber so stramm war unser Dienst nicht.«
»Ach was, Dienst Das Leben, verstehst du? Die Zeit vergeht und noch zu wenig, zu wenig …«
»Weiber,« half Peter ein.
»Ja, auch das. Das ist vorüber. Hier ist Ruhe.«
»Gott sei Dank,« schloß Peter die Unterhaltung.
Günther war fertig und stellte sich vor den Spiegel. Er sah gut aus, er konnte zufrieden sein: die matte Gesichtsfarbe, das schwarze Haar seiner italienischen Mutter, die braunen, blanken Frauenaugen mit den langen Wimpern, die Lippen so rot wie bei Knaben, in denen die Jugend noch wie ein Fieber brennt.
»Heute wieder wunderbar,« meinte Peter.
Sie hat auf mich gewartet, dachte Günther, als er in den Gartensaal trat und die zwei Gedecke auf dem Frühstückstische sah. Eine behagliche Rührung ergriff ihn bei diesem Anblick: »Angenehm ist das – wie – wie – reine Wäsche nach der Reise«
Er trat auf die Veranda hinaus und blickte über die Kieswege und Blumenbeete hin. Die heiße Luft zitterte und flimmerte. Der Buchsbaum glänzte wie grünes Leder. Hinter dem Garten dehnte sich Wiesenland aus, dann niedrige Hügel, an denen die Äcker wie regelmäßige Seidenstreifen niederhingen. Unten, von der Buchsbaumhecke sah Günther seine Frau auf das Haus zulaufen. Die eine Hand hielt die Schleppe des weißen Kleides, die andere einen bunten Strauß Erbsenblüten. Ein wenig atemlos blieb Beate vor Günther stehen und lächelte. Die Gestalt schwankte leicht, wie zu biegsam.
»Riech mal,« sagte sie und hielt ihm den Strauß hin. »Das riecht wie Sommerferien, nicht?«
»Du kannst ja laufen wie ein Jöhr,« meinte Günther.
»Ja, ja« Beate lachte: »Hier ist man wieder jung; weil alles umher so schön alt ist, so alt wie – wie Kinderfrauen.«
Sie gingen in den Gartensaal. Günther streckte sich in einem Sessel aus und ließ sich Tee einschenken.
»Gewiß Gut ist's hier,« begann er, die Worte langsam vor sich hinschnarrend. »Wie's so aussieht, müßte der schon ein umgewandter Monsieur sein, der hier nicht auf seine Rechnung kommt, wie, Beating?«
Beate schlug die Augen zu ihm auf, für das schmale, weiße Gesicht sehr große Augen, durchsichtig und graublau, mit ein wenig feuchtem Golde auf dem Grunde. Eine freundliche, ruhige Ironie lag in ihrem Blick. Das machte Günther befangen. Er begann im Zimmer auf und ab zu gehen und angeregt zu sprechen: »So wie hier, das lieb' ich; ruhige, königlich preußische Schönheit. Die ewigen Großartigkeiten fallen mir auf die Nerven. Na – ja du – du bist anders. Sorrent – Luzern – das ist dir wie dein Deputat.«
»Ja, Kaltin ist gut,« meinte Beate.
»Hier läßt man sich also nieder,« setzte Günther seine Betrachtung fort. »Das ist das Definitive – Ruhe – Abschluß.«
Beate zog die Augenbrauen empor.
»Womit schließt du denn ab? Jetzt fängt's doch gerade an – unser Leben.«
»Für euch Frauen,« dozierte Günther mit klingender Stimme, »für euch ist die Ehe ein Anfang – der Anfang. Für uns Männer ist die Ehe auch ein Ende. Das Frühere ist zu Ende – aus; verstehst du? – Frauen unserer Gesellschaft haben kein Früher. Sie haben Gouvernanten, aber keine Vergangenheit gehabt.«
»Dieses ›Früher‹ klingt ziemlich unsympathisch,« warf Beate ein wenig gereizt ein.
Günther lachte: »Ja, das könnt ihr nun mal nicht ändern. Ihr Ehefrauen seid immer 'ne Art Hafen. Du, Beating, bist ein hübscher, glatter, tiefer Hafen, gut ausgebaggert, man sieht bis auf den Grund.«
Beate schaute in der stillverschlossenen Art vor sich hin, die sie anzunehmen pflegte, wenn sie etwas gleichsam nicht zu sich hereinlassen wollte, es ihr zuwider war. Günther sprach schon von anderem: »Müssen wir nicht zu unseren alten Damen hinüber?«
»Ja, wenn du willst.«
»Sag, ist's dort noch so – so – düster?«
»Düster – dort?«
»Na ja, für dich – natürlich – da sind's die Kinderzimmer und so. Die Zimmer sind's auch nicht. Ich glaube, es ist die Tante Seneïde.«
»Tante?« rief Beate. »Aber Tante Seneïde ist doch wie – wie Mondschein im Ahnensaal.«
»So ist das nicht unheimlich, wenn man so ist?«
»Ach nein« erklärte Beate. »Weißt du, wenn der Mond durch die oberen Fenster des Ahnensaals scheint, dann ist der Fußboden ganz voll von Lichtkringel. Als Kinder setzten Mareile und ich uns da mitten hinein. Tante Seneïde ging im Saale auf und ab und sagte ihre geistlichen Lieder her. Das war so echt Kaltinsch, und das gehört Tante.«
»So,« meinte Günther, »als Knabe habe ich mich gefürchtet, wenn die Leute von der kranken Komtesse sprachen. Na, jetzt soll sie mir wie Mondschein im Ahnensaal sein. Komm«
Zweites Kapitel
Lantin, das Stammgut der Tarniffs, grenzte an Kaltin, den Sitz der Losnitz'. Beate und Günther waren Nachbarskinder und verwandt. Die Tarniffs und die Losnitz' gehörten zu dem alteingesessenen Landadel, zu den »braungebrannten Herren,« von denen Bismarck spricht: »die man morgens früh um fünf auf ihren Feldern einhergehen oder reiten sieht.« Starke Leute, die das Leben und die Arbeit lieben, roh mit den Weibern und andächtig mit ihren Frauen umgehen und einen angeerbten Glauben und angeerbte Grundsätze haben. Der Lantiner Zweig der Tarniffs jedoch hatte durch mehrere Generationen dem Staat gute Diplomaten geliefert. Der Aufenthalt in der Fremde entrückte sie ihrem Landsitz. Die Schüler der Grumbkow, Hardenberg, Bismarck brachten etwas Fremdes in das Gleichgewicht und die ein wenig hochmütige Beschränkung der Landjunker; neue Gedanken und Appetite komplizierten ihr Seelenleben. Dazu schlossen die Herren auf ihren diplomatischen Posten Ehen mit Ausländerinnen. Das exotische Blut nagte an den starken Nerven der märkischen Rasse, erhitzte und schwächte sie mit seiner Erbschaft fremder Geschlechter.
Graf Botho, Günthers Vater, war mit einer italienischen Prinzessin vermählt gewesen; ein herrliches Geschöpf, wie Fra Sebastiano sie gerne malte: königliche, edelsteinharte Augen, eine bleiche Gesichtsfarbe, in die sich etwas wie grünliches Gold mischt. Die schöne Römerin konnte deutsche Luft und deutsche Menschen nicht vertragen. Getrennt von ihrem Gatten lebte sie mit ihrem einzigen Kinde, dem kleinen Günther, in ihrer Heimat. Noch jung erlag sie einem Brustleiden. Lantin hatte von seiner Herrschaft wenig gesehen. Jetzt langte Graf Botho in Lantin an mit seinem Kinde, dem Sarg seiner Frau und Komtesse Benigne, seiner alten Schwester. Der Sarg wurde in der Familiengruft beigesetzt, Benigne mit dem Kinde im Schloß eingerichtet, und dann reiste Graf Botho wieder ab.
Hier verbrachte Günther seine Kindheit. Damals war es, daß er seine ersten Spiele mit Beate und Mareile, der braunen Inspektorstochter, zwischen den Levkojen und Lilienbeeten des Kaltiner Gartens spielte.
Die Baronin von Losnitz, früh verwitwet, lebte mit ihrer einzigen Tochter in Kaltin. Komtesse Seneïde Sallen, ihre Schwester, wohnte bei ihr. Irgendeine brutale Liebesgeschichte war in das stille Leben des Landfräuleins eingeschlagen und hatte es seelisch und geistig gebrochen. Jetzt lebte sie hier. Friedliche Beschäftigungen, die freundliche Narkose der Religion erhielten das Gleichgewicht dieses kranken Geistes.
Schloß Lantin wurde unterdes wieder leer. Komtesse Benigne starb, und Günther wurde in die Stadt gegeben. Lantin sah seinen Herrn zwar noch einmal, allein unter wunderlichen Umständen, wieder. Graf Botho langte mit einer fremden, schwarzlockigen Dame an. Frau Kulmann, Kastellanin und Kammerdienergattin, verstand es, ein undurchdringliches Dunkel um die Fremde zu breiten. Die Leute schüttelten die Köpfe. Begegneten sie dem Paar, dann rückten sie an den Mützen, verzogen jedoch höhnisch die Mäuler. Mankow, der Wildhüter und Vertraute des Grafen, erzählte abends im Waldkruge unheimliche Geschichten von der »verfluchten Schwarzen«. Über dem Portal des Schlosses hing in bemaltem Stein das Tarniffsche Wappen: auf dem Tartschenschilde in goldenem Felde drei schwarze Lindenblätter, darüber, auf gekröntem Stechhelm, zwischen dem offenen, goldenen Flug ein wachsender, schwarzer Brackenhals. »Die drei herzförmigen Blätter,« sagten die Lantiner, »sind die drei Weiberherzen, die jeder Tarniff bricht.« – »Ja,« sagte Mankow, »und der Hund da oben, das ist der Teufel, der sie holt. Unser Alter hat sich seinen Teufel selber mitgebracht.« Die Sache nahm kein gutes Ende: »So verfault is unser Alter auch noch nich,« meinte Mankow. »Was zu doll is, is zu doll Das schwarze Aas hat die Reitpeitsch, die mit dem goldenen Knopf, wißt ihr, zu schmecken gekriegt.« Eine verschlossene Kutsche brachte die Schwarze eines Morgens zur Station. Der alte Herr verschloß sich in seine Gemächer, dann reiste er ab, kam wieder, vergrub sich in seine Bücher: »Alt is 'r,« sagte Mankow. »Er sagt, er hat das Leben satt. Muß der gefressen haben Was? Jetzt sitzt er bei den Büchern, und das ist das Letzte.« Ein Schlaganfall beraubte den alten Herrn seiner Füße. Stundenlang schob Kulmann ihn im Rollstuhl die Alleen des Parkes auf und ab, und das große, bleiche Greisenantlitz wackelte mißmutig und ergeben bei jeder Bewegung des Rollstuhles. Endlich kam das Ende. Kulmann hatte seinen Herrn eines Nachmittags allein im Park gelassen, um zu Hause einen Grog zu trinken. Das mochte ein wenig lange gedauert haben. Als Kulmann gegen Abend seinen Grafen aufsuchte, fand er ihn in der Herbstdämmerung tot im Rollstuhl sitzen, feucht von Abend nebeln, überstreut von Herbstblättern, und den goldenen Knopf der Reitpeitsche fest zwischen die Zähne geklemmt.
Günther mied das Schloß. Frau Kulmann kämpfte mit Staub und Motten und dachte an lustigere Zeiten, da sie jung war und dem seligen Herrn gefiel.
Günther erwuchs zu einem sehr glänzenden Ulanenoffizier. Er durchspähte das Leben mit leidenschaftlicher Hast nach Genüssen, als fürchtete er beständig, irgendein Genuß, ein seltenes Glück könnte ihm unterschlagen werden. Nach einigen Jahren hieß es, seiner Gesundheit halber müsse er den Dienst verlassen. Andere erzählten, seine Beziehungen zu einer hochstehenden Dame hätten seine Entfernung aus Berlin wünschenswert gemacht. Er ging nach Athen, bei der Gesandtschaft diplomatische Kenntnisse zu sammeln. Einige Winter später trafen die Jugendgespielen sich in Berlin. Frau von Losnitz wollte Beate in die Gesellschaft einführen. Günther befand sich gerade in einer Krisis, die bei solchen nervösen, allzu gierigen Lebenstrinkern gegen Ende der zwanziger Jahre einzutreten pflegt. Er war satt. Von jeher hatte er das Weib für die Verschleißerin der wichtigsten Genüsse des Lebens angesehen. Für jede Stimmung das richtige Weib zu finden erschien ihm als die bedeutsamste Kunst; und urplötzlich war er der Weiber so müde: »Es ist doch in der ganzen Welt immer wieder dieselbe kleine Schauspielerin mit den gemalten Augenbrauen und den geldgierigen Taubenaugen,« meinte er. »Ich kann Dir sagen,« schrieb er an den Maler Hans Berkow, seinen Freund, »ich gehe den Weibern wie einer Drehorgel, die eine zu oft gehörte Melodie spielt, aus dem Wege. Ich kann nur noch mit den stillen, kühlen Marmordamen im Museum verkehren.« In dieser Gemütslage mußte Beate stark auf Günther wirken. Dieses Mädchen, mit einer stilvollen Reinheit, schien ihm ein Glück zu versprechen, das ihm wirklich bisher unterschlagen worden war. »Sie ist ja die adelige Poesie in Person,« sagte er, denn er liebte die geschmückten Redewendungen. Einen schwungvolleren Bewerber hatte die kühle Berliner Gesellschaft noch nicht gesehen: »Je nun« sagte der Fürst Kornowitz, »wir haben bei unseren Damen schon alle möglichen Manieren versucht, Jockeymanieren, Künstlermanieren, Dekadenzmanieren. Der Tarniff scheint die Troubadourmanier aufbringen zu wollen. Keine bequeme Manier das.«
Beate nahm Günthers Werbung in ihrer wohlerzogenen Art hin. In den Schlössern unseres Landadels wachsen noch, unter feiner berechneter Obhut, solche Mädchen von wunderbar naiver Reinheit heran. Das Gute und Schöne erwarten sie von dem Leben, wie das Selbstverständliche, und Günther erschien Beate als dieses Schöne und Gute. Im Winter verlobten sie sich, im April wurden sie getraut, und im Juli des nächsten Jahres zog Günther nach Kaltin, entschlossen, dort ein glückliches Familienleben zu führen nach wohlbewährtem, altadeligem Rezepte.
Drittes Kapitel
Die alte Baronin von Losnitz saß in ihrem Voltairesessel und strickte einen blauen Kinderstrumpf. Schöne Haartrompeten, blank und weiß, rahmten das fette, weiße Gesicht ein mit den regelmäßigen Zügen. Seneïde saß am Fenster und nähte. Ihre Züge waren scharf und gezogen, die Lippen fast weiß, und die Augen lagen tief in den Höhlen und gaben dem Gesichte einen kummervollerregten Ausdruck. Sie legte ihren Fingerhut mit einem lauten »Klap« auf den Tisch, lehnte den Kopf zurück und schloß die Augen. »Beating,« begann sie, »war heute wieder wie sonst. Gestern, da war etwas Fremdes in ihrem Gesichte – etwas – ich weiß nicht?«
Die Baronin schaute ihre Schwester über die Brille hinweg an: »Hör, Seneïdchen, du machst die Dinge gern geheimnisvoll. Für ein junges Ehepaar ist das nichts. In deiner Milchkammer rührst du auch nicht in den Töpfen herum; du wartest doch ruhig, bis die Sahne sich absteht. Na – also«
Seneïde beugte sich still auf ihre Arbeit nieder.
Nun kamen Günther und Beate. Günther begann sofort die alten Damen zu bezaubern. Nichts im Leben war ihm ungemütlicher, als wenn er nicht gefiel. Bei der Toilette bemühte er sich, Peter zu gefallen, und auf der Reise dem Schaffner. »O Mama, wie blühend du aussiehst, hübsch und sommerlich. Und Tante – Ihr Harmonium habe ich heute früh schon im Bette gehört. Geradezu heilig hab' ich dabei geschlafen – auf Ehre. Gott, hier muß man ja gut sein.«
Dann sprachen sie von Mareile Ziepe, der Inspektorstochter. »O, unsere Mareile,« rief Günther, die ist groß Also – nicht nur die berühmte Sängerin; sie ist die gefeiertste Schönheit der Gesellschaft – der Gesellschaft – bitte.«
Die Baronin lachte: »Meine Mareile Die hatte immer eine feste Hand … Wenn man Ziepe heißt und dann …«
»Na ja, Ziepe,« meinte Günther, »das hat sie abgelegt. Sie heißt Cibò Ist auch besser. Die Fürstin Elise kann ohne Mareile nicht leben, der Fürst Kornowitz schmachtet sie an.«
Durch die Seitentür kam jetzt Frau Ziepe herein. Sie wollte die jungen Herrschaften begrüßen. Erhitzt und verlegen saß sie neben Beate und sprach von ihren Zwillingen. Plötzlich verklärte sich ihr Gesicht. Mareile war genannt worden.
»Auf Ihre Tochter,« wandte sich Günther an die Inspektorsfrau, »sind wir alle stolz.«
»Danke, Herr Graf, danke.« Frau Ziepe errötete. »Und ich hab' mich so vor der Kunst gefürchtet. Man spricht so viel. Aber Mareiling hat Charakter, Gott sei Dank.«
»Was tun wir?« fragte Günther seine Frau, als sie wieder allein in Beatens blauem Kabinett auf den weißlackierten Stühlchen saßen. »Natürlich beieinander sein« Er nahm Beatens Hand und küßte vorsichtig jede Fingerspitze. »Ja, was tun wir?« wiederholte Beate.
Günther dachte nach. »In den Garten müssen wir, damit wir so das Sumsum des Sommers hören. Nicht? Im Park unter den Linden muß es jetzt gut sein. Suche ein Buch heraus. So was Altmodisches, ganz Süßes, weißt du. Ich bestelle die Hängematten?«
»Ah so ist's gut« rief Günther, als sie beide unter den Linden in den Hängematten lagen. »Nun lies, Schatz.«
Zwischen den starken Stämmen hindurch sah Günther ein Stück des Teiches mit seinen Inseln von Froschlöffel und Wasserlinsen. Libellen, kleine blanke Lichtgestalten wiegten sich in der heißen Luft. Unter den Weiden am Ufer aber saßen die Schwäne, weiße, regungslose Gebilde. Günther blickte auf die schmale, helle Gestalt neben sich in der Hängematte. Lichter und Blätterschatten huschten über sie hin: Gott ja dachte er, unsere Frauen, die sind eigen So 'ne kühle, klare Luft ist um sie her. Die anderen sind auch schön – oh ja Mareile zum Beispiel, aber so das – das Festliche fehlt.
Beate hielt inne und blickte zu Günther hinüber. »Du hörst mir nicht zu. Woran denkst du?«
»Ich denke – ich denke an dich – und daß es gut ist, daß du hier in der Hängematte liegst und nicht – eine andere – Mareile oder sonst eine von den anderen.«
»Mareile? Warum?«
»Erinnerst du dich noch des Besuches der Rumpenower Kinder? Du und Mareile hattet damals lange, dünne Backfischbeine. Wir spielten Räuber im Garten. Ich weiß nicht, wie das kam, aber Mareile und ich mußten in den Rübenkeller flüchten. Kühl war's da und roch feucht nach Gemüsen. Wir waren stark gelaufen, unsere Herzen schlugen laut – tap – tap. Mareile hatte ein weißes Kleid an – und nackte Schultern. Nun da – bog ich mich vor und küßte eine dieser spitzen, heißen Backfischschultern. Früher war mir das nie eingefallen.«
»O wirklich?« warf Beate hin.
»Ja. Sie stieß mich vor die Brust und sagte: ›Dummer Junge.‹«
»Nun – und?«
»Ach nichts Ich dachte daran. Übrigens glaub' ich doch, daß Mareile damals in mich verliebt war.«
»Möglich« meinte Beate ein wenig hochmütig. »Sie sprach damals zuweilen vom Verlieben. Ich fand das lächerlich. Verlieben gehörte zur Kammerjungfer Lisette, zu Betty Ahlmeyer.«
»Ja – ja – natürlich« rief Günther. »Das war Kaltinsch – ganz echt. Na, lies nur.« Günther schaute wieder in das Blätterdach hinauf. Ein Schwarm Mücken drehte sich wie blonder Staub in einem Sonnenstrahl. Das macht schwindelig und schläfrig.
Günther reckte sich: »Wie schön – wie schön« Er pflegte jede Lebenslage genau auf die Summe von Befriedigung hin zu prüfen, die sie ihm bot; er stellte gern jedem Augenblick eine Zensur aus. Jetzt war er zufrieden. An dem Junggesellenleben war doch nichts Rechtes dran Stille, helle Zimmer, gute Menschen, diese Frau – dieses beruhigende, weiße Rätsel, an dem herumzuraten eine so friedliche Beschäftigung war – das wollte er jetzt.
Das Ehejahr in Berlin zählte nicht. Was die Liebe der Junggesellenjahre lehrt, läßt sich bei den Beaten schlecht verwenden. Da muß umgelernt werden; das macht ungeschickt. Beate nahm dort etwas Erstauntes, bleich Ergebenes an; als hätte sie eine Enttäuschung erlebt. Daß er diese Enttäuschung sein könnte, war für Günther kränkend und quälend gewesen. Berlin war ohnehin für Beate nicht der rechte Hintergrund. Hier war's gut Er streckte seine Hand zu der anderen Hängematte hinüber.
»Du hast geschlafen?« fragte Beate.
»Ja,« sagte Günther, »und geträumt. Ein Traum, ganz weiß von dir.«
Beckmanns schwarz und goldene Gestalt stand plötzlich in all dem Grün und meldete das Frühstück.
Zur Feier der Ankunft der jungen Herrschaft fand unten im Park ein Fest für die Gutsleute statt. Nach dem Dinner begaben die Herrschaften sich auf den Festplatz. Die Buchen und Kastanien am Teiche steckten voll bunter Lampen; farbige Lichtpünktchen, verloren in all dem Schwarz ringsum. Auf dem Rasenplatze wurde getanzt. Auf einem Tische brannte eine Petroleumlampe ruhig und schläfrig, wie in einer Familienstube. Dort saßen Inspektor Ziepe und der Schulze beim Bier. Die Musikanten fiedelten einen Schleifer; dünne, schnurrende Töne, die, wie verirrt, in die große Nachtstille hinaushüpften; und über dem Ganzen lag der melancholische Ernst, wie er über den Lustbarkeiten des Volkes zu liegen pflegt.
Günther hielt eine Rede. Er stand auf einer Bank, machte weite Armbewegungen, wurde ganz warm von den großen Worten, die er zu den schweren Arbeitergestalten hinuntersprach, die andächtig, ein wenig schläfrig, zuhörten … das tat ihm wohl. Dann wurde getanzt. Peter besorgte für Günther als Tänzerin die Eve Mankow, ein großes, rothaariges Mädchen mit grellen, rotbraunen Augen in einem runden, rosa Gesichte. Beate tanzte mit Edse Maschnap, der Galoschen und einen Stadthut trug. Edse unterhielt seine Dame. »Ich bin zurück aus der Stadt. Na ja – der Vater hat die zweite Frau. Die sorgte für ihre Kinder – da muß ich sehen, daß nicht alles so stille – stille – verschwindet – Frau Gräfin verstehen?«
Beate schaute zu Günther hinüber. Wie eifrig er sich mit dem großen, unangenehmen Mädchen unterhielt. Er erzählte etwas. Eve wandte sich ab, legte den Arm vor den Mund und lachte. Ja – er verstand es, jede zu nehmen –
Der Tanz war zu Ende. Die Herrschaften wollten vom Kahn im Teiche aus das Feuerwerk ansehen. Günther wäre gern geblieben und hätte sich an der Verehrung der Leute erwärmt. Zu imponieren ist eine so angenehme Beschäftigung; er wagte jedoch den Vorschlag nicht; er fürchtete, Beate würde dazu ihre ironisch erstaunten Augen machen. Auf dem Teiche war es köstlich. All die schweren, warmen Menschen mit ihrer schweren, erhitzten Lustigkeit hatten Beate mit großem Unbehagen erfüllt. Hier war es kühl und still und dunkel. Beate lag auf dem Rücken und sah in die Sterne hinauf. Günther ruderte anfangs und sprach angeregt. Dann fragte er plötzlich: »Warum liegst du so weiß da und sagst nichts?«
»Ich höre lieber zu,« erwiderte Beate. Das klingt sehr freundlich, dachte Günther, aber doch so 'n bißchen überlegen, als müßte man Nachsicht mit mir haben. Er wurde schweigsam. Beate hatte recht. Auch er wollte daliegen und seinem Empfinden lauschen. Das gehörte zu dieser Lebenslage. Helle, wunderbar weiche Töne gingen und kamen über das Wasser, als atmete und lebte die dunkle Fläche. Günther streckte sich neben Beate aus, nahm eine ihrer kühlen Hände. Über die schwarzen Wipfel stieg eine Rakete auf; eilig und golden stieg sie auf, immer höher, dann neigte sie sich, wie müde, und die Leuchtkugeln, ein farbiges Aufblühen, regneten nieder. Die Leute am Ufer riefen: »Hurra«
»Ja, die« meinte Günther, »die verstehen noch zu schreien, wenn sie lustig sind.«
»Möchtest du denn auch schreien?« fragte Beate.
»Gott Schreien Nein. Ich sag' nur, die können's noch, wir nicht, wir sind zu – zu – stilisiert – um lustig zu sein.«
Der Mond stieg über den Ahornbäumen auf. Der Teich sprühte. Die Stengel der Froschlöffel, des Wasserknöterichs, die weißen Köpfe der Wasserrose schienen größer, wie sie so unbeweglich in dem blauen Lichte standen.
Eine selige Trägheit, eine angenehme Wunschlosigkeit war über Beate gekommen. Als Günther sich auf sie niederbeugte und ihr die Lippen, die Augen küßte, ihren schmalen, ruhenden Körper in seine heißen, fiebernden Hände nahm, sagte sie: »Ach – laß – Liebster.«
Günther wurde sofort ruhig. Er seufzte. Ach ja Man muß ruhig und poetisch sein. »Dieses kühle Mondscheingesicht,« sagte er ein wenig gereizt. Dann griff er in das Wasser, mitten in eine Gesellschaft Wasserrosen hinein und holte sich die ganze Hand voll schwerer, weißer Blütenköpfe heraus: »So, letzt will ich dich putzen, warte.« Er steckte die feuchten Blumen in Beates Haar. Beate lachte unter dem Tropfenregen. »So ist's gut,« meinte Günther, »Schönheit – Schönheit – Schönheit, Amen.«
Beate saß in ihrem erdbeerfarbenen Nachtkleide noch auf. Amélie, das naseweise Gesichtchen rot vom Tanz, versuchte ein Gespräch.
»Ach nee, der Maschnap, über den hab' ich gelacht. Und die Eve, die war gut, wie 'n Pfannkuchen hat die sich gebläht.«
»Geben Sie mir die Bücher,« sagte Beate, und wenn die Gräfin sich die heiligen Bücher geben ließ, die Bibel und den Thomas a Kempis, dann mußte Amélie gehen.
Die Stille des alten Kaltin hatte Beate überempfindlich für jeden Eindruck gemacht. Jedes Erlebnis nahm tiefe Bedeutung an, wie Gestalten im Mondschein größer erscheinen.
Sie beugte sich über den Thomas a Kempis und las: »Mache mich stärker in der Liebe, daß ich im Innersten meines Herzens schmecken lerne, wie süß es ist, zu lieben und in Liebe aufzugehen und ganz mich zu bewegen. Singen möchte ich das Lied der Liebe …«
Draußen schüttelte ein plötzliches Wehen den Baum vor dem Fenster. Beate schaute auf, dann, wie erschöpft von dem übermächtigen Gefühl, lehnte sie den Kopf zurück. Ihr Gesicht war blaß, von der feinen Blässe der alten Rassen, die von jahrhundertelangem Stehen auf geschützten Höhen müde geworden sind. Der Ausdruck des Gesichtes war wie Lächeln und doch wie Leiden. Die braunen Zöpfe, noch feucht von den Wasserrosen, hingen über ihre Schulter nieder. Gewiegt von einer köstlichen Schlaffheit, zuckte Beate mit den Wimpern, als blendete sie eine lichte Vision.
Eine Tür ging. Das Parkett knarrte unter Günthers leichtem Tritt. Beate schloß die Augen. Ein blasses Rot stieg ihr in die Wangen, und die Hände auf den Seitenlehnen des Sessels zitterten leicht.
Viertes Kapitel
Das Stationsgebäude lag jenseits des Dorfes auf einem schattenlosen Sandhügel. Die Mittagssonne stach sengend auf den Bahnsteig nieder. Die elektrische Glocke meldete den Schnellzug. Herr Ahlmeyer, der Stationsvorsteher, erschien, die rote Mütze im Nacken. Über ihm, im ersten Stock des Hauses, wurde ein Fenster geöffnet. Betty Ahlmeyer steckte den blonden Kopf heraus und blickte gespannt den Schienenweg hinab. So erwartete sie seit dreiundzwanzig Jahren jeden Zug.
Heute erlebte sie etwas. Als der Zug hielt, entstieg einem Wagen erster Klasse Mareile Ziepe. In einen rahmfarbenen Staubmantel gehüllt, stand sie auf dem Bahnsteig und wiegte eine kleine, rote Tasche hin und her. Ahlmeyer schoß auf sie zu: »Fräulein Mareile – signora – nicht möglich Wir haben Sie nicht erwartet.«
»So ist kein Wagen da?« fragte Mareile ruhig. Nein, es war kein Wagen da. Aber wollte Mareile nicht Kaffee trinken? Wollte sie nicht Ahlmeyers Fuchs und Jagdwagen? Nein, Mareile wollte zu Fuß gehen. »Künstlerinnen sind unberechenbar« meinte Ahlmeyer.
Mareile schlug den Fußpfad über die Heide ein. Das warme, staubige Kraut knisterte unter ihren Füßen. Es duftete schwer nach Wacholder, Wermut, Schafgarbe. Töne, wie das Schwirren einer Violinsaite, zogen über das Land. Die lichtgebadete Schläfrigkeit über den altbekannten Orten stimmte Mareile nachdenklich. Die Arbeit an ihrem Schicksal hatte ihr die Heimat so fern gerückt.
Sie war mit Beate zusammen im Schlosse erzogen worden. Schon damals erschien es ihr als das Höchste im Leben, ganz zu denen auf dem Schlosse zu gehören. Mit wunderlicher Reizbarkeit empfand sie alles, was an den Unterschied zwischen ihr und Beate gemahnte. Sie selbst verstand es zu vergessen, daß sie die Tochter des Inspektors Ziepe war; daß die anderen es nicht vergaßen, brachte Gefühlsstürme in ihr hervor, die von ihrer Umgebung kaum begriffen wurden. In solchen Krisen hatte sie es geliebt, auf die Heide hinauszulaufen, zu laufen, zu laufen, bis ihr die Wangen brannten und sie müde an einem Wacholderbusch niederfiel. Dort, platt auf das Heidekraut hingestreckt, das Gesicht in die harten Stengel gedrückt, die Zöpfe voller Mittagsfalter, hatte sie unbändig geweint, weil sie kein Baroneßchen war.
Später kam Berlin mit dem Konservatorium, das Wohnen bei der Hauptmannswitwe, der Tante Oberau, die Reisen nach London und Wien, der Ruhm, endlich die Berliner Gesellschaft, in der Mareile durch Tarniffs eingeführt wurde. »Ich liebe sie wie meine Jugend,« sagte die Fürstin Elise Kornowitz von Mareile, und das war viel. Das Gefühl, daß dieses königliche Wesen eine gesellschaftliche Schöpfung der Fürstin Elise und ihrer Freundinnen war, begeisterte die Aristokratinnen für Mareile.
Still und staubig lag das Land da. Überall gelber Sand; Wiesen, Felder und Gärten lagen darauf, wie eine verblaßte Stickerei auf einem blind gewordenen Goldgrund. Die Feldgrillen schrillten am Wegrain. Mareile mußte über sie lächeln. Als Knabe hatte Günther sie damit geärgert, daß er sagte, die Feldgrillen riefen: »Ziepe – Ziepe.« ja Alles rief hier »Ziepe« und schien nichts von der berühmten Mareile Cibò, der Freundin der Fürstin Elise, zu wissen. Jetzt bog Mareile in die Lindenallee, die zum Schlosse führte, ein. Hier war es kühl und schattig. Das Ping-ping einer Schmiede tönte herüber. Ein Stallknecht, die Tressenmütze im Nacken, ritt ein großes, blankes Pferd aus; endlich das Schloß mit seiner schwarzgelben Fahne. Das war wieder Mareiles Welt. Über den sonnigen Hof ging sie zur Inspektorswohnung hinüber.
Gelber Sonnenschein lag in der kleinen Wohnstube auf den schwarz und rot gemusterten Möbeln. Auch der bekannte Geruch von Fettstiefeln und Suppe schlug Mareile entgegen. Wie still und unverändert das alles hier auf sie gewartet hatte Auf dem Sofa schliefen die Zwillinge Jei und Sini, die Backen rot unter dem blonden Flimmern der Haare. Sini erwachte und weinte. »Werdet ihr die Mäuler halten« rief Frau Ziepe von der Küche herüber. Sie erschien in der Tür – im kurzen Unterrock, die Ärmel aufgestreift, die nackten Füße in Pantoffeln. Sie errötete: »Mareiling – Kind« Sie breitete die nackten Arme aus, ließ sie jedoch wieder sinken. »Nein, nein – komm nicht. Wie ich ausschau' – was? ich muß den Fußboden scheuern, die Anna is so dumm. Ich komme gleich.« Sie verschwand wieder.
Vor dem Spiegel, hinter dem die Rute der Zwillinge steckte, nahm Mareile den Hut ab. Hinter ihr trat Vater Ziepe in das Zimmer, eine schwere Gestalt in weißem Leinwandanzuge, ein rotes Gesicht in einem gelben Bartgestrüpp. Erschreckend, dachte Mareile, die ihn im Spiegel betrachtete, dann wandte sie sich ihm zu. »Teufel, unsere Dame,« sagte Ziepe und küßte seine Tochter befangen auf den Scheitel. »Wo is Mutter?«
»Du willst wohl deinen Kognak, Vater?« erwiderte Mareile. Ziepe stand breitbeinig da und sah zu, wie seine Tochter zwischen Spind und Tisch hin und her ging unter dem leisen Klirren der Armbänder. »Hätte nicht pressiert,« brummte er, setzte sich und aß. Er wußte nichts zu sagen und schalt die Zwillinge. »Immer schlafen, wie die Spanferkel.«
Endlich kam Frau Ziepe im frischen Kattunkleide, die Augen voller Tränen. Ziepe fuhr sie an: »Was, heute wieder das Scheuerweib gespielt? Ich will das nicht. Ich hab' kein Scheuerweib geheiratet. Wozu is das Mädchen da – Teufel auch«
Frau Ziepe hörte ihn nicht. »Wie das glänzt« sagte sie und strich über den Diamant in Mareilens Ohr. Ziepe erhob sich, ging, froh, seiner vornehmen Tochter aus den Augen zu kommen.
Mareile lehnte sich in die Sofaecke zurück. Die Fliegen summten an den Fensterscheiben; die Suppe nebenan roch immer stärker. Frau Ziepe ging leise hin und her und diente ihrer Tochter, erzählte dabei von der Wirtschaft, den Herrschaften, dem Dienstmädchen. Die fünfzehnjährige Lene kam, kauerte zu Mareilens Füßen nieder und schaute andächtig zu der herrlichen Schwester auf. Das alles war rührend und lieb. Das findet man draußen in der Welt nicht. Und doch, warum ist all das so zum Weinen traurig? dachte Mareile.
Fünftes Kapitel
Günther wollte wirtschaften. Er ging auf das Feld hinaus. Es wurde gemäht. Brusttief regten sich die Leute in den Halmen, wie in knisternder, gelber Seide. Ziepe stand dabei und schimpfte: »Du kleines, schwarzes Aas, heißt das setzen? Du brauchst nur mit deiner Rotznase anzustoßen, dann purzelt die Bude um.« Günther war sehr würdig und leutselig. »Hier ist ungleich gemäht,« bemerkte er. »Haben die Leute auch zu trinken? Ich will, daß nichts versäumt wird.« Er schritt an den Garben entlang, durch die Atmosphäre der heißen Ähren und heißen Menschen. Von einer Garbennehmerin, die hübsche Augen hatte, ließ er sich die Ackerwinden geben, die das Mädchen auf dem Strohhut hatte. Als er jedoch weiter dem Ellernbruch zuging, war er unzufrieden. Das müßte anders sein. Er müßte anders auf seine Leute wirken. Diese gleichgültigen Augen wollte er nicht. Teufel Wenn man auf seine eigenen Arbeiter nicht wirkt, wo will man denn Effekt machen
Im Ellernbruch fand Günther eine lange, bunte Gestalt im Grase liegen. Wie kam all das hierher? Der blau und weiß gestreifte Sommerflanell, das blauseidene Hemd, der rot und blau gestreifte Gürtel?
»Hans Berkow,« sagte Günther.
»Morjen, Tarniff,« meinte Berkow und gähnte. »Wie geht's?«
»Was machst du hier?«
»Siesta. Nimm doch Platz.«
Günther setzte sich auf das Moos. Was der Anblick von Hans Berkow nicht alles an Berliner Luft mitbrachte »Studien,« berichtete Hans. »Ich wollte euer brutales Licht studieren, dicke Bauernmädchen. Das ewige Malen von Berlinerinnen macht den Pinsel flau.«
»Wo wohnst du? Warum bist du nicht bei uns?«
»Es ist nicht angenehm, der unvermeidliche Berkow zu sein. In Berlin ist er – in Kaltin wieder.« Das Gesicht hatte so regelmäßige Züge, daß es zuerst leer und starr erschien. Rotes Haar in kurzen Locken bedeckte wie eine Kappe den Kopf. Die enzianblauen Augen mit den roten Wimpern aber waren es, die dem Gesicht seine überraschende Schönheit gaben. »Ich wohne in einem Waldkruge. Schöne Bäume. Auch die Familie Mankow ist malerisch. Die Tochter Eva –
eine gute Studie in Rot.«
»Dort kannst du nicht bleiben,« meinte Günther.
»Ja – wenn du was für mich tun willst –« Hans blinzelte mit den roten Wimpern nachdenklich zur Sonne auf. »Du hast da so 'n altes Schloß. Süperb vermoost. Wenn du mir gestatten würdest, dort –«
»Aber natürlich.«
»Danke.«
Eine Weile schwiegen beide. »Die schöne Mareile ist heute bei euch angelangt,« begann Hans wieder. »Du bist gut unterrichtet,« meinte Günther. »Bist du deshalb hier?«
»Ja – auch.« Berkow wälzte sich, wie im Bette, auf die andere Seite herum. »Ja – Mareile ist gut – nicht?« sagte er langsam. »Wenn sie sich ein wenig zurückbiegt – dann die Linie den Busen hinauf zum Halsansatz – das vergißt sich nicht so leicht. Und die Arme – als wäre sie im Peplon geboren.«
»Du bist im Zuge,« bemerkte Günther. Berkow zog die Augenbrauen hinauf. »Was willst du Wenn der Gedanke an ein Weib uns zu beißen anfängt, wie der bekannte spartanische Fuchs aus der Geschichtsstunde – na – dann muß was geschehen … Wenn ein Weib eine unbequeme große Rolle in unseren Vorstellungen zu spielen beginnt, ja – dann müssen wir es eben besitzen, um es loszuwerden. Kann ich auf dich rechnen?«
»Gewiß, gewiß, mein Alter,« erwiderte Günther. »Soweit bei Mareile von Rechnen die Rede ist … Sie ist unberechenbar.«
»Ach Gott Die Mädchen haben ja doch alle denselben Generalnenner« meinte Berkow. Günther lachte gezwungen. Der Gedanke an ein schönes Weib in Verbindung mit einem anderen als ihm selbst war Günther stets zuwider gewesen.
Sechstes Kapitel
Zum Diner pflegte Mareile im Schlosse zu erscheinen. Sie war still und nachdenklich. »Das ist die Kaltiner Luft; in ihr wird man froh und ein wenig schläfrig,« sagte sie. Das Leben hier ergriff die Sängerin, wie ein großes Schweigen uns ergreift, wenn wir aus lautem Lärm kommen. Am Abend saß man im Gartensaal bei der Lampe zusammen. Der Duft tauiger Blumen strömte durch die geöffnete Tür in das Gemach. Beate lag im Sessel und schloß die Augen. Den Tag
über einer unruhigen, launenhaften Sinnlichkeit dienen, das macht müde. Mareile sang. Ihre Stimme klang hoheitsvoll und wunderbar erregend durch die alten, tiefberuhigten Räume. Günther lehnte in der Tür und sah auf die Rosenbüsche hinaus, die schwarz und regungslos im Mondlichte standen. Er war bewegt wie ein Knabe. Die beiden schönen Frauen, die Musik, die Mondnacht. All das machte ihn unruhig. Er hätte gewollt, daß auch Mareile ihn liebte, oder, daß auch er so singen könnte, oder – er wußte es selber nicht.
Die frischgemähten Stoppelfelder glitzerten unter der grellen Herbstsonne, die Ebereschenallee war rot von Beeren, im Schloßgarten flammten die Gladiolen, Stockrosen und Georginen. Es war Zeit, die Hühnerjagd zu eröffnen. Beckmann stand auf der Freitreppe, schützte mit der Hand die Augen und sah die Landstraße hinab, ob von der Station der Besuch käme. Der Gartensaal füllte sich mit den gewohnten Gästen. Die Fürstin Elise Kornowitz mit ihrer gelehrten Gesellschafterin, dem Fräulein von Mikewitz, der Verfasserin eines Buches über »Die Stellung der Frau bei den Römern,« langten an. Die Fürstin war ein kleines, gutes Wesen. Das feine Gesichtchen weiß von Puder. Die ganz hellgrauen Augen sahen ein wenig müde unter der Wolke blonden Haares hervor. Sie trug das Haar, wie Charlotte von Stein es zu tragen pflegte, denn sie glaubte ihr zu gleichen. »Im Äußeren und in manchem anderen,« liebte sie zu sagen. »Bin ich dein Goethe?« fragte ihr Gemahl sie mit seinem ironischen, freudlosen Lächeln. »O nein,« meinte die Fürstin, »mein Goethe ist Mareiling.« Der Fürst Kornowitz kam allein. Er reiste immer allein. »Reisen macht unliebenswürdig,« behauptete er, »und geteilte Unliebenswürdigkeit ist doppelte Unliebenswürdigkeit.« Einige Offiziere füllten den Gartensaal mit leisem Sporenklirren und dem Duft Attkinsonscher Parfüms und feinen Juchtenleders. Die Grafen Egon und Botho Sterneck von den ersten Garde-Ulanen, Seiner Majestät schönste Offiziere; der Major von Tettau. Er rollte seine hervortretenden, fayenceblauen Augen, als sei ihm der gelbe Kürassierkragen zu eng, und versteckte unter dem großen, militärischen Schnurrbart ein kleines, gefühlvolles Mündchen. Leutnant von Remm, von den Königshusaren, klein und blond, errötete wie ein Primaner. Die Gräfin Blankenhagen, die die schönsten Arme der Gegend hatte, war zu Pferde vom Nachbarsgut herübergekommen. Frau von Scharf mit ihrer Agnes kamen ohnehin zu jeder Jagd, denn für Agnes, mit den blauen Marlittaugen, mußte eine Partie gefunden werden.
Als Mareile in den Gartensaal trat, verbeugten sich die Herren sporenklirrend, sie hatten dabei alle ein blankes Flackern in den Augen. Major von Tettau murmelte: »Donnerwetter« und zog seinen Mund süß zusammen, als schlürfte er Marasquino. Mareile grüßte flüchtig und zerstreut. Sie lächelte der Fürstin Elise entgegen und tat, als sehe sie nur diese, aber all die begehrenden Männerblicke erregten ein wohliges Gefühl in ihr, als stände sie unter einer warmen Dusche.
Günther war sehr angeregt. »Gut, daß sie alle da sind. Wir wollen ihnen mal zeigen, was 'ne Ehe ist,« sagte er zu Beate.
Es war Hühnerjagd angesagt.
Hans Berkow ging durch die tauigen Stoppelfelder dem Schlosse zu. Er dachte über Mareile nach.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im ersten Kapitel?
Das erste Kapitel beschreibt Günther von Tarniff, der im Badezimmer entspannt, während Peter, sein Diener, ihn für den Tag vorbereitet. Es wird die Beziehung zu seiner Frau, Beate, eingeführt und ihre Ankunft in Kaltin geschildert, wo sie sich niederlassen wollen. Es gibt auch Gespräche über das Leben, die Vergangenheit und die Dynamik zwischen Mann und Frau.
Was wird im zweiten Kapitel erzählt?
Das zweite Kapitel erläutert die Familiengeschichte der Tarniffs und der Losnitz', die verwandtschaftliche Beziehung zwischen Günther und Beate, sowie die Hintergründe ihrer Familien. Es wird auf die Vergangenheit von Günther, seinen Vater und die Umstände seiner Kindheit eingegangen. Ebenso wird die Geschichte von Baronin von Losnitz und ihrer Schwester, Komtesse Seneïde Sallen, erzählt. Schließlich wird auf Günthers Werben um Beate in Berlin und ihre Verlobung eingegangen.
Welche Ereignisse werden im dritten Kapitel beschrieben?
Das dritte Kapitel beschreibt den Alltag in Kaltin und die Interaktionen zwischen Günther, Beate und den anderen Bewohnern des Hauses, insbesondere den alten Damen. Es wird ein Besuch bei den alten Damen beschrieben, die Erwähnung von Mareile Ziepe, der Inspektorstochter, und die anschließende Zeit im Garten. Ein Fest für die Gutsleute wird veranstaltet, bei dem Günther eine Rede hält und mit Eve Mankow tanzt, während Beate mit Edse Maschnap tanzt. Der Abend endet mit einem Feuerwerk auf dem Teich.
Worum geht es im vierten Kapitel?
Das vierte Kapitel handelt von Mareile Ziepes Rückkehr in die Heimat und ihrem Besuch bei ihren Eltern, den Ziepes. Es wird ihre Vergangenheit, ihre Erziehung zusammen mit Beate und ihr gesellschaftlicher Aufstieg in Berlin geschildert. Das Kapitel beschreibt die Begegnung mit ihren Eltern und der Lene in der bescheidenen Inspektorswohnung und die damit verbundenen Gefühle.
Was passiert im fünften Kapitel?
Im fünften Kapitel versucht Günther, sich mit der Bewirtschaftung des Gutes zu beschäftigen. Er trifft auf Hans Berkow, einen Maler aus Berlin, im Ellernbruch. Sie unterhalten sich über Kunst, das Landleben und Mareile. Berkow bittet Günther um Hilfe, um Mareile näherzukommen.
Was wird im sechsten Kapitel beschrieben?
Das sechste Kapitel beschreibt Mareiles Besuche im Schloss und ihre ruhige, nachdenkliche Art. Sie singt am Abend, was Günther bewegt. Es wird von der Hühnerjagd erzählt, zu der Gäste wie Fürstin Elise Kornowitz und Fürst Kornowitz sowie Offiziere kommen. Auch Hans Berkow ist anwesend. Günther möchte den Gästen zeigen, was eine Ehe ist.
- Quote paper
- Eduard Keyserling (Author), 2008, Beate und Mareile, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/119788