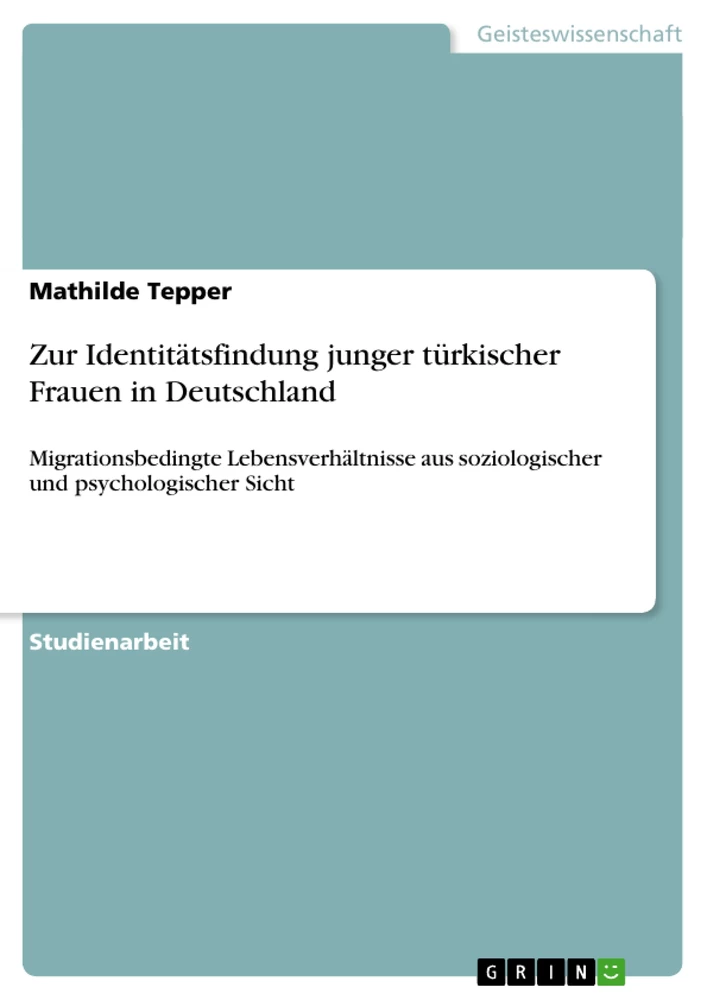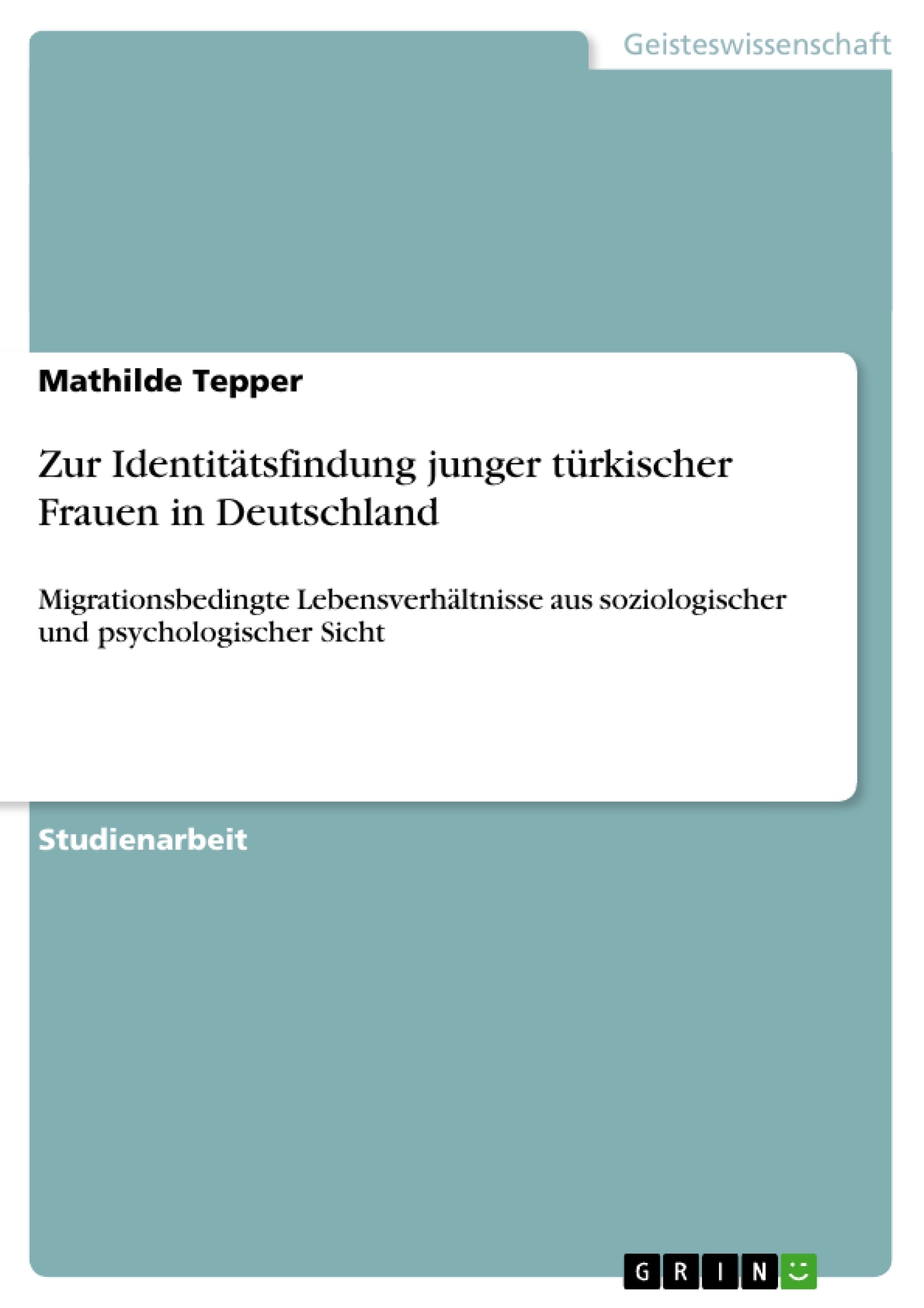Zuwanderung, begrenzter Zuzug ausländischer Bürger, multikulturelle Gesellschaft, Migration, Integration, doppelte Staatsbürgerschaft, usw. sind zurzeit Schlagwörter, die im Zusammenhang mit Migration Medien und Politik beherrschen. Menschen aus anderen Ländern haben aus diversen Gründen immer schon in Deutschland gelebt. Mit den so genannten ‘Gastarbeitern’ kam es in den fünfziger Jahren, wirtschaftlich bedingt, zu einem Zustrom von Arbeitsmigranten. Die Dauer des Aufenthaltes in Deutschland veranlasste die Menschen dazu, ihre Familien nachzuholen. Ebenso leben in Deutschland Flüchtlinge und Asylbewerber. Daher wird viel vom Wandel der Gesellschaft in eine multikulturelle Gesellschaft gesprochen. „Sowohl die Befürworter als auch die Gegner der Idee der multikulturellen Gesellschaft gehen in ihren Argumenten ausdrücklich von der Annahme aus, daß die Menschen Träger der nationalen und kulturellen Identität sind“ (vgl.: Han, zitiert Geißler / Esser, 2000, S.334). Was ist Identität? Was passiert mit der Identität des Einzelnen unter den Bedingungen der Migration? Diesen Fragen soll anhand der türkischen Zuwanderer als größte Gruppe der in Deutschland lebenden Migranten nachgegangen werden. Die kulturelle Sozialisation der türkischen Zuwanderer unterscheidet sich deutlich von den Lebensgewohnheiten in Deutschland. Dieser Unterschied zeigt sich besonders in der Stellung der türkischen Mädchen und Frauen. Wie gestalten sich Identität und Persönlichkeit der Frauen und Mädchen, die migrationsbedingt in dieses Land kommen? Wie entwickeln sich Identität und Persönlichkeit von türkischen Mädchen, die in Deutschland geboren werden? Nach der Darstellung der Sozialisationsbedingungen von türkischen Mädchen in der Türkei und in Deutschland wird beispielhaft die Lebensgeschichte einer jungen türkischen Frau geschildert. Im Anschluss daran werden je ein Erklärungsmodell zur Identitätsbildung aus Psychologie und Soziologie ausgeführt. Die Wahl ist auf die Theorien von Erikson und Krappmann gefallen, da diese beiden Ansätze einander ergänzen, wie im weiteren Verlauf noch ausführlicher erläutert werden wird. Anschließend wird versucht, die beiden geschilderten Identitätsansätze auf die Situation der türkischen Mädchen und Frauen allgemein und auf den dargestellten Fall im Besonderen zu beziehen. Zum Abschluss erfolgen Ausführungen über die Bedeutung des Themas für die soziale Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Sozialisation
- 2.1 Sozialisation türkischer Mädchen in der Türkei
- 2.2 Sozialisation türkischer Mädchen in Deutschland
- 3. Ein Beispiel: Fatma A.
- 4. Was ist Identität?
- 4.1 Identität aus psychologischer Sicht: Die Identitätstheorie von E. H. Erikson
- 4.1.1 Die Entwicklungsstufen der Identität
- 4.1.2 Der Begriff Identität
- 4.2 Identität in der Soziologie: Identität und soziale Interaktion von L. Krappmann
- 4.3 Kongruenz und Divergenz der Theorien: Gegenüberstellung Erikson und Krappmann
- 4.1 Identität aus psychologischer Sicht: Die Identitätstheorie von E. H. Erikson
- 5. Identität und Sozialisation
- 5.1 Identität und Sozialisation türkischer Mädchen
- 5.2 Identität und Sozialisation am Beispiel Fatma A.
- 6. Die Bedeutung des Themas für die soziale Arbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen der Identitätsfindung junger türkischer Frauen in Deutschland vor dem Hintergrund migrationsbedingter Lebensverhältnisse. Ziel ist es, den Prozess der Identitätsbildung aus soziologischer und psychologischer Perspektive zu beleuchten, um die besonderen Schwierigkeiten und Chancen, die mit der Migration verbunden sind, zu verstehen.
- Sozialisationsbedingungen türkischer Mädchen in der Türkei und Deutschland
- Einfluss migrationsbedingter Lebensverhältnisse auf die Identitätsfindung
- Theorien zur Identitätsbildung aus psychologischer und soziologischer Sicht
- Zusammenhang zwischen Identität und Sozialisation im Kontext der Migration
- Relevanz des Themas für die soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Identitätsfindung junger türkischer Frauen in Deutschland ein und erläutert die Relevanz des Themas vor dem Hintergrund der zunehmenden Migrationsbewegungen. Im zweiten Kapitel werden die Sozialisationsbedingungen türkischer Mädchen sowohl in der Türkei als auch in Deutschland beleuchtet. Im Anschluss daran wird ein Beispiel für die Lebensgeschichte einer jungen türkischen Frau vorgestellt, um die Herausforderungen der Identitätsfindung anhand eines konkreten Falls zu verdeutlichen. Die Kapitel 4 und 5 widmen sich der theoretischen Einordnung der Identitätsbildung. Dabei werden die Theorien von Erikson (psychologische Perspektive) und Krappmann (soziologische Perspektive) vorgestellt und in Bezug zueinander gesetzt. Im sechsten Kapitel wird die Relevanz des Themas für die soziale Arbeit herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Identitätsfindung, junge türkische Frauen, Migration, Sozialisation, Interkulturelle Kommunikation, Identitätskonflikte, Erikson, Krappmann, soziale Arbeit, Lebensverhältnisse in Deutschland, Kultur, Religion, Geschlecht, Integration, Ausgrenzung, Multikulturalität, Lebensgeschichte.
- Citation du texte
- Mathilde Tepper (Auteur), 2002, Zur Identitätsfindung junger türkischer Frauen in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/11991