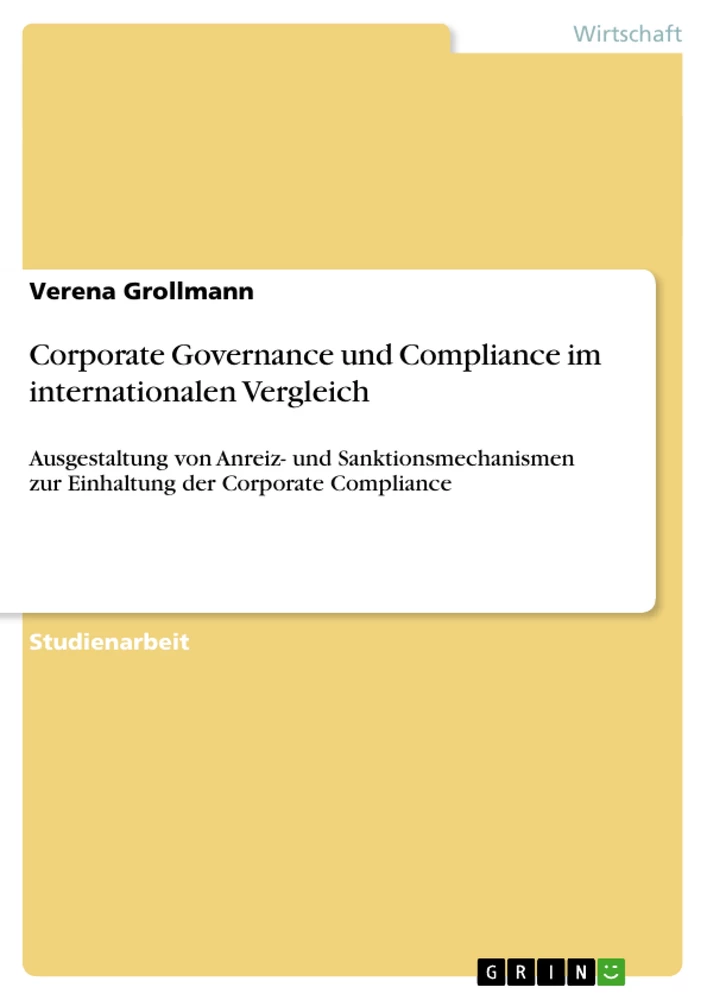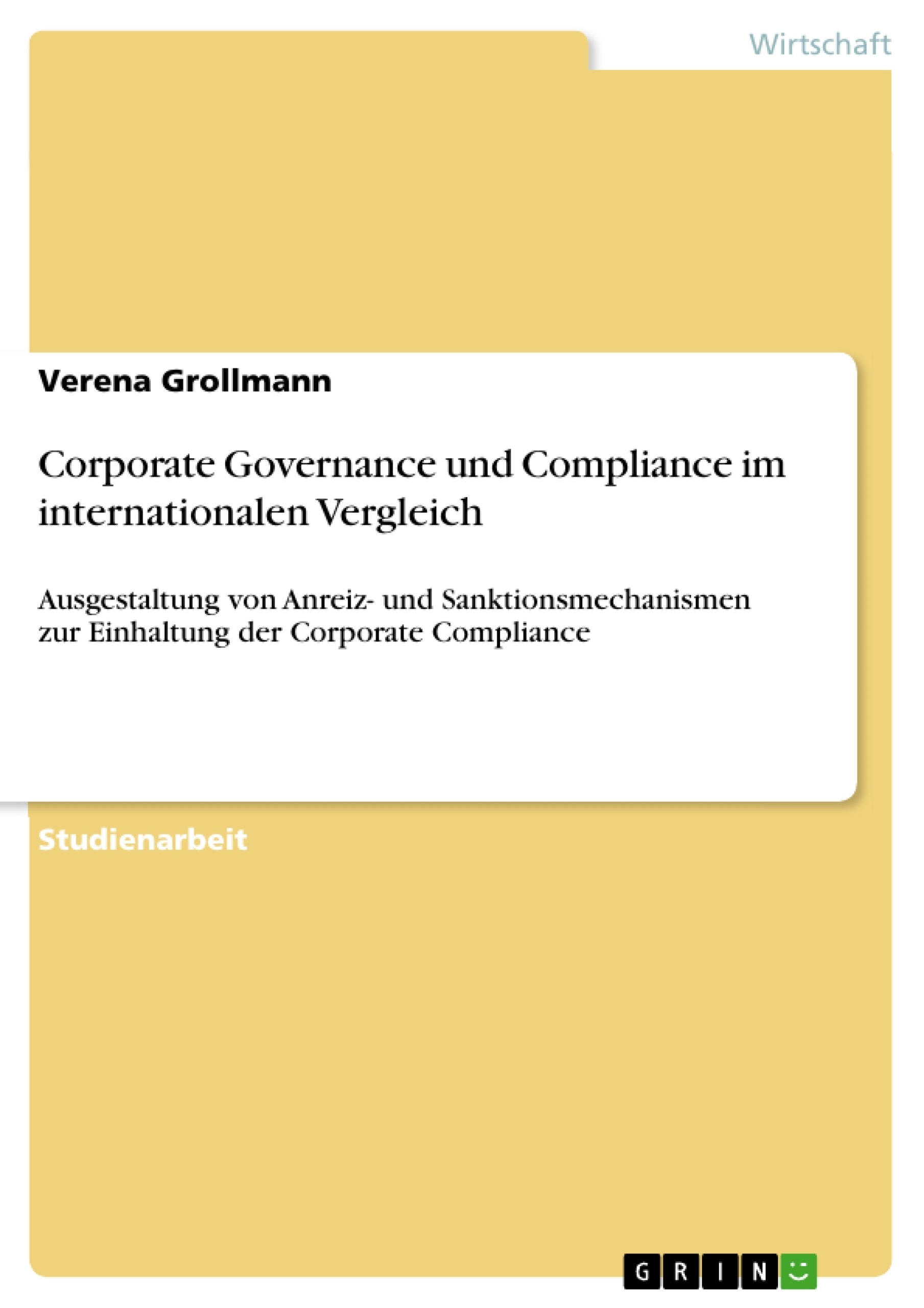Während die Corporate Governance im Sinne einer
Unternehmensverfassung Wettbewerbsnachteile, ausgelöst durch eine zu schwache Regulierung beklagt, wird die Diskussion um die CC von der Annahme einer Überregulierung durch den Staat getrieben. CC sieht auch in unbeabsichtigt regelwidrigem Verhalten von Mitarbeitern und Verstößen von Leitungs- und Aufsichtsorganen ein wirtschaftliches Risiko, sowohl für das Unternehmen, als auch für das Management. Jedoch wird die Auffassung vertreten, dass zumindest ein Teil des wirtschaftlichen Risikos durch entsprechende Compliance-Maßnahmen, wie z.B. Implementierung und Weiterentwicklung von Systemen zur prospektiven Risikofrüherkennung, Mitarbeiterschulungen oder Einrichtung eines
Meldesystems vermieden werden kann (vgl. Hauschka 2007, 3). Im Zuge der Konkretisierung
der Compliance-Funktion durch das EBK-Rundschreiben vom 27. September 2006 fällt die Umsetzung von Compliance-Maßnahmen in den Verantwortungsbereich der Geschäftsführung (vgl. EBK-Rundschreiben 2006, RZ 81; RZ 97). Dies hat den Auf- bzw. Ausbau der Compliance-Abteilungen in deutschen Unternehmen zur Folge. Der Fokus dieser Arbeit soll nun darauf liegen, welche Anreize geschaffen bzw. Sanktionen verhängt werden sollten, um die Einhaltung der CC sicherzustellen. Dazu wird zunächst die Notwendigkeit von Anreiz- und Sanktionssystemen zur Einhaltung der CC herausgestellt (Kapitel 2). Daran anschließend werden Möglichkeiten zur Ausgestaltung von Anreiz- (Kapitel 3) und Sanktionssystemen (Kapitel 4) beschrieben, während nachfolgend Grenzen der Anreiz- und Sanktionssysteme aufgezeigt werden (Kapitel 5). Ein internationaler Vergleich soll im Fazit
aufgegriffen werden und die Arbeit mit einem Ausblick abrunden (Kapitel 6).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Begriff und Bedeutung der Corporate Compliance
- 2 Notwendigkeit von Anreiz- und Sanktionssystemen
- 3 Ausgestaltung von Anreizsystemen
- 3.1 Überblick
- 3.2 Positive Anreize
- 3.2.1 Motive des Unternehmenseigners
- 3.2.2 Materielle Anreize für Mitarbeiter und Manager
- 3.2.3 Immaterielle Anreize für Mitarbeiter und Manager
- 3.3 Negative Anreize
- 4 Ausgestaltung von Sanktionssystemen
- 4.1 Überblick
- 4.2 Staatliche Gewalt
- 4.3 Unternehmensinterne Strafmaßnahmen und organisationsinterne Sanktionen
- 5 Grenzen von Anreiz- und Sanktionssystemen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ausgestaltung und Grenzen von Anreiz- und Sanktionssystemen zur Einhaltung von Corporate Compliance (CC). Sie analysiert die Notwendigkeit solcher Systeme und beleuchtet verschiedene Möglichkeiten ihrer Gestaltung.
- Bedeutung und Definition von Corporate Compliance
- Notwendigkeit von Anreiz- und Sanktionssystemen zur Sicherstellung der CC
- Ausgestaltung von Anreizsystemen (positive und negative Anreize)
- Ausgestaltung von Sanktionssystemen (unternehmensintern und staatlich)
- Grenzen der Wirksamkeit von Anreiz- und Sanktionssystemen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Dieses Kapitel definiert Corporate Compliance und beleuchtet ihre Bedeutung im Kontext internationaler Geschäftspraktiken und gesetzlicher Rahmenbedingungen, unter Bezugnahme auf den Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) und aktuelle Ereignisse wie den Korruptionswahrnehmungsindex.
Kapitel 2: Das Kapitel argumentiert für die Notwendigkeit von Anreiz- und Sanktionssystemen zur Einhaltung von CC, unter Berücksichtigung der Herausforderungen durch menschliches Verhalten und den Mangel an klaren Richtlinien vor dem Rundschreiben der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK).
Schlüsselwörter
Corporate Compliance (CC), Anreizsysteme, Sanktionssysteme, Corporate Governance, Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK), Compliance-Risiken, Rechtsnormen, Unternehmensethik, internationale Vergleiche, EBK-Rundschreiben.
- Citation du texte
- Verena Grollmann (Auteur), 2008, Corporate Governance und Compliance im internationalen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120182