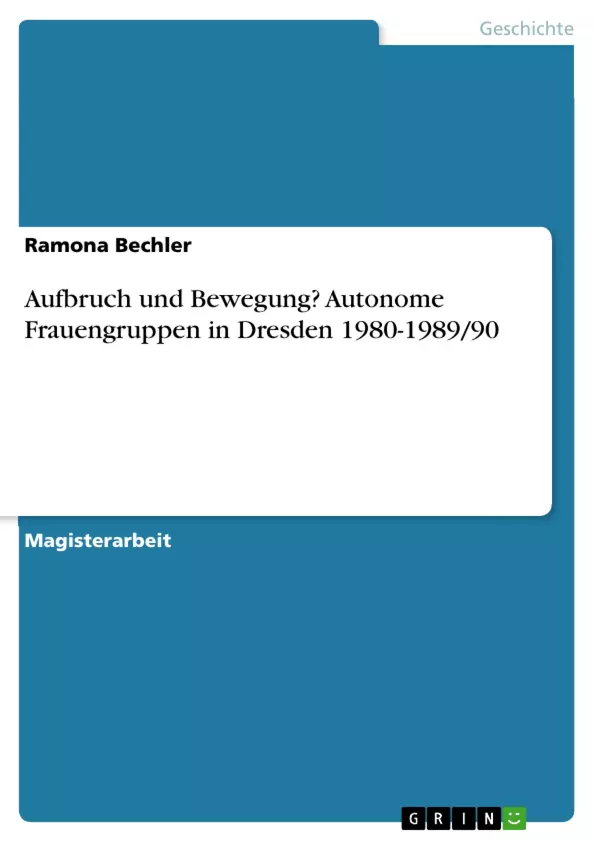Jenseits der einzigen offiziellen Interessenvertretung für Frauen, dem Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD), entstanden in den 1980er Jahren informelle Frauengruppen in verschiedenen Städten und Regionen der DDR. Sie begannen die Stellung von Frau und Mann in der DDR-Gesellschaft zu hinterfragen und die eigene Lebensweise zu reflektieren. Als Gruppen, die sich eigenständig außerhalb des Organisationsmonopols der SED zusammenfanden, bewegten sich die Frauengruppen in einem Konglomerat von Gruppierungen, die Themen aufgriffen, welche im offiziellen Diskurs nicht erwünscht waren.
Informelle Gruppierungen in der DDR sind besonders seit 1990 in den Fokus der historischen Forschung gerückt. Das zentrale Erkenntnisinteresse liegt dabei auf Fragen nach dem Oppositions- und Widerstandspotential dieser Gruppen. Die Existenz separater Frauengruppen findet gleichwohl kaum Erwähnung. Auch Studien, welche sich in den vergangenen Jahren ausführlicher mit Frauengruppen in der DDR befasst haben, setzen ihren Schwerpunkt oft nur bei den Gruppen mit dem Namen „Frauen für den Frieden“, die in verschiedenen Städten der DDR aktiv waren. Anders als die Gesamtdarstellungen zur DDR-Opposition und Bürgerbewegung werfen diese Untersuchungen aber die Frage auf, ob die Frauengruppen der DDR eine Frauenbewegung gebildet haben.
Die Autorin erörtert in ihrer Arbeit zunächst die mit dieser Fragestellung verbundenen theoretischen und methodologischen Probleme – etwa in Hinsicht auf die Anwendung der Begriffe „Neue Soziale Bewegung“ und „Frauenbewegung“ auf AkteurInnen und Prozesse in einer staatssozialistischen Gesellschaft.
Anschließend werden mittels Archivquellen und Zeitzeuginneninterviews fünf Dresdner Frauengruppen, die in den 1980er Jahren aktiv waren, untersucht. Die Untersuchung der Gruppen erfolgt im Hinblick auf deren Entstehung, Gründungsmotive, Aktions- und Kommunikationsformen sowie den Verbleib der Gruppen. Zwei Aspekte werden dabei besonders berücksichtigt. Erkenntnis- und Entwicklungsprozesse der Gruppen beziehungsweise einzelner Frauen in den Gruppen werden beobachtet, um mögliche DDR-spezifische Auffassungen von Geschlechterverhältnissen zu ermitteln. Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage nach einer Frauenbewegung in der DDR wird außerdem untersucht, ob und wie Vernetzung sowie Schaffung einer (Gegen-)Öffentlichkeit unter den spezifischen Bedingungen einer Diktatur auch über Dresden hinaus statt gefunden haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 1.1 DDR-Frauengruppen als soziale Bewegung? – Forschungsansätze
- 1.2 Soziale Bewegung in der Diktatur? – Übertragungsprobleme
- 1.3 DDR-Frauengruppen in bisherigen Untersuchungen
- 1.4 Problemstellung und Quellenbasis
- 2 Historische Kontextualisierung
- 2.1 Frauen und Frauenpolitik in der DDR
- 2.2 Die DDR in den 1980er Jahren
- 3 Autonome Frauengruppen in Dresden
- 3.1 Frauen für den Frieden Dresden
- 3.1.1 Entstehung, Struktur und Arbeitsweise
- 3.1.2 Arbeitsfelder
- 3.1.2.1 Friedensarbeit
- 3.1.2.2 Geschlechterverhältnisse
- 3.1.2.3 Politischer Protest
- 3.1.3 Entwicklung der Gruppe ab 1989
- 3.2 Kirchlicher Arbeitskreis Homosexualität Dresden / Frauengruppe im Kirchlichen Arbeitskreis Homosexualität Dresden
- 3.2.1 Entstehung, Struktur und Arbeitsweise
- 3.2.2 Die Frauengruppe im Kirchlichen Arbeitskreis Homosexualität
- 3.2.2.1 Erkenntnisprozesse
- 3.2.2.2 Dresdner Frauenfeste
- 3.2.2.3 Räume für lesbische Frauen
- 3.2.3 Arbeitskreis und Frauengruppe in der Wende
- 3.3 Frauen für Frauen
- 3.4 Künstlerinnengruppe / Dresdner Sezession '89
- 3.5 Arbeitskreis Feministische Theologie
- 4 Über Dresden hinaus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht autonome Frauengruppen in Dresden zwischen 1980 und 1989/90. Ziel ist es, die Aktivitäten dieser Gruppen im Kontext der DDR-Gesellschaft und -Politik zu analysieren und deren Rolle im Hinblick auf Frauenemanzipation und zivilgesellschaftliches Engagement zu beleuchten. Die Arbeit vermeidet eine einseitige Fokussierung auf Aspekte des Widerstands und berücksichtigt stattdessen die Vielschichtigkeit der Gruppen und ihrer Aktivitäten.
- Autonome Frauengruppen in der DDR
- Frauenemanzipation in der DDR
- Zivilgesellschaftliches Engagement in der DDR
- Der Einfluss der Kirche auf Frauenbewegungen
- Vergleich verschiedener Frauengruppen in Dresden
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und diskutiert Forschungsansätze zu DDR-Frauengruppen als soziale Bewegungen. Kapitel 2 bietet eine historische Kontextualisierung, indem es die Frauenpolitik der DDR und die gesellschaftliche Situation der 1980er Jahre beleuchtet. Kapitel 3 analysiert verschiedene autonome Frauengruppen in Dresden, darunter "Frauen für den Frieden", eine Gruppe im kirchlichen Arbeitskreis Homosexualität, "Frauen für Frauen", eine Künstlerinnengruppe und ein Arbeitskreis Feministischer Theologie, jeweils mit Blick auf Entstehung, Struktur, Arbeitsweise und wichtige Aktivitäten. Kapitel 4 erweitert den Blick über Dresden hinaus.
Schlüsselwörter
Autonome Frauengruppen, DDR, Frauenemanzipation, Frauenpolitik, Zivilgesellschaft, Friedensbewegung, Homosexualität, Künstlerinnengruppe, Feministische Theologie, Opposition, Widerstand, SED, Stasi.
- Citar trabajo
- Ramona Bechler (Autor), 2008, Aufbruch und Bewegung? Autonome Frauengruppen in Dresden 1980-1989/90, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120194