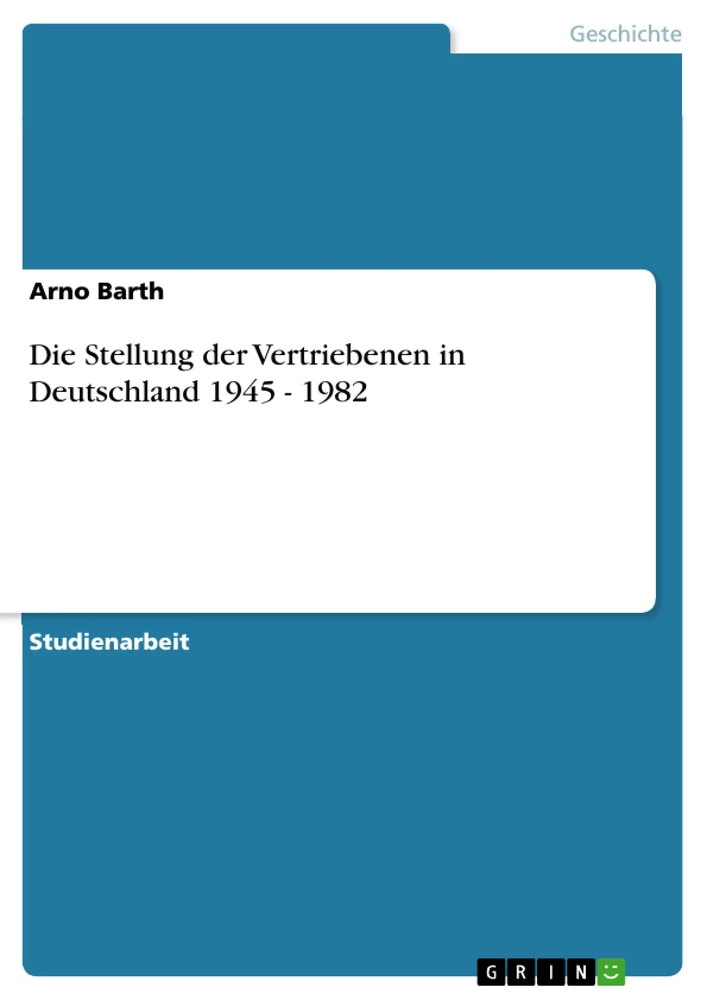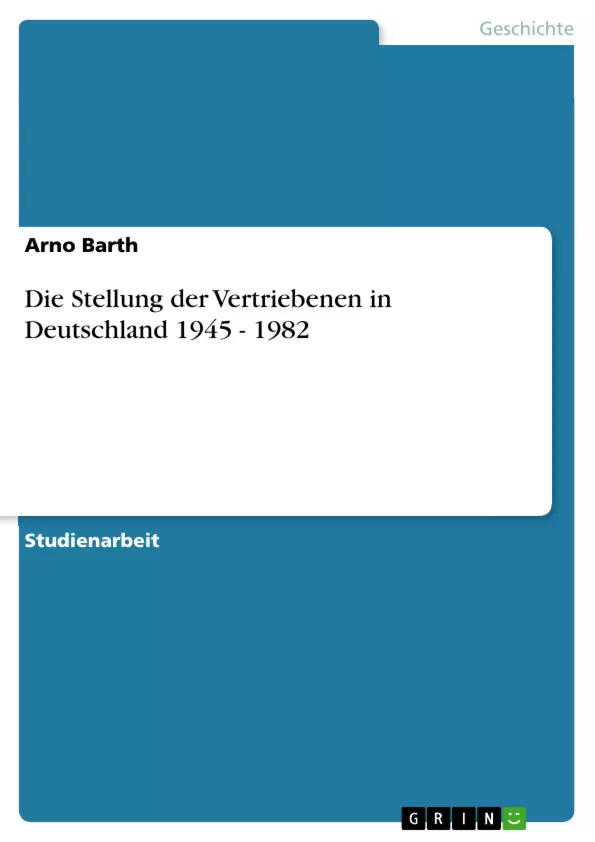Europa befindet sich knapp 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in einer Identitätskrise. Verfassungs- und Vertragswerke der Europäischen Integration stoßen – da wo sie dem Volk zur Abstimmung vorgelegt werden – mehrheitlich auf Ablehnung, die Institutionen der Europäischen Union (EU) sehen sich Akzeptanzproblemen ausgesetzt. Es häufen sich Stimmen, die im unreflektierten Souveränitätstransfer auf eine höhere bürokratische Ebene nicht mehr den Garanten einer gesamteuropäischen Identität sehen. Diese Tendenz rückt die Frage nach einem „geistigen Überbau“, nach der Definition gemeinsamer Kultur, in den Mittelpunkt.
Grundlage jeder Identität ist die Geschichte. Die Verfechter der Europäischen Einigung haben das früh erkannt und versucht geschichtspolitische „Brücken zu bauen“. Sie bemühen dafür die griechische und römische Geschichte der Antike, das karolingische Reich, das Christentum oder die Aufklärung. Kurioserweise werden aber häufig ausgerechnet die letzten 200 Jahre bei der „Europäischen Geschichtsschreibung“ ausgelassen und der klassischen Nationalgeschichtsschreibung überlassen. Der Konflikt zwischen den Nationen und später den Blöcken des 19. und 20. Jahrhunderts hat offenbar zu der Ansicht geführt, die Aufarbeitung und Historisierung sei ebenfalls Sache dieser Einheiten und nicht des Vereinten Europas. Es ist die These des Kulturwissenschaftlichen Institutes (KWI) und seines Direktors Claus Leggewie, dass umgekehrt gerade in der Austragung der erinnerungspolitischen Konflikte, wie sie die letzten Jahrhunderte mit sich brachten, eine gesamteuropäische Identität entsteht.
Diese Arbeit im Rahmen eines Theorieseminars unter dem Dach dieses Institutes soll die Erinnerungspolitik eines dezidierten Konfliktthemas – Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem europäischen Osten – zwischen 1945 und 1982 dokumentieren. Es mag verwundern, dass nicht die aktuelle Diskussion der letzten Jahre zu diesem Thema reflektiert wird. Doch es erscheint mir zielführender, die erinnerungspolitische Auseinandersetzung zunächst an einem abgeschlossenen Zeitraum zu untersuchen und die Erkenntnisse dann auf laufende Prozesse zu übertragen. Der Zeitraum zwischen 1945 und 1982 bietet in Bezug auf Vertriebenenpolitik umfassendes Anschauungsmaterial. Durch Fokussierung auf die beiden deutschen Staaten und insbesondere die verschiedenen Phasen in der Bundesrepublik sollen die unterschiedlichen denkbaren Vorgehensweisen bei der Aufarbeitung und insbesondere deren Zusammenhang zur aktuellen außenpolitischen Lage beleuchtet werden.
Ziel der Arbeit ist es, auf dieser Grundlage zu skizzieren, wie ein deutscher Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur funktionieren könnte.
Wegen des sehr begrenzten Umfangs sollen hauptsächlich zu der formulierten Fragestellung vorhandene Erkenntnisse und Literatur ausgewertet werden. Eine tiefere Analyse unter ausgeprägter Heranziehung von Quellen kann hier nicht geleistet werden. Als weitere platzbedingte Einschränkung muss auf eine Betrachtung der Erinnerungspolitik in den Vertreiberstaaten verzichtet werden. Die europäische Dimension des Themas wird jedoch durch die außenpolitische Einordnung der Vertreibung selbst gewährleistet. Allerdings verstehen sich die im Fazit zu formulierenden Lehren daher „nur“ als Leitlinie für den deutschen Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur. Eine Ergänzung um den Zeitraum seit 1982 und die aktuelle Debatte sowie um die Perspektive eines oder mehrerer Vertreiberstaaten bieten sich für anknüpfende Untersuchungen an.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Flucht und Vertreibung in Ursachen und Ablauf
- III. Vertriebenenpolitik in Deutschland
- a.) Keine Freunde in der DDR
- b.) Viele (falsche?) Freunde in der frühen BRD
- c.) Polarisierung und Bedeutungsverlust
- IV. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, die erinnerungspolitische Auseinandersetzung mit Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem europäischen Osten zwischen 1945 und 1982 zu dokumentieren und zu analysieren. Sie möchte aufzeigen, wie ein deutscher Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur aussehen könnte.
- Die Ursachen und der Ablauf der Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem Osten
- Die unterschiedlichen Phasen der Vertriebenenpolitik in der Bundesrepublik Deutschland
- Die Bedeutung der Erinnerungskultur im Kontext der europäischen Integration
- Die Rolle der Geschichte im Prozess der Identitätsbildung
- Die Einordnung der Vertreibung in den Gesamtkontext der europäischen Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die europäische Identitätskrise im Kontext der Europäischen Integration und stellt die These auf, dass die Aufarbeitung der erinnerungspolitischen Konflikte der letzten Jahrhunderte eine gesamteuropäische Identität fördern kann. Die Arbeit fokussiert dabei auf die Flucht und Vertreibung der Deutschen aus dem europäischen Osten zwischen 1945 und 1982.
Kapitel II analysiert die Ursachen und den Ablauf der Vertreibung. Dabei wird auf die Vorgeschichte im 19. Jahrhundert und die Rolle des Nationalismus hingewiesen. Die Kapitel beleuchtet den Einfluss der "Piasten" und "Jagiellonen" in Polen, die imperialistischen Ziele der Sowjetunion und den Anteil des nationalsozialistischen Regimes an der Auslösung der Vertreibung.
Kapitel III beschäftigt sich mit der Vertriebenenpolitik in Deutschland. Es werden die unterschiedlichen Phasen der Politik in der DDR und der Bundesrepublik Deutschland betrachtet, wobei die Schwerpunkte auf den frühen Jahren der BRD und der Polarisierung sowie dem Bedeutungsverlust der Vertriebenenpolitik liegen.
Schlüsselwörter
Vertreibung, Erinnerungskultur, Europäische Integration, Identitätskrise, Geschichte, Nationalismus, Vertriebenenpolitik, Bundesrepublik Deutschland, DDR, außenpolitische Lage, europäische Dimension.
- Citation du texte
- Arno Barth (Auteur), 2008, Die Stellung der Vertriebenen in Deutschland 1945 - 1982, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120271