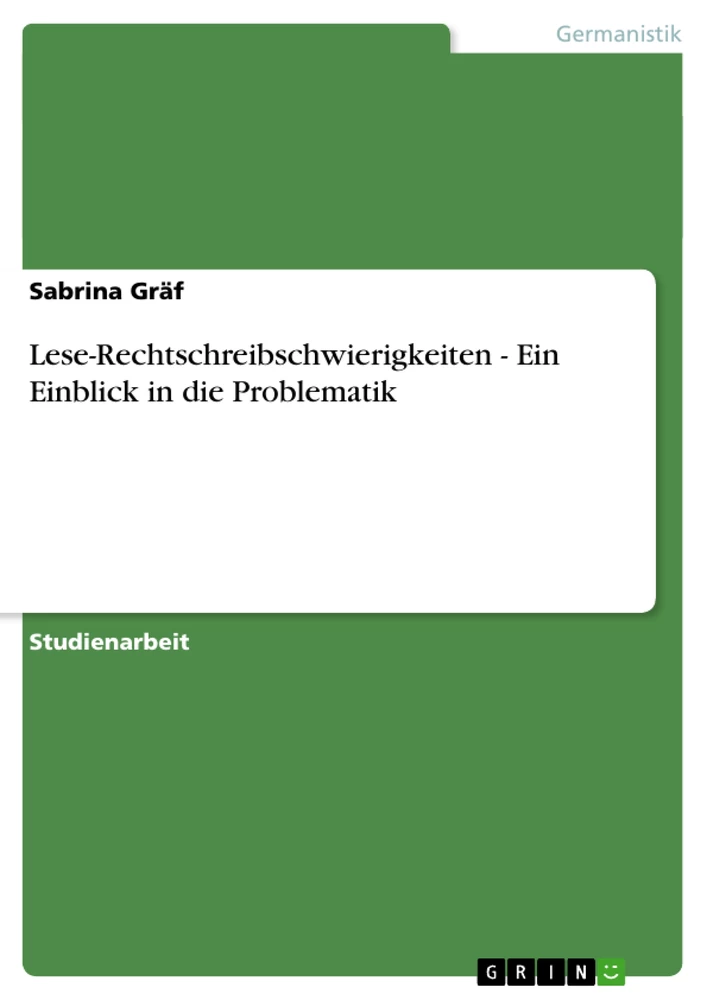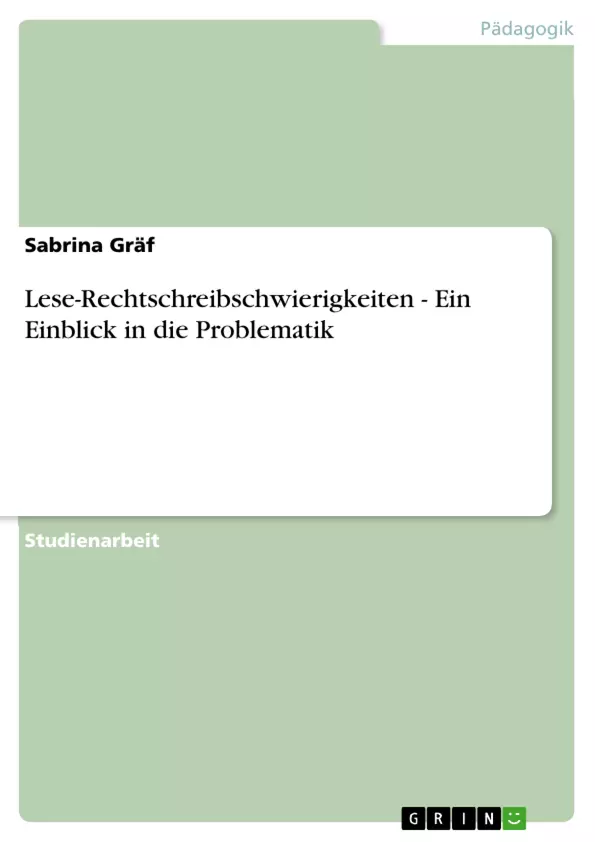Im Rahmen meiner Examensklausur entscheide ich mich für das Thema „Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten“. Aufmerksam geworden bin ich auf dieses Thema durch einschlägige Berichterstattungen in den Medien. Die schlechten Leistungen im Leseverständnis der Schüler und Schülerinnen an deutschen Schulen, die im Rahmen der PISA-Studie erhoben wurden sind erschreckend. In Ländern mit alphabetischem Schriftsystem sind etwa 15% der Schüler LRS-gefährdet und 5-10% von LRS betroffen. Zudem wird immer wieder vehement bemängelt, dass sowohl Lehrkräfte als auch Elternteile viel zu wenig über Störungen im Bereich des Schreiben- und Lesenlernens informiert sind.
Teilleistungsschwächen im Lesen und Rechtschreiben treten relativ häufig auf und bedeuten für die betroffenen Schüler eine schwere Belastung, weil diese Leistungen in unserem Bildungssystem einen hohen Stellenwert haben. Ein Versagen in diesem Bereich kann schwerwiegende Folgen nach sich ziehen und unter Umständen das gesamte Leben des Kindes negativ beeinflussen.
Lernschwierigkeiten treten erstmals in der Grundschule auf und manifestieren sich ab der vierten Klasse, falls nicht interveniert wird. Da LRS äußerst komplexe Lernstörungen sind, die in unterschiedlichen Varianten auftreten, fällt den Primarstufenlehrern eine schwere Aufgabe zu. Sie müssen zum einem Lernschwierigkeiten frühzeitig erkennen und intervenieren zum anderen müssen sie ihren Grundschulunterricht so präventiv wie möglich ausrichten, um LRS vorzubeugen. Dazu ist jedoch eine große Menge an Hintergrundwissen erforderlich.
Mit meiner Arbeit möchte ich versuchen, einen möglichst übersichtlichen Einblick in diese äußerst umfassende Problematik zu gewähren. Einige Bereiche werde ich nur oberflächlich streifen oder weniger exemplarisch darstellen. Um den Teilbereich C3 abzudecken möchte ich das Hauptaugenmerk vor allem auf die Lehr- und Lernprozesse im Deutschunterricht richten. Die Voraussetzungen des Lesen- und Schreibenlernens, der Prozess des Schriftspracherwerbs, die Erlasslage und didaktische Konsequenzen bilden den Schwerpunkt meiner Klausur.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Allgemeine Einführung in die LRS-Problematik
- 1.1 Definitionen und Abgrenzung der Begriffe „Lese-Rechtschreib-Schwäche“ und „Legasthenie“
- 1.2 Grundlegende Voraussetzungen des Lesen- und Schreibenlernens
- 1.3 Schriftspracherwerb und das Verhältnis von Laut und Schrift
- 2. Ätiologie, Symptome und Erscheinungsbilder von LRS
- 2.1 Mögliche Ursachen und Erkennungsmerkmale von LRS
- 2.2 Symptome und Erscheinungsbilder bei LRS
- 3. Diagnose und Analyse von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten
- 4. Prävention bei LRS
- 5. Fördermaßnahmen und didaktische Konsequenzen
- 5.1 Grundlagen der neuen LRS-Erlasse
- 5.2 Didaktische Konsequenzen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS). Ziel ist es, die Problematik von LRS zu beleuchten und wichtige Aspekte des Themas für den Deutschunterricht darzustellen. Der Fokus liegt auf den Lehr- und Lernprozessen, den Voraussetzungen des Lesen- und Schreibenlernens, dem Schriftspracherwerb, der Erlasslage und didaktischen Konsequenzen.
- Definition und Abgrenzung von LRS und Legasthenie
- Ursachen und Erscheinungsbilder von LRS
- Voraussetzungen für erfolgreiches Lesen- und Schreibenlernen
- Prävention und Fördermaßnahmen bei LRS
- Didaktische Konsequenzen für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Relevanz des Themas LRS im Kontext der PISA-Studie und zeigt die Bedeutung frühzeitiger Erkennung und Intervention auf. Kapitel 1 definiert „Lese-Rechtschreib-Schwäche“ und „Legasthenie“ und beschreibt grundlegende Voraussetzungen für das Lesen- und Schreibenlernen. Kapitel 2 befasst sich mit den möglichen Ursachen und Erscheinungsbildern von LRS. Kapitel 3 behandelt die Diagnose und Analyse von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. Kapitel 4 geht auf Präventionsmaßnahmen ein, während Kapitel 5 Fördermaßnahmen und didaktische Konsequenzen im Detail erläutert, inklusive der Grundlagen neuer LRS-Erlasse.
Schlüsselwörter
Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS), Legasthenie, Schriftspracherwerb, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Prävention, Fördermaßnahmen, Didaktik, Deutschunterricht, Lernvoraussetzungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen LRS und Legasthenie?
LRS (Lese-Rechtschreib-Schwäche) wird oft als vorübergehend und umweltbedingt angesehen, während Legasthenie meist als genetisch bedingte, persistierende Störung definiert wird.
Wie verbreitet sind Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten?
In alphabetischen Schriftsystemen sind etwa 15 % der Schüler LRS-gefährdet und 5 bis 10 % tatsächlich von einer ausgeprägten Störung betroffen.
Wann treten erste Anzeichen für LRS auf?
Erste Schwierigkeiten zeigen sich meist schon in der ersten Klasse beim Erwerb der Laut-Buchstaben-Zuordnung und manifestieren sich oft ab der vierten Klasse.
Was sind die didaktischen Konsequenzen für den Deutschunterricht?
Lehrkräfte müssen den Unterricht präventiv ausrichten, individuelle Förderpläne erstellen und gegebenenfalls einen Nachteilsausgleich bei der Leistungsbewertung gewähren.
Welche Rolle spielt die Diagnose bei LRS?
Eine frühzeitige und präzise Diagnose ist entscheidend, um gezielte Fördermaßnahmen einzuleiten und psychische Folgeschäden durch Misserfolgserlebnisse zu vermeiden.
- Citar trabajo
- Sabrina Gräf (Autor), 2004, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten - Ein Einblick in die Problematik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120456