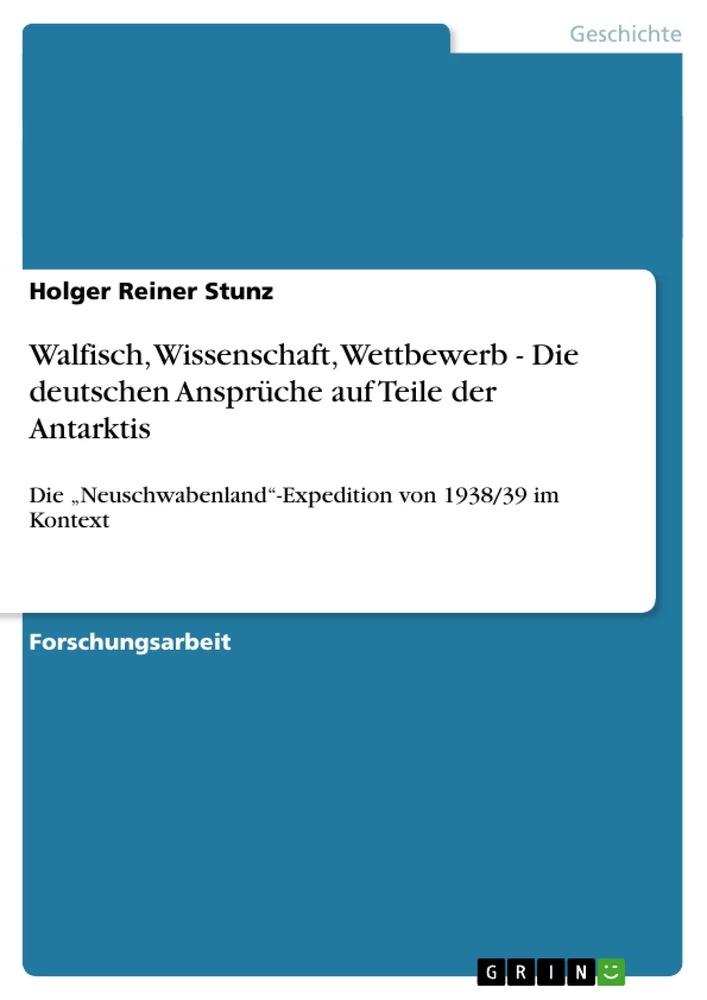Deutsche Ansprüche auf Teile der Antarktis? Was sich auf den ersten Blick wie eine Schnapsidee ausnimmt, hat einen historisch relevanten Kern. Die Aktivitäten deutscher Polarforscher am Südpol gehen bereits ins 19. Jahrhundert zurück. In dieser Studie wird gezeigt, wie die Forschungsleistungen im 20. Jahrhundert politisch instrumentalisiert wurden.
In besonders großem Umfang war dies bei der "Neuschwabenland"-Expedition im Rahmen des Vierjahresplans von Goering der Fall. Was nach außen hin als reine Wissenschaftsunternehmung dargestellt wurde, sollte auch den Großmatgestus des "Dritten Reiches" zum Ausdruck bringen. Nationen, die im Spiel der Verteilung um die polaren Einflusssphären mitspielen, so die Zeitgenossen, sind Weltmächte. In diesem Sinne ist die 1938 begonnene Expedition unter Kapitän Ritscher ein Symbol für deutsches Machtstreben, das sich hinter einer komplexen Forschungsleistung verbirgt.
Die Expedition schrieb Forschungsgeschichte, weil mit Hilfe des Katapultschiffes der Lufthansa, der "Neuschwabenland", Flugzeuge starteten, die dann die neue Methode der Luftkartographie erprobten. Sowohl aus diesen Forschungsleistungen als auch aus dem Abwurf von Hakenkreuzsymbolen sollte das Deutsche Reich seine territorialen Ansprüche geltend machen, die dann auch parallel in einer völkerrechtlichen Fachzeitschrift sondiert wurden. Gerechtfertigt wurde die konzertierte Forschungsaktion auch mit dem "deutschen Fettbedarf" und dem Anspruch auf die damals als Energiequelle ausgebeuteten Wale.
Die Expedition des Jahres 1938/39 wurde nicht nur in einem Jugendbuch verarbeitet und durch eine Forschungsserie dokumentiert, sie sorgte in der frühen Bundesrepublik für Diskussionsstoff im Auswärtigen Amt, das sich dafür entschied, die auf der Exkursion gegebenen Namen im Bundesanzeiger zu nennen und international die deutschen Forschungsleistungen anzuerkennen. Noch in den 1980er Jahren beschäftigte sich ein Forschungsprojekt mit der deutschen Namensgebung in der Antarktis.
Im Zuge der Internationalisierung der Antarktis ist das Projekt des Jahres 1938, das durch eine norwegische Besitzergreifung und deren internationale Anerkennung rasch vereitelt wurde, fast in Vergessenheit geraten. Häufig wird es in wenig seriösen Publikationen als Anlass für Spekulationen über deutsche U-Boote oder eine Flucht Hitlers missbraucht.
In dieser Studie wird in einem seriös erarbeiteten Kontext gezeigt, inwiefern die Forschung für symbolische Politik eingespannt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- I. Deutsche Eisberge? Eine Anfrage kreiert das Problem
- II. Terra Incognita - Die deutschen Forschungsleistungen der Antarktis als Legitimationsmuster
- III. Ein Internationalisierungsversuch und die GAUSS-Expedition der Jahre 1901-1903 als nationales Prestige-Projekt des Wilhelminischen Reiches
- IV. Expedition mit Problemen – die Fahrt der DEUTSCHLAND
- V. By the virtue of discovery - Der völkerrechtliche Modus der Besitzergreifung und die Versailles-Frage aus deutscher Perspektive des Jahres 1938/9
- VI. Die SCHWABENLAND-Expedition, die diplomatischen Implikationen „Antarktis-Projekts\" im Nationalsozialismus und die Rolle des Auswärtigen Amtes
- VII. Häfen, Oasen, U-Boote - Konstrukte um die reichsdeutschen Antarktis-Festung
- VIII. Mythos Walfang - im Nationalsozialismus und in der frühen Bundesrepublik
- IX. Die deutsche Namengebung in der Antarktis als Indikator des deutschen Selbstverständnisses von 1901 bis heute
- X. Heißer und Kalter Krieg – die Antarktis als Spielball der Mächte 1940-1957 - und der ,,Herrligkoffer-Plan“
- XI. Blick nach Norden und Osten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht die deutschen Ansprüche auf Teile der Antarktis, insbesondere im Kontext der Neuschwabenland-Expedition von 1938/39. Sie analysiert die dahinterstehenden Motive und Legitimationsstrategien, betrachtet die Rolle der deutschen Antarktisforschung im 20. Jahrhundert und beleuchtet den völkerrechtlichen Aspekt der konkurrierenden Gebietsansprüche.
- Deutsche Antarktisforschung und ihre Legitimation
- Völkerrechtliche Aspekte der Gebietsansprüche in der Antarktis
- Die Neuschwabenland-Expedition und der Mythos der "deutschen Antarktisfestung"
- Die Rolle Deutschlands im internationalen Wettbewerb um die Antarktis
- Das Selbstverständnis Deutschlands im Kontext der Antarktis
Zusammenfassung der Kapitel
I. Deutsche Eisberge? Eine Anfrage kreiert das Problem: Der einleitende Kapitel beschreibt eine Anfrage des Chicagoer Verlagshauses Compton & Co. an das deutsche Konsulat bezüglich deutscher Gebietsansprüche in der Antarktis im Jahr 1952. Diese Anfrage dient als Ausgangspunkt, um die komplexen völkerrechtlichen und politischen Aspekte der deutschen Ambitionen in der Antarktis zu untersuchen. Der Kontext des Kalten Krieges und des Geophysikalischen Jahres 1957-58, mit seinen zahlreichen Expeditionen und verstärkten Gebietsansprüchen verschiedener Nationen, wird hervorgehoben. Das Kapitel legt den Fokus auf die Motive und Argumentationen hinter der deutschen Auseinandersetzung mit der Frage der Antarktis-Ansprüche.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Deutsche Ansprüche auf die Antarktis"
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Die Studie untersucht die deutschen Ansprüche auf Teile der Antarktis, insbesondere im Kontext der Neuschwabenland-Expedition von 1938/39. Sie analysiert die dahinterstehenden Motive und Legitimationsstrategien, betrachtet die Rolle der deutschen Antarktisforschung im 20. Jahrhundert und beleuchtet den völkerrechtlichen Aspekt der konkurrierenden Gebietsansprüche.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Studie behandelt unter anderem die deutsche Antarktisforschung und ihre Legitimation, die völkerrechtlichen Aspekte der Gebietsansprüche in der Antarktis, die Neuschwabenland-Expedition und den Mythos der "deutschen Antarktisfestung", die Rolle Deutschlands im internationalen Wettbewerb um die Antarktis und das Selbstverständnis Deutschlands im Kontext der Antarktis. Weitere Schwerpunkte sind die verschiedenen deutschen Expeditionen (GAUSS, DEUTSCHLAND, SCHWABENLAND), der Walfang im Kontext des Nationalsozialismus und der frühen Bundesrepublik, die deutsche Namengebung in der Antarktis und der Einfluss des Kalten Krieges auf die Antarktispolitik.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie ist in elf Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Anfrage des Chicagoer Verlagshauses Compton & Co. als Ausgangspunkt der Untersuchung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der deutschen Antarktisgeschichte, beginnend mit der frühen Forschung und den Legitimationsversuchen bis hin zum Kalten Krieg und der heutigen Situation. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen Überblick über die behandelten Inhalte.
Welche Bedeutung hat die Neuschwabenland-Expedition?
Die Neuschwabenland-Expedition von 1938/39 ist ein zentraler Punkt der Studie. Sie untersucht die Motive und die Legitimation dieser Expedition, sowie ihren Einfluss auf den Mythos einer "deutschen Antarktisfestung" und die Rolle des Auswärtigen Amtes. Die völkerrechtlichen Implikationen dieser Expedition werden ebenfalls ausführlich behandelt.
Welche Rolle spielt der Kalte Krieg?
Der Kalte Krieg und das Geophysikalische Jahr 1957-58 spielen eine wichtige Rolle, da sie den Kontext für verstärkte Gebietsansprüche verschiedener Nationen und die erneute Auseinandersetzung mit der Frage der deutschen Antarktis-Ansprüche bilden. Das Kapitel X ("Heißer und Kalter Krieg – die Antarktis als Spielball der Mächte 1940-1957 - und der ,,Herrligkoffer-Plan“) befasst sich ausführlich mit diesem Aspekt.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Studie basiert auf einer umfassenden Recherche, die im Detail nicht im vorliegenden HTML-Auszug genannt wird. Die Quellenlage wird vermutlich aus Archiven, Fachliteratur und ggf. zeitgenössischen Dokumenten bestehen.
Für wen ist diese Studie relevant?
Diese Studie ist relevant für Wissenschaftler, Historiker und alle, die sich für die Geschichte der Antarktisforschung, die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts, Völkerrecht und Geopolitik interessieren.
- Citar trabajo
- Holger Reiner Stunz (Autor), 2008, Walfisch, Wissenschaft, Wettbewerb - Die deutschen Ansprüche auf Teile der Antarktis, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120459