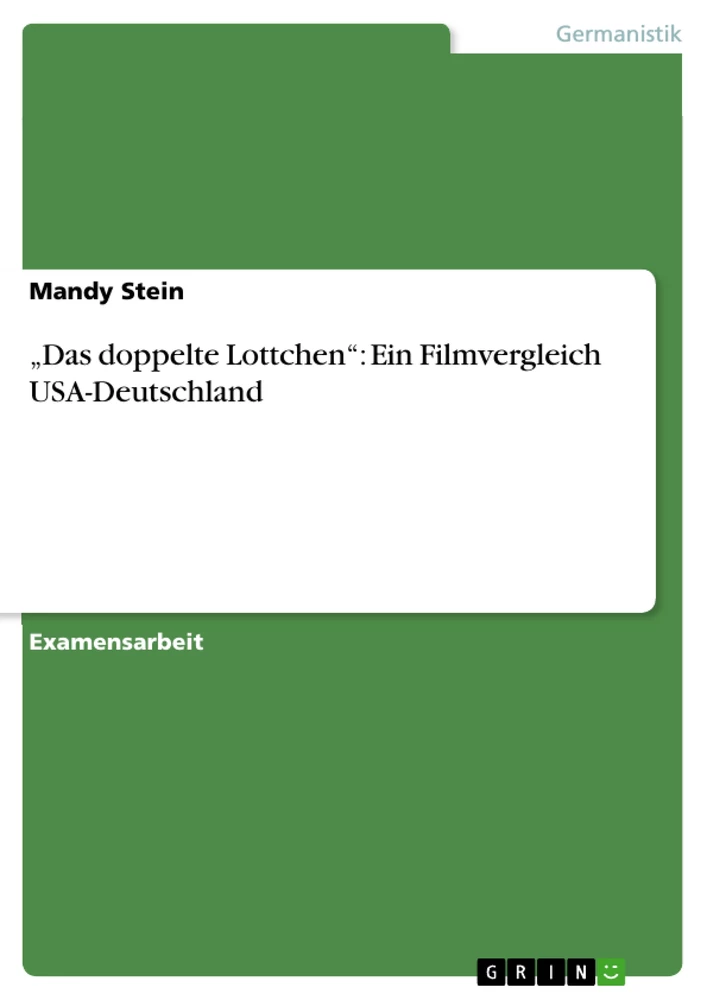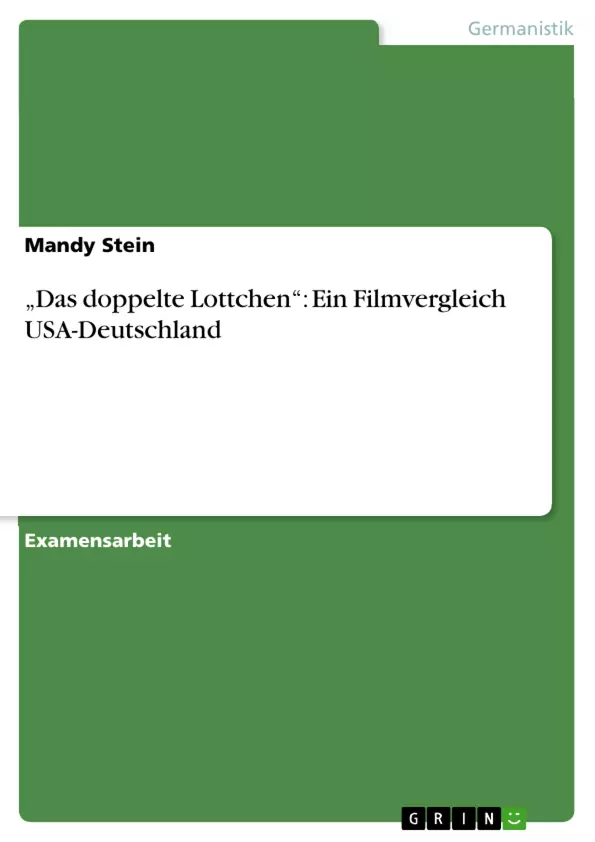Es duftet nach Popcorn, Menschen drängen sich dicht aneinander, Stimmen erfüllen den Raum. Langsam füllt sich der Saal, und das Licht geht aus. Das Reden verstummt, und gebannt starren alle auf die weiße Wand.
Egal ob auf der großen Kinoleinwand oder auf dem heimischen Bildschirm, ob allein, zu zweit, mit der Familie oder Freunden, Filme faszinieren mehr denn je. Angepriesen durch die Medien, gespickt mit den großen Stars aus der Presse und beworben durch Freunde kommt keiner mehr an diesem Medium vorbei. Aber auch der Zuschauer besitzt einen großen Anteil an Einfluss auf die Filmindustrie, entscheidet doch allein sein Geschmack über ‚Top’ oder ‚Flop’.
Doch wie schaffen es die Regisseure immer wieder aufs Neue, durch Geschichten zu fesseln, zu erschrecken, zum Lachen zu bringen oder auch völlig am Zuschauergeschmack vorbei zu erzählen?
Am Beispiel einer der bekanntesten Kindergeschichten Deutschlands, dem „Doppelten Lottchen“ soll gezeigt werden, dass eine Geschichte viele Möglichkeiten bietet, sie zu verfilmen. Die Geschichte von Erich Kästner ist ein beliebtes Kinderbuch in Deutschland und fasziniert klein und groß. Zu erleben, wie zwei Kinder es schaffen mit ihrem Schicksal umzugehen und ihre Eltern „austricksen“ können, um ihnen später zu einem glücklichen Ende zu verhelfen, ist eine mitreißende Geschichte. Ebenso wie der Roman sind die zahlreichen Verfilmungen der Literaturvorlage ein Genuss für die ganze Familie. Natürlich ist nicht jede getreu dem Original, doch allein die Grundhandlung von einem Zwilling, den die geschiedenen Eltern trennten, hat sich auch ‚über den großen Teich’ bis nach Hollywood durchgesetzt und wird heute noch gern als Familienunterhaltung genutzt.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, anhand von ausgewählten Szenen, bestimmte Besonderheiten der Filme vorzustellen aber auch diese nicht außer Acht zu lassen, die dem Zuschauer Probleme beim Verständnis bereiten können. Abschließend erfolgt ein Vergleich der Produktionsländer bezüglich der Herstellung der Filme. Somit soll gezeigt werden, dass die Thematik der Literaturvorlage Kästners in unterschiedlicher Weise verarbeitet werden kann und dennoch nach wie vor den Zuschauer in seinen Bann zieht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Charlie & Louise: Das doppelte Lottchen in Hamburg & Berlin
- 2.1. Der Film und sein Regisseur
- 2.2. Besonderheiten der Verfilmung
- 2.2.1. Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr
- 2.2.1.1. Frau Kröger und Herr Palfy stellen sich vor
- 2.2.1.2. 10 Jahre später - Chaos vs. Ordnungswahn
- 2.2.1.3 Ihr habt doch zwei Kinder!
- 2.2.2. Der Erzähler: Erich Kästners Vermächtnis
- 2.2.2.1. Die moralische Instanz
- 2.2.2.2. Es war so schön: der Erzähler als Weissager
- 2.2.2.3. Die Rolle des Erzählers
- 2.2.1. Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr
- 2.3. Probleme der Verfilmung
- 2.3.1. Erich Kästner als Vorlage
- 2.3.2. Die Zwillinge: Siehst du mich (nicht)?
- 3. Ein Zwilling kommt selten allein: Das doppelte Lottchen in Hollywood & London
- 3.1. Der Film und seine Regisseurin
- 3.2. Besonderheiten der Verfilmung
- 3.2.1. Mrs. James und Mr. Parker stellen sich vor
- 3.2.1.1. 11 Jahre und 9 Monate - eine lange Zeit!
- 3.2.2. Ein besonderer Anfang braucht ein besonderes Ende
- 3.2.2.1. So schön, schön war die Zeit
- 3.2.2.2 Noch einmal! Weil es so schön war
- 3.2.3. Schade, schon vorbei!
- 3.2.1. Mrs. James und Mr. Parker stellen sich vor
- 3.3. Probleme der Verfilmung
- 3.3.1 Wir brauchen dich doppelt: digitale Welt
- 3.3.1.1. Bluescreen und Body Double
- 3.3.1.2. Split Screen und Motion-Control Kamera
- 3.3.2. Schöne heile Welt: Geldsorgen ade
- 3.3.1 Wir brauchen dich doppelt: digitale Welt
- 4. Das Hollywoodschema vs. deutsches Bildungskino
- 4.1. Der "Heros in 1000 Gestalten"
- 4.1.1. Die Abenteuer des "Heros"
- 4.1.2. Der Aufbruch des "Heros"
- 4.1.3. Der Weg der Prüfungen
- 4.1.4. Der "Heros" in Hollywood
- 4.2. Walt Disney: Schöne heile Welt
- 4.3. Deutsches Bildungskino
- 4.4 Das Publikum – hohe Ansprüche vs. Unterhaltungswille
- 4.1. Der "Heros in 1000 Gestalten"
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht zwei Verfilmungen von Erich Kästners „Das doppelte Lottchen“, eine deutsche und eine amerikanische Produktion. Ziel ist es, die unterschiedlichen Inszenierungsansätze und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Zuschauerrezeption zu analysieren. Dabei werden filmtechnische Aspekte ebenso betrachtet wie die Einhaltung bzw. Abweichung von der literarischen Vorlage.
- Vergleich der deutschen und amerikanischen Verfilmung von „Das doppelte Lottchen“
- Analyse der filmtechnischen Umsetzung in beiden Filmen
- Untersuchung der Unterschiede in der Darstellung der Zwillinge
- Bewertung der Relevanz der literarischen Vorlage
- Einfluss der jeweiligen nationalen Filmtraditionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Faszination des Mediums Film. Sie stellt die beiden zu vergleichenden Verfilmungen von Erich Kästners „Das doppelte Lottchen“ vor und skizziert die Zielsetzung der Arbeit: den Vergleich der deutschen und amerikanischen Adaptionen hinsichtlich ihrer Umsetzung und der resultierenden Rezeption. Der Fokus liegt auf der Analyse ausgewählter Szenen, um Unterschiede in der Inszenierung und deren Auswirkungen aufzuzeigen.
2. Charlie & Louise: Das doppelte Lottchen in Hamburg & Berlin: Dieses Kapitel analysiert die deutsche Verfilmung von Joseph Vilsmaier. Es untersucht spezifische Szenen, die von der amerikanischen Version abweichen und beleuchtet die Fragen der Glaubwürdigkeit in der Darstellung der Zwillinge vor ihrer gegenseitigen Wiedererkennung. Der Einfluss von Kästners Roman auf die filmische Umsetzung wird kritisch beleuchtet.
3. Ein Zwilling kommt selten allein: Das doppelte Lottchen in Hollywood & London: Das Kapitel widmet sich der amerikanischen Verfilmung von Nancy Meyers. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Szenen, die sich deutlich von der deutschen Version unterscheiden. Die Arbeit untersucht, wie die Regisseurin mit der Vorlage umgegangen ist und wie diese Umsetzung vom amerikanischen Publikum, im Gegensatz zum deutschen, rezeptiert wurde. Die Nutzung digitaler Effekte und ihre Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit werden kritisch hinterfragt.
4. Das Hollywoodschema vs. deutsches Bildungskino: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Filme im Kontext der jeweiligen nationalen Filmtraditionen. Es werden die Unterschiede in der Erzählstruktur, der Charakterzeichnung und der Gesamtinszenierung untersucht und in Bezug zu den jeweiligen filmischen Konventionen gesetzt. Die unterschiedlichen Ansprüche des Publikums in Deutschland und den USA werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Das doppelte Lottchen, Erich Kästner, Filmvergleich, Deutschland, USA, Joseph Vilsmaier, Nancy Meyers, Filmtechnik, Zuschauerrezeption, Kinderfilm, Verfilmungsstrategien, nationale Filmtraditionen, digitale Effekte, Glaubwürdigkeit.
Häufig gestellte Fragen zu "Das doppelte Lottchen": Ein Filmvergleich
Welche Filme werden in dieser Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht zwei Verfilmungen von Erich Kästners "Das doppelte Lottchen": eine deutsche Produktion von Joseph Vilsmaier ("Charlie & Louise: Das doppelte Lottchen in Hamburg & Berlin") und eine amerikanische Produktion von Nancy Meyers ("Ein Zwilling kommt selten allein: Das doppelte Lottchen in Hollywood & London").
Was ist das Ziel dieser Arbeit?
Das Ziel ist es, die unterschiedlichen Inszenierungsansätze der beiden Verfilmungen zu analysieren und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Zuschauerrezeption zu untersuchen. Dabei werden filmtechnische Aspekte und die Einhaltung bzw. Abweichung von der literarischen Vorlage betrachtet.
Welche Aspekte werden im Vergleich der Filme untersucht?
Der Vergleich umfasst filmtechnische Aspekte wie die Nutzung digitaler Effekte, die Erzählstruktur, die Charakterzeichnung und die Gesamtinszenierung. Es werden Unterschiede in der Darstellung der Zwillinge, der Einfluss der jeweiligen nationalen Filmtraditionen (deutsches Bildungskino vs. Hollywoodschema) und die Relevanz der literarischen Vorlage untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, zwei Kapitel zur Analyse der deutschen und amerikanischen Verfilmung (mit detaillierten Unterkapiteln zu einzelnen Szenen und Aspekten), ein Kapitel zum Vergleich der Filme im Kontext der nationalen Filmtraditionen und ein Schlusskapitel. Zusätzlich enthält die Arbeit ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche konkreten Szenen werden im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert ausgewählte Szenen aus beiden Filmen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Beispiele hierfür sind die Darstellung der Eltern, die Rolle des Erzählers, die Verwendung digitaler Effekte und der Umgang mit der literarischen Vorlage.
Welche Rolle spielt Erich Kästners Roman in der Analyse?
Die Arbeit untersucht kritisch, inwieweit die beiden Verfilmungen die literarische Vorlage von Erich Kästner einhalten oder davon abweichen. Der Einfluss des Romans auf die filmische Umsetzung wird in beiden Kapiteln, die sich mit den einzelnen Verfilmungen beschäftigen, ausführlich beleuchtet.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über die unterschiedlichen Inszenierungsansätze, die Relevanz der literarischen Vorlage und den Einfluss der nationalen Filmtraditionen auf die jeweilige Umsetzung und Rezeption der Filme. Die unterschiedlichen Ansprüche des Publikums in Deutschland und den USA werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Das doppelte Lottchen, Erich Kästner, Filmvergleich, Deutschland, USA, Joseph Vilsmaier, Nancy Meyers, Filmtechnik, Zuschauerrezeption, Kinderfilm, Verfilmungsstrategien, nationale Filmtraditionen, digitale Effekte, Glaubwürdigkeit.
- Citar trabajo
- Mandy Stein (Autor), 2008, „Das doppelte Lottchen“: Ein Filmvergleich USA-Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120520