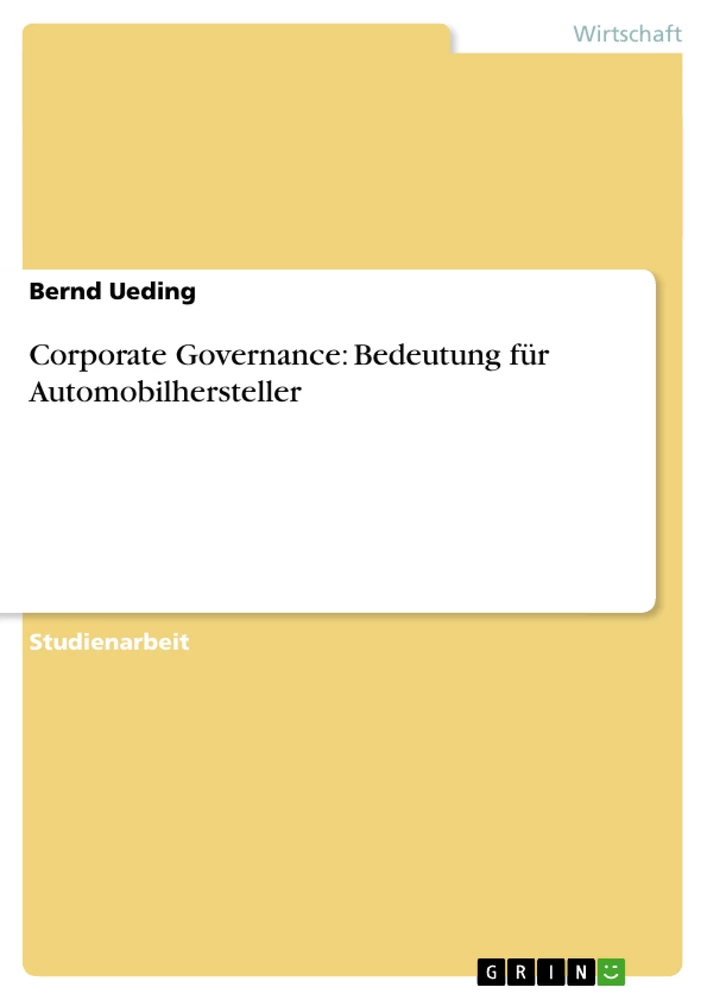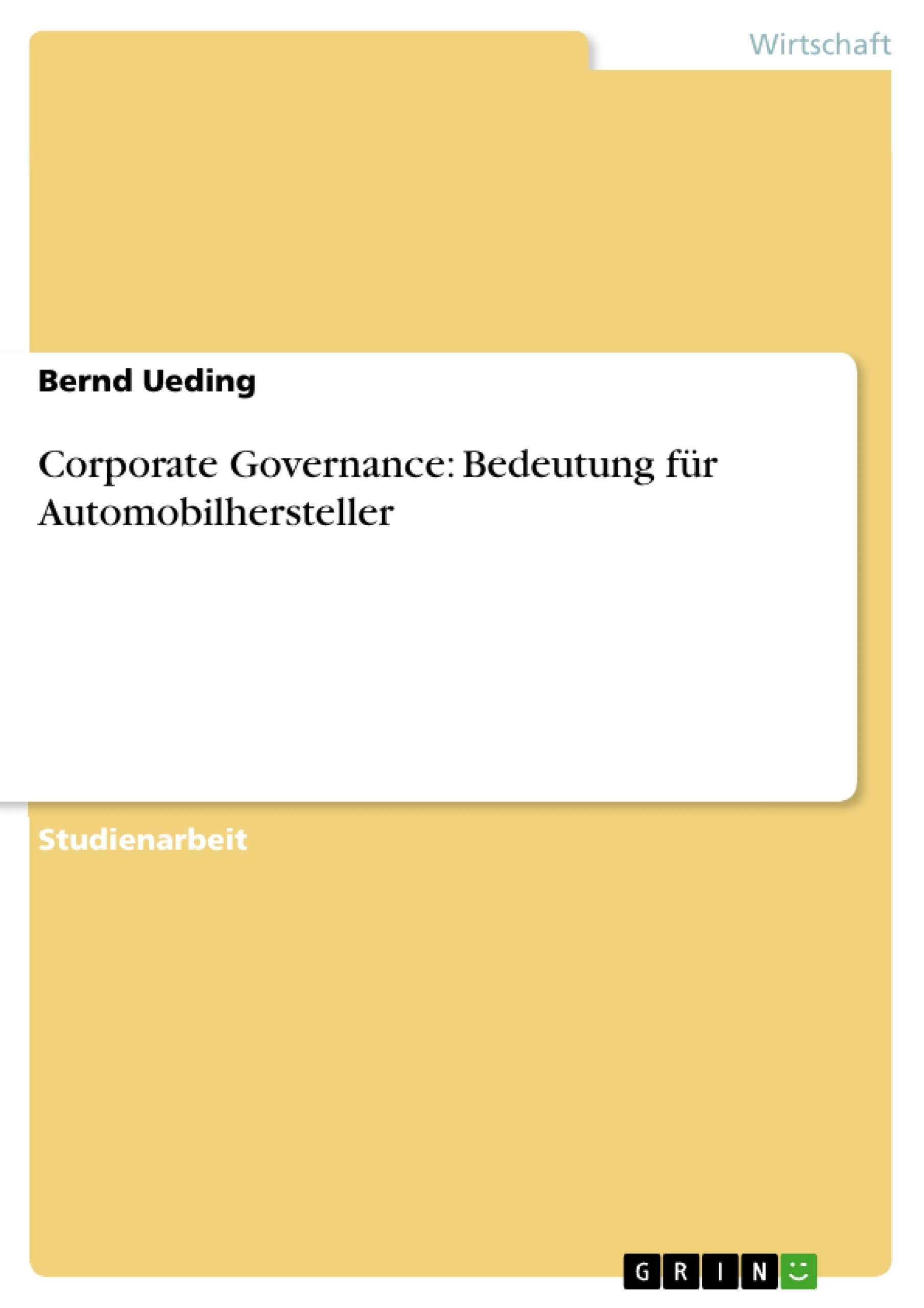Vor dem Hintergrund spektakulärer Unternehmenskrisen werden seit den 1990er Jahren weltweit Standards einer Corporate Governance zur Verbesserung von Unternehmensführung und Unternehmensüberwachung diskutiert und in Empfehlungen oder Rechtsnormen umgesetzt. Auch die Deutsche Bundesregierung hat sich mit diesem Thema befasst und am 26.Februar 2002 den von der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance-Kodex erarbeiteten DCGK erhalten. Dieser stellt ein Regelwerk dar, das vor allem Verhaltensempfehlungen darüber enthält, was eine gute Corporate Governance ausmacht. Mit dieser Seminararbeit soll erörtert werden, was Corporate Governance für die Automobilhersteller bedeutet, wie Corporate Governance von der Automobilwirtschaft umgesetzt wird und weshalb überhaupt eine Notwendigkeit für die Automobilhersteller besteht, die Richtlinien des DCGK umzusetzen. Weiter wird auf die wesentlichen Inhalte des DCGK im Allgemeinen, sowie auf Entwicklungslinien in anderen Branchen eingegangen, was anhand von praktischen Fallbeispielen erläutert werden soll. Der DCGK wird dann noch dem amerikanischen Pendant, dem Sarbanes-Oxley Act, gegenübergestellt, bevor nach einer kritischen Bewertung der Untersuchungsergebnisse eine kurze Zusammenfassung der Arbeit und ein Ausblick in die Zukunft der Corporate Governance folgen wird. Zu Beginn der Arbeit folgt aber im nächsten Kapitel zuerst eine kurze Begriffserklärung und Charakterisierung der Corporate Governance im Allgemeinen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition, Abgrenzung und Charakterisierung
- Definition
- Abgrenzung
- Unterscheidung zwischen enger und weiter Governanceperspektive
- Unterscheidung zwischen interner und externer Governanceperspektive
- Wesentliche Inhalte des Deutschen Corporate Governance-Kodex
- Corporate Governance in den USA
- Der Sarbanes-Oxley Act
- Kritik am Sarbanes-Oxley Act
- Gegenüberstellung des DCGK mit dem amerikanischen SOX
- Notwendigkeit zur Umsetzung und Umsetzung der Corporate Governance in der Automobilwirtschaft
- Beispiel Daimler AG
- Beispiel BMW AG
- Beispiel Volkswagen AG
- Beispiel Ford Motor Company
- Zusammenfassung und Auswertung der Beispiele
- Statistiken zur Corporate Governance
- Entwicklungslinien der Corporate Governance
- Fallbeispiel Daimler AG
- Fallbeispiel Adidas AG
- Fazit der beiden Fallbeispiele
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Bedeutung von Corporate Governance für Automobilhersteller. Die Arbeit erörtert die Umsetzung von Corporate Governance in der Automobilwirtschaft und die Notwendigkeit der Umsetzung der Richtlinien des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK). Vergleichende Analysen des DCGK mit dem amerikanischen Sarbanes-Oxley Act (SOX) sowie Fallbeispiele aus der Automobilindustrie werden präsentiert.
- Definition und Abgrenzung von Corporate Governance
- Analyse des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
- Umsetzung von Corporate Governance in der Automobilindustrie
- Vergleich zwischen DCGK und Sarbanes-Oxley Act
- Fallstudien zur Entwicklung von Corporate Governance
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Corporate Governance ein und beschreibt den Umfang der Arbeit. Kapitel 2 definiert und grenzt Corporate Governance ab, während Kapitel 3 die wesentlichen Inhalte des DCGK darlegt. Kapitel 4 beleuchtet die Corporate Governance in den USA, insbesondere den Sarbanes-Oxley Act und dessen Kritik. Kapitel 5 untersucht die Umsetzung von Corporate Governance bei verschiedenen Automobilherstellern (Daimler, BMW, Volkswagen, Ford) und wertet diese Beispiele aus. Kapitel 6 befasst sich mit relevanten Statistiken. Kapitel 7 analysiert die Entwicklungslinien anhand von Fallbeispielen der Daimler und Adidas AG.
Schlüsselwörter
Corporate Governance, Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK), Sarbanes-Oxley Act (SOX), Automobilindustrie, Daimler AG, BMW AG, Volkswagen AG, Ford Motor Company, Unternehmensführung, Unternehmensüberwachung, Fallstudien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Deutsche Corporate Governance Kodex (DCGK)?
Der DCGK ist ein Regelwerk mit Verhaltensempfehlungen für gute Unternehmensführung und -überwachung, das Transparenz und Vertrauen bei Anlegern fördern soll.
Warum ist Corporate Governance für Automobilhersteller so wichtig?
Aufgrund ihrer Größe, globalen Vernetzung und der hohen Bedeutung für den Kapitalmarkt müssen Automobilhersteller wie Daimler, BMW oder VW hohe Standards erfüllen, um Krisen vorzubeugen.
Was ist der Unterschied zwischen dem DCGK und dem Sarbanes-Oxley Act (SOX)?
Der DCGK basiert primär auf Empfehlungen (Comply or Explain), während der US-amerikanische SOX ein strenges Gesetz mit strafrechtlichen Konsequenzen bei Missachtung ist.
Wie setzen Unternehmen wie die Daimler AG Corporate Governance um?
Unternehmen integrieren die Richtlinien in ihre Satzungen, veröffentlichen jährliche Entsprechenserklärungen und optimieren ihre Kontrollsysteme durch Aufsichtsrat und Vorstand.
Was bedeutet die Unterscheidung zwischen interner und externer Governance?
Interne Governance bezieht sich auf Strukturen innerhalb des Unternehmens (z. B. Aufsichtsrat), während externe Governance Einflüsse von außen (z. B. Wirtschaftsprüfer, Kapitalmarkt) umfasst.
- Citation du texte
- Bernd Ueding (Auteur), 2008, Corporate Governance: Bedeutung für Automobilhersteller, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120621