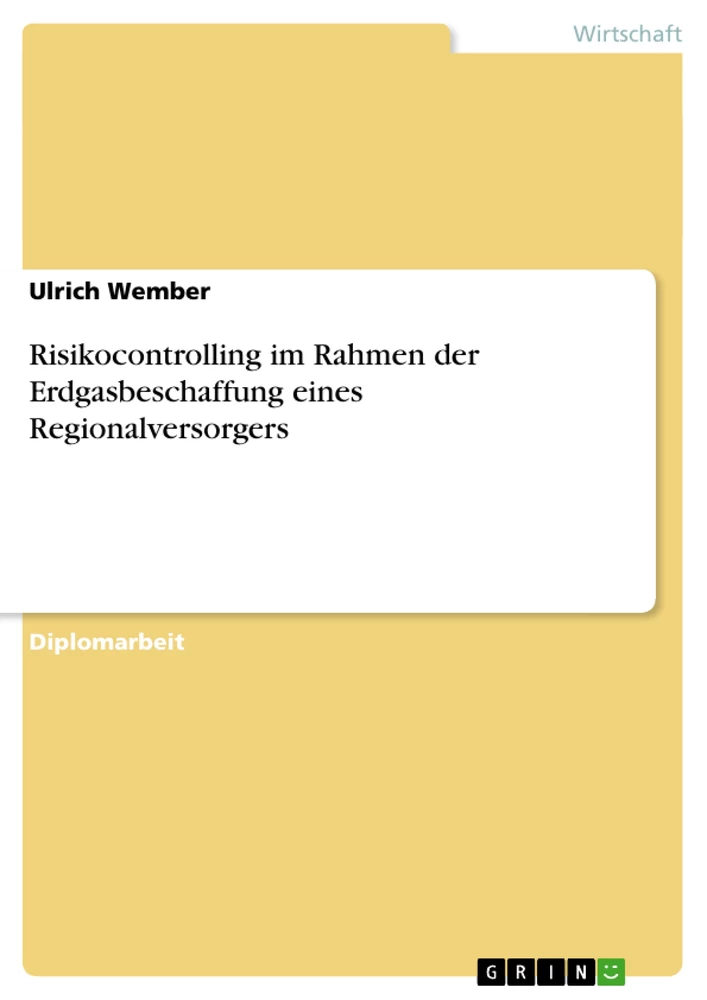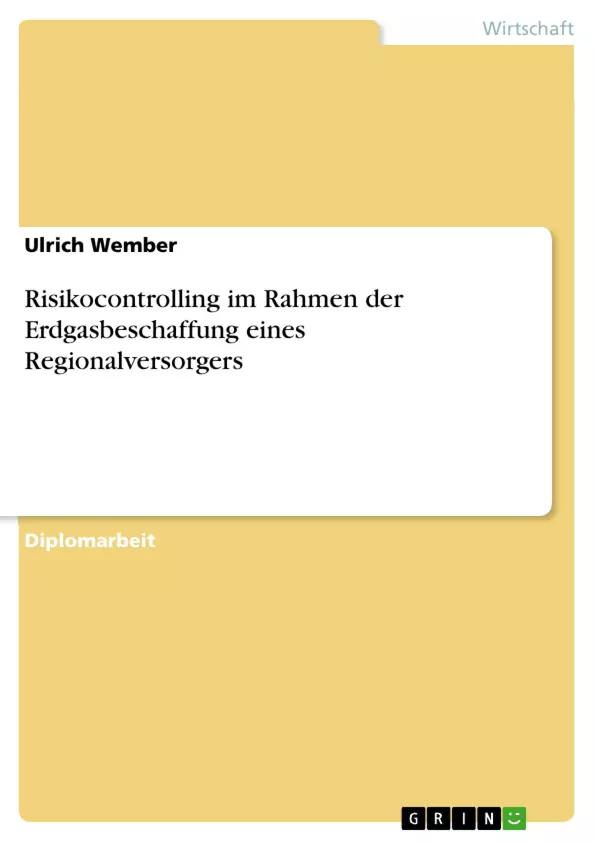Durch die fortschreitende Liberalisierung befindet sich der Markt für Erdgas im Umbruch. Bedingt dadurch, dass in der Vergangenheit Netz und Handel von Erdgas in einer Hand lagen, gab es natürliche (regionale) Monopole der großen Gaskonzerne und Regionalversorger. Heute ist der Markt durch staatliche Eingriffe geprägt. Das Gasnetz und der Gashandel müssen nach der Einführung des Energiewirtschaftsgesetzes und weiterer Gesetze organisatorisch und auch rechtlich getrennt betrachtet werden. Dies bedingt, dass nur noch das Gasnetz ein natürliches, allerdings staatlich reguliertes Monopol ist. Der Gashandel findet sich im freien Wettbewerb wieder. Durch das Aufbrechen dieser alten Marktstrukturen drängen neue Wettbewerber auf den Markt. Parallelen sind hier auf dem deutschen Strommarkt zu sehen, der einen ähnlichen Wandel vollziehen musste und sich immer noch stark in diesem Veränderungsprozess befindet.
All diese Veränderungen bewirken, dass Regionalversorger wie z.B. Stadtwerke umdenken und sich neu strukturieren müssen. Um weiterhin eine gewünschte Handelsmarge erzielen zu können, muss aufgrund der Homogenität und der damit verbundenen Ersetzbarkeit des Produktes vor allem eine Kostensenkungsstrategie verfolgt werden. Zur Verfolgung dieser Strategie sind mehrere Wege denkbar. Grundsätzlich kann entweder der Fixkostenblock des Unternehmens gesenkt werden oder man versucht, die variablen und damit vor allem die Bezugskosten zu senken.
Die Strategie der Fixkostensenkung kann zurzeit vor allem darin beobachtet werden, dass Gasversorger untereinander kooperieren oder sogar fusionieren und sich damit zu größeren Einheiten zusammenschließen um Synergiepotentiale auszuschöpfen.
Um die Bezugskosten und damit die variablen Kosten zu senken, bieten sich durch den Aufbau der neuen Markstrukturen ein Vielfaches mehr an Möglichkeiten als es zuvor gab. Früher war es üblich, dass Regionalversorger vollstrukturiert beliefert wurden, d.h. sie hatten nur einen Bezugsvertrag mit einem großen Anbieter, der sie immer und zu jedem Zeitpunkt mit der benötigten Menge an Erdgas belieferte. Die Kosten des Bezugs wurden in voller Höhe über Tarifpreiserhöhungen oder -senkungen an den Endverbraucher weitergegeben. Es bestand also ein sehr geringes Risiko.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Marktstrukturen in der liberalisierten deutschen Gaswirtschaft
- 2.1 Die Liberalisierung und ihre Auswirkungen auf Transport und Handel
- 2.2 Produkte und Preisbildung an der Börse und im OTC-Handel
- 2.3 Portfoliomanagement im Erdgashandel
- 3 Notwendigkeit von Risikomanagement und -controlling im Erdgashandel
- 4 Ausgestaltung des Risikocontrollings im Erdgashandel
- 4.1 Risikoidentifikation
- 4.1.1 Durchführung einer Marktanalyse
- 4.1.2 Durchführung einer Portfolioanalyse
- 4.1.2.1 Ableitung der Marktpreisrisiken auf das Portfolio
- 4.1.2.2 Identifikation offener Mengenpositionen
- 4.1.2.3 Identifikation von Adressenausfallrisiken
- 4.1.2.4 Risiken aus der Marktliquidität
- 4.2 Risikobewertung
- 4.2.1 Bewertung von Marktpreisrisiken
- 4.2.2 Bewertung des Mengenrisikos
- 4.2.3 Bewertung der Adressenausfallrisiken
- 4.2.4 Bestimmung des Portfoliowertes und der Risikokapitalauslastung
- 4.2.5 Stress-Testing
- 4.3 Risikosteuerung und Überwachung
- 4.3.1 Steuerung von Marktpreisrisiken
- 4.3.1.1 Begrenzung der offenen Positionen
- 4.3.1.2 Steuerung über Limitsysteme
- 4.3.1.3 Optimierung durch derivative Finanzinstrumente
- 4.3.2 Steuerung von Mengenrisiken
- 4.3.2.1 Begrenzung der offenen Positionen
- 4.3.2.2 Optimierung durch derivative Finanzinstrumente
- 4.3.2.3 Aufbau und Nutzung von Flexibilitäten
- 4.3.3 Steuerung von Adressenausfallrisiken
- 4.4 Risikokontrolle
- 4.5 Risikoberichterstattung
- 5 Abschließende Bewertung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Risikocontrolling im Rahmen der Erdgasbeschaffung eines Regionalversorgers im Kontext der liberalisierten deutschen Gaswirtschaft. Ziel ist es, den Risikocontrollingprozess detailliert darzustellen und Möglichkeiten zur Risikosteuerung aufzuzeigen.
- Marktstrukturen und Entwicklungen im liberalisierten Erdgasmarkt
- Risikoidentifikation und -bewertung im Erdgashandel (Marktpreis-, Mengen- und Adressenausfallrisiken)
- Methoden des Risikocontrollings und der Risikosteuerung
- Instrumente zur Risikominderung und -steuerung (z.B. derivative Finanzinstrumente)
- Risikoberichterstattung und -kontrolle
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 bietet eine Einleitung in die Thematik und beschreibt den Wandel des Erdgasmarktes durch die Liberalisierung. Kapitel 2 erläutert die Marktstrukturen, Teilnehmer und Abläufe im liberalisierten Erdgasmarkt. Kapitel 3 begründet die Notwendigkeit eines umfassenden Risikomanagements und -controllings im Erdgashandel. Kapitel 4 bildet den Hauptteil der Arbeit und detailliert den Risikocontrollingprozess: von der Risikoidentifikation (Marktanalyse, Portfolioanalyse) über die Risikobewertung (Marktpreisrisiken, Mengenrisiken, Adressenausfallrisiken) bis hin zur Risikosteuerung und -überwachung sowie der Risikoberichterstattung.
Schlüsselwörter
Risikocontrolling, Erdgasbeschaffung, Regionalversorger, Liberalisierung, Marktpreisrisiko, Mengenrisiko, Adressenausfallrisiko, Risikomanagement, Derivative Finanzinstrumente, Portfolioanalyse, Volatilität, Value-at-Risk, Risikosteuerung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Risikomanagement im Erdgashandel heute so wichtig?
Durch die Liberalisierung des Gasmarktes sind Regionalversorger neuen Wettbewerbs- und Preisrisiken ausgesetzt, die früher durch Monopole abgefedert wurden.
Was ist das Marktpreisrisiko bei der Erdgasbeschaffung?
Es beschreibt die Gefahr von Verlusten durch schwankende Preise an der Börse oder im OTC-Handel während des Beschaffungsprozesses.
Wie können derivative Finanzinstrumente Risiken mindern?
Instrumente wie Termingeschäfte oder Optionen ermöglichen es, Preise abzusichern und Mengenrisiken im Portfolio aktiv zu steuern.
Was versteht man unter Adressenausfallrisiko?
Das Risiko, dass ein Vertragspartner (z.B. ein Lieferant oder Großkunde) seinen Liefer- oder Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt.
Was ist Value-at-Risk (VaR) im Risikocontrolling?
Eine Kennzahl, die den maximalen potenziellen Verlust eines Portfolios innerhalb eines Zeitraums bei einer bestimmten Wahrscheinlichkeit angibt.
- Citation du texte
- Ulrich Wember (Auteur), 2008, Risikocontrolling im Rahmen der Erdgasbeschaffung eines Regionalversorgers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120739