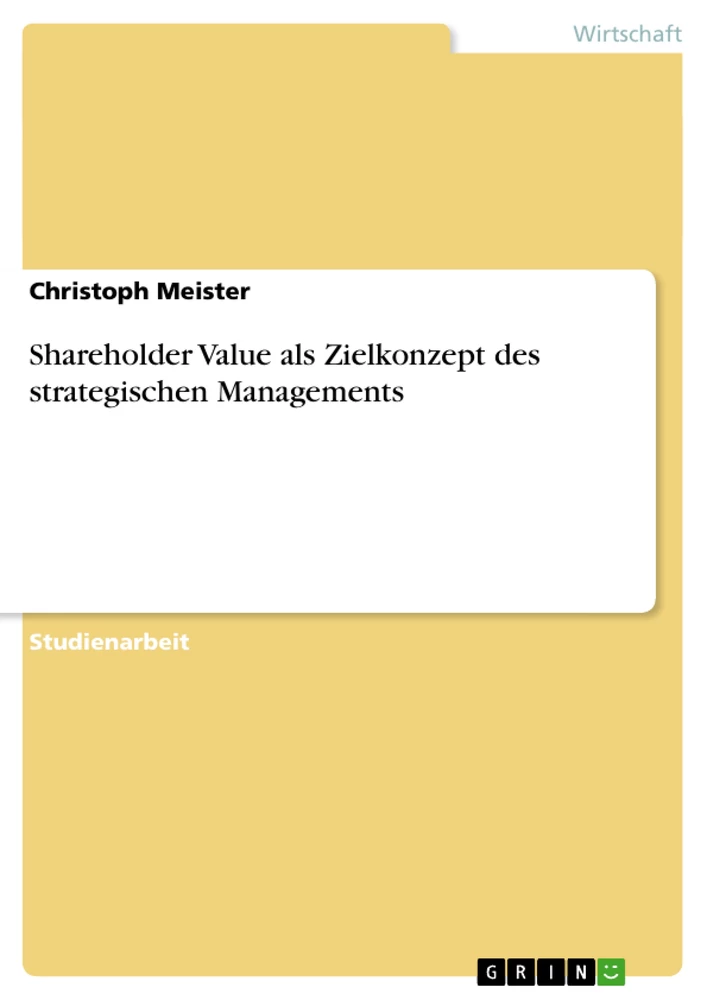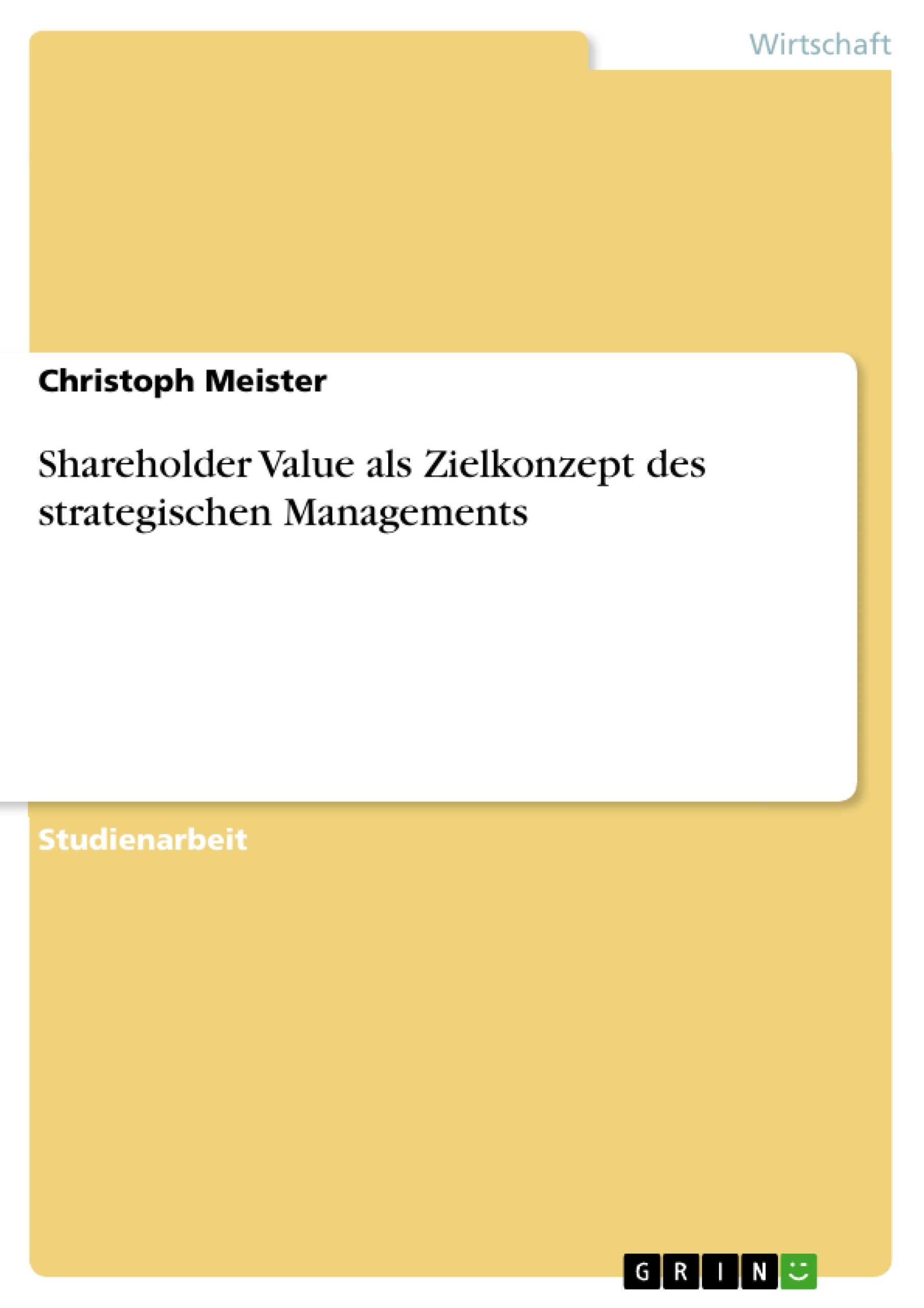Die Debatte um Managergehälter gerät in letzter Zeit immer häufiger in die öffentliche Kritik. So äußerte sich Bundeskanzlerin Merkel auf dem CDU-Parteitag kritisch über die hohen Gehälter und Abfindungen von deutschen Managern1. Gleichzeitig bekräftigte sie, "die Höhe der Managergehälter und der Abfindungen sei Sache der Unternehmen und Ihrer Aufsichtsräte. Einen Maximallohn festzulegen, widerspreche der Vertragsfreiheit."2 Schon die freiwillige Empfehlung der Cromme-Kommission über die Offenlegung von Vorstandsvergütungen führte 2006 erstmals dazu, dass Vorstandsbezüge im Geschäftsbericht von börsennotierten Aktiengesellschaften nun veröffentlicht werden müssen. Doch worin genau liegen die Gründe, dass das Aktiengesetz oder der "Deutsche Corporate Governance Kodex" die Ausgestaltung des Vergütungssystems von Vorstandsmitgliedern in die Hände der Aktionäre, also der Eigentümer, repräsentiert durch den Aufsichtsrat, legen3? [...] Die Arbeit ist im Folgenden derart aufgebaut, dass im zweiten Kapitel die Begriffe Shareholder (Sh.) und Shareholder Value (ShV.) definiert werden und das Konzept in das strategische Management eingeordnet wird. Außerdem soll kurz auf die rechnerische Ermittlung des ShV. eingegangen werden. Während Kapitel 3 sich mit der Abgrenzung des ShV.-Ansatzes zum Stakeholder-Konzept befasst, beginnt mit Kapitel 4 der Hauptteil. Dieses leitet die Legitimation einer Wertorientierung aus einer theoretischen und einer praktischen Warte heraus ab. Hier geht die Arbeit besonders auf die Entstehung des Wertorientierungsgedankens und dessen Logik ein. Eine Verknüpfung des ShV. als Zielkonzept des normativen Managements mit Zielkonzepten des strategischen Managements findet im fünften Kapitel statt. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Zielkonzepten auf Geschäftsfeldebene und solchen auf Unternehmensebene. In Kapitel 6 wird ausgehend von der Principal-Agent-Theory auf die damit einhergehende Auseinandersetzung mit Anreizsystemen eingegangen und hierdurch der Hauptteil der Arbeit abgeschlossen. Insbesondere aufgrund der aktuellen Diskussion über die Höhe von Managergehälter und deren Offenlegung liegt eine Beschäftigung mit diesem Thema nahe, aber auch als Teil des strategischen Managements verdeutlicht das Vergütungssystem die konkretere Implementierung eines Zielkonzeptes auf Basis einer ShV.-Orientierung und verknüpft somit Wert und Strategie. Die vorliegende Arbeit schließt mit der Hervorhebung der Bedeutung des ShV. als Zielkonzept und einer kritischen Würdigung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Shareholder und Shareholder Value
- 2.1 Begriff und Definition
- 2.2 Einordnung im strategischen Management
- 2.3 Rechnerische Ermittlung
- 3. Abgrenzung zum Stakeholder-Konzept
- 4. Theoretische und praktische Legitimation einer Wertorientierung
- 4.1 Der Wertorientierungsgedanke aus theoretischer Warte
- 4.2 Der Wertorientierungsgedanke aus praktischer Warte
- 5. Ableitung von Strategien auf Geschäftsfeld- und Unternehmensebene
- 5.1 Zielkonzepte auf Geschäftsfeldebene
- 5.2 Zielkonzepte auf Unternehmensebene
- 6. Anreizgestaltung als besondere Herausforderung von Principal-Agent-Beziehungen
- 7. Bedeutung und kritische Würdigung des Shareholder Value als Zielkonzept
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Konzept des Shareholder Value im strategischen Management. Sie analysiert die Definition und Einordnung von Shareholder Value, grenzt ihn vom Stakeholder-Konzept ab und beleuchtet die theoretische und praktische Legitimation einer wertorientierten Unternehmensführung. Die Arbeit zeigt zudem die Ableitung von Strategien auf Geschäftsfeld- und Unternehmensebene auf.
- Definition und Einordnung von Shareholder Value
- Abgrenzung zu Stakeholder-Konzept
- Theoretische und praktische Legitimation der Wertorientierung
- Strategie-Ableitung auf Geschäftsfeld- und Unternehmensebene
- Anreizgestaltung im Kontext der Principal-Agent-Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einführung): Die Einleitung beleuchtet die aktuelle öffentliche Kritik an hohen Managergehältern und führt den Shareholder Value als zentralen Aspekt ein, der die Vergütungsstrukturen beeinflusst. Sie beschreibt die Entstehung und Bedeutung des Shareholder Value im Kontext von Übernahmen und Kapitalmarktbedingungen.
Kapitel 2 (Shareholder und Shareholder Value): Dieses Kapitel definiert die Begriffe Shareholder und Shareholder Value und ordnet das Konzept in das strategische Management ein. Es erläutert die rechnerische Ermittlung des Shareholder Value und unterscheidet zwischen Unternehmenswert und Shareholder Value.
Kapitel 3 (Abgrenzung zum Stakeholder-Konzept): Dieses Kapitel vergleicht den Shareholder Value-Ansatz mit dem Stakeholder-Konzept.
Kapitel 4 (Theoretische und praktische Legitimation einer Wertorientierung): Dieses Kapitel befasst sich mit der theoretischen und praktischen Legitimation des Wertorientierungsgedankens und seiner Entstehung.
Kapitel 5 (Ableitung von Strategien): Dieses Kapitel beschreibt die Verknüpfung von Shareholder Value als Zielkonzept mit Zielkonzepten des strategischen Managements auf Geschäftsfeld- und Unternehmensebene.
Schlüsselwörter
Shareholder Value, Shareholder, Stakeholder, strategisches Management, Wertorientierung, Unternehmenswert, Principal-Agent-Theorie, Managergehälter, Aktienkurs, Marktwert, Zielkonzepte.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Shareholder Value?
Es ist ein Konzept der Unternehmensführung, das die Maximierung des Marktwerts des Eigenkapitals und damit den Nutzen für die Aktionäre (Eigentümer) in den Mittelpunkt stellt.
Wie unterscheidet sich der Shareholder- vom Stakeholder-Ansatz?
Während der Shareholder-Ansatz die Eigentümer priorisiert, versucht der Stakeholder-Ansatz, die Interessen aller Bezugsgruppen (Mitarbeiter, Kunden, Gesellschaft) gleichermaßen zu berücksichtigen.
Welche Rolle spielt die Principal-Agent-Theorie hierbei?
Sie erklärt das Spannungsverhältnis zwischen Aktionären (Principals) und Managern (Agents), wobei Anreizsysteme (wie Boni) dazu dienen sollen, die Ziele der Manager an die der Eigentümer zu binden.
Warum stehen Managergehälter oft in der Kritik?
Die Koppelung an den Shareholder Value führt oft zu sehr hohen Vergütungen, was gesellschaftlich kontrovers diskutiert wird, insbesondere wenn Abfindungen trotz Misserfolgs gezahlt werden.
Wie wird Shareholder Value rechnerisch ermittelt?
Meist durch die Diskontierung zukünftiger Cashflows (Discounted Cash Flow Methode), um den aktuellen Barwert des Unternehmens für die Anteilseigner zu bestimmen.
- Quote paper
- Christoph Meister (Author), 2007, Shareholder Value als Zielkonzept des strategischen Managements, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120805