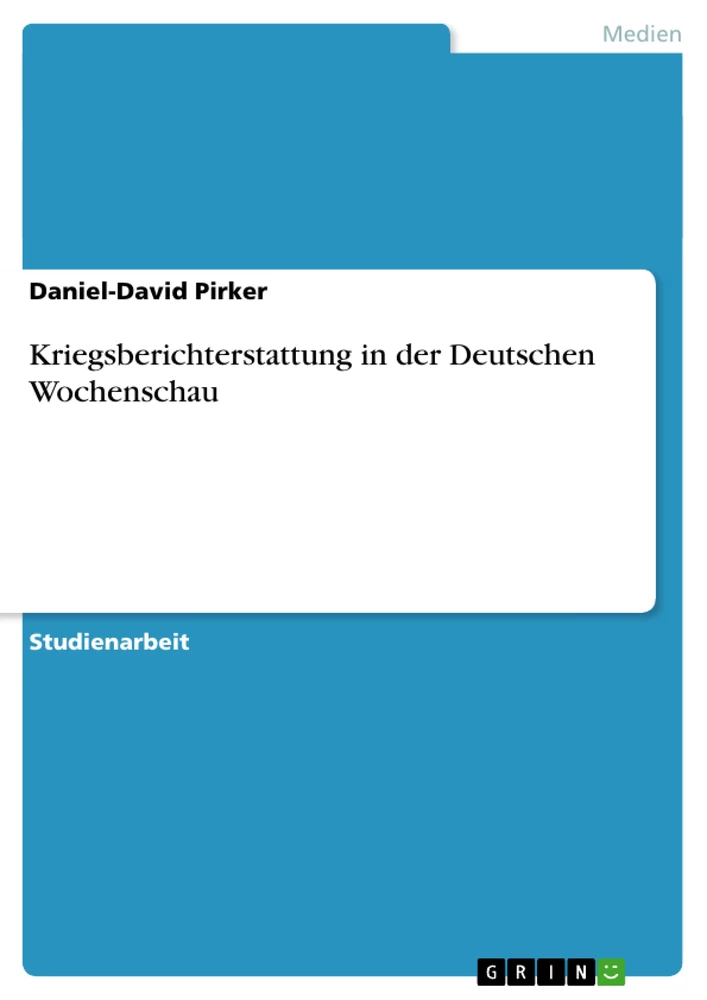Welche Rolle spielte die Wochenschau während des Krieges? Welche Manipulationstechniken wendete sie an, um den Deutschen die vermeitliche Überlegenheit des Nazi-Regimes vorzutäuschen? Wie entwickelte vor allem Propandaminister Goebbels die Wochenschau zu solch einem Werkzeug der Realitätsverfäschung? Diese medienhistorische Ausarbeitung gibt hierzu wissenschaftlich fundierte Antworten. Abschließend regt der Verfasser Pirker den Leser zum kritischen Mitdenken an, und zwar indem er fragt:"Was hat die heutige Entwicklung der Medien mit der nationalsozialistischen Propaganda, symbolisiert durch die Wochenschauproduktion, gemein?"
Einleitung
Meine schriftliche Ausarbeitung des Referats über die Wochenschau im Dritten Reich untergliedert sich in zwei Themenblö>Anschließend befasst sich ein Exkurs mit den sogenannten Propaganda-Kompanien.
Der zweite und dritte Teil beleuchtet die Gestaltungsschwerpunkte zur Verfälschung der Realität während und nach der Aufnahme. Abschließend werde ich in dem Fazit neben einer kurzen Zusammenfassung auch selbst Stellung zum Thema beziehen und dabei einen Vergleich zur heutigen Medienentwicklung wagen.
Historischer Überblick
In den ersten zwei Jahren nach der Machtergreifung interessierten sich die Nationalsozialisten kaum für die Wochenschauproduktion (vgl. Bartels S. 69 f.).
Dies erschließt sich daraus, dass keine Bestimmungen bzw. Erlasse beschlossen worden sind zu dieser Zeit. Auch wurde nicht wesentlich in die Organisation des Wochenschaugeschäfts eingegriffen.
In diesem Kontext ist allerdings zu beachten, dass eine Erfassung und Kontrolle der Wochenschau-Mitarbeiter garantiert war aufgrund der Zwangsmitgliedschaft in der Reichsfilmkammer. Zudem wurden die beiden größten Wochenschauserien Ufa-und Deulig-Tonwoche von dem Ufa-Konzern vertrieben, der sich dem neuen Regime anzupassen versuchte (vgl. Bartels S. 69 f.). Daneben erschienen nur noch die Bavaria-und Tobis-Tonwoche sowie die Fox-Tönende Wochenschau (vgl. Moeller 366). Diese Wochenschauen wurden jedoch vergleichsweise nur wenig vertrieben (vgl. Bartels 69 f.).
Mit der Gründung des Deutschen Film-Nachrichtenbüros im Mai 1935 wurde der Wochenschauproduktion von Seiten der Nationalsozialisten schließlich höherer Stellenwert eingeräumt ( vgl. Moeller S.365). Hauptaufgabe des „Büro Weidemann“, wie das Nachrichtenbüro auch nach seinem Leiter genannt wurde, lag in der staatlichen Kontrolle der Wochenschauen (vgl. Bartels S.79 und Moeller S. 365). Nunmehr wurden Themen „von außen“ generell vorgegeben. Außerdem oblag es dem Büro die vier verschiedenen Wochenschauen zu koordinieren und den Inhalt sowie die künstlerische Gestaltung zu überwachen (vgl. Moeller S.365 f.). Hier entwickelte sich die Nachzensur als hilfreiches Instrument, die Wochenschauen in eine gewollte Richtung laufen zu lassen ohne detailliert in die Gestaltung eingreifen zu müssen (vgl. Moeller S.366 und Bartels S.121 f.).
Im Oktober 1938 wurden einige Richtlinien verordnet (vgl. Moeller S.370). So mussten ab diesem Herbst die Wochenschauen zu Beginn jeder Vorstellung vorgeführt werden. Auch wollte man die Kinobesitzer motivieren, die jeweils aktuelle Wochenschau zu präsentieren, indem die Vorführung kommerziell lohnenswerter wurde. Daneben setzte man vage Richtlinien zur Gestaltung durch. Die Schwerpunkte sollten auf Heroismus und Ernsthaftigkeit verlagert werden (vgl. Moeller S.370). Zudem wurde im Rahmen des Verordnungspakets festgesetzt, dass die finanzielle Situation verbessert werden sollte. Hierzu richtete man einen Fonds ein, in dem die Wochenschauproduktionsfirmen ihre Mehreinnahmen einzahlen mussten. Ein großer Teil dieser Gelder floss in die Nachfolgeinstitution des Nachrichtenbüros – der Wochenschauzentrale (vgl. Bartels S. 207 f.).
Die Zentrale wurde auch wegen immer wieder aufkommender Kritik von Hitler im Januar 1939 ins Leben gerufen (vgl. Moeller S. 370). Im Rahmen der Neuorganisation sollte die eigentliche Gestaltung der Wochenschauen zwar bei den jeweiligen Wochenschauabteilungen bleiben. Die Eingriffsmöglichkeiten der Nazis sollten sich allerdings verschärfen. So plante, entwarf und verteilte die beim Propagandaministerium angesiedelte Wochenschauzentrale die aufzunehmenden Sujets mit den Wochenschauleitern (vgl. Moeller S. 371).
Durch dieses viel frühere Eingreifen in die Produktion und die zentral gelenkte Überwachung der Wochenschauen wurden die Filmfirmen entgültig entmachtet (vgl. Bartels S. 170).
Ab September 1939 stockte man die Kopienzahl drastisch auf und erhöhte die Streifenlänge, also die Spieldauer. Sie lag vor Kriegsausbruch noch bei 10-15 Minuten und steigerte sich schließlich zwischen 1940 und 1942 auf fast 30 Minuten (vgl. Moeller S. 374 f. und Bartels S. 209). Dies ist auch mit der seit Kriegsausbruch sprunghaft steigenden Kinobesucherzahl zu erklären (vgl. Bartels S. 210 f.). Denn nach den schnellen Erfolgen der Wehrmacht würden sich die Zuschauer vor allem für die Kriegsberichte der Wochenschau interessieren, konnte man zumindest der nationalsozialistischen Presse entnehmen (Hoffmann S. 11). Dies veranlasste das Propagandaministerium anzuweisen, Spielfilme schrittweise aus dem Programm zu nehmen (vgl. Bartels S.210-212). Die hohe Besucherzahl begünstigte auch die Einrichtung eigener Wochenschaukinos ab Mai 1940. Sie führten in Großstädten täglich von 10 Uhr bis 22 Uhr zwei aktuelle Wochenschauen pro Stunde vor (vgl. Moeller S. 375 und Bartels S. 211).
Der erhöhte Stellenwert der Wochenschau drückte sich ferner in einer Verordnung zur Veränderung des Vorführmodus aus. Mit der Neuregelung wollte man gewährleisten, dass sich alle Kinobesucher das Vorprogramm mit der Wochenschau ansahen – auch die sie sich ihr entziehen wollten. Dies wollte man bewerkstelligen, indem die Besucher nach Vorstellungsbeginn den Kinosaal weder betreten noch verlassen durften (vgl. Moeller S. 375 und vgl. Bartels S. 213).
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Text über die Wochenschau im Dritten Reich?
Der Text gibt einen Überblick über die Wochenschau im Dritten Reich, insbesondere wie die Nationalsozialisten die Wochenschau zur Propaganda nutzten. Er behandelt die Entwicklung von der anfänglichen Desinteresse bis zur vollständigen Kontrolle durch das Propagandaministerium.
Was war das Deutsche Film-Nachrichtenbüro und welche Rolle spielte es?
Das Deutsche Film-Nachrichtenbüro, auch "Büro Weidemann" genannt, wurde im Mai 1935 gegründet und hatte die Aufgabe, die Wochenschauen staatlich zu kontrollieren. Es gab Themen vor, koordinierte die verschiedenen Wochenschauen und überwachte Inhalt und Gestaltung.
Was änderte sich mit der Gründung der Wochenschauzentrale im Jahr 1939?
Die Wochenschauzentrale wurde im Januar 1939 gegründet, um die Kontrolle über die Wochenschau weiter zu verschärfen. Sie plante, entwarf und verteilte die Sujets für die Wochenschauen in Zusammenarbeit mit den Wochenschauleitern, wodurch die Filmfirmen weiter entmachtet wurden.
Wie wirkte sich der Krieg auf die Wochenschau aus?
Mit Kriegsbeginn wurden die Kopienzahl und die Spieldauer der Wochenschauen drastisch erhöht. Es wurden auch Wochenschaukinos eingerichtet, und die Kinobesucher durften den Saal nach Vorstellungsbeginn nicht mehr verlassen, um sicherzustellen, dass alle die Wochenschau sahen. Zudem gab es Konflikte zwischen dem Oberkommando der Wehrmacht (OKW) und dem Propagandaministerium über die Kompetenzen in Bezug auf die Kriegsberichterstattung.
Welche Rolle spielte die Reichsfilmkammer?
Die Zwangsmitgliedschaft in der Reichsfilmkammer garantierte die Erfassung und Kontrolle der Wochenschau-Mitarbeiter.
Wie funktionierte die Nachzensur?
Die Nachzensur diente als Instrument, um die Wochenschauen in eine gewünschte Richtung zu lenken, ohne detailliert in die Gestaltung eingreifen zu müssen.
Welche Richtlinien wurden im Oktober 1938 verordnet?
Ab Herbst 1938 mussten die Wochenschauen zu Beginn jeder Vorstellung vorgeführt werden. Die Gestaltung sollte Heroismus und Ernsthaftigkeit betonen. Außerdem sollte die finanzielle Situation der Wochenschauproduktionsfirmen verbessert werden.
- Quote paper
- Daniel-David Pirker (Author), 2005, Kriegsberichterstattung in der Deutschen Wochenschau, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120823