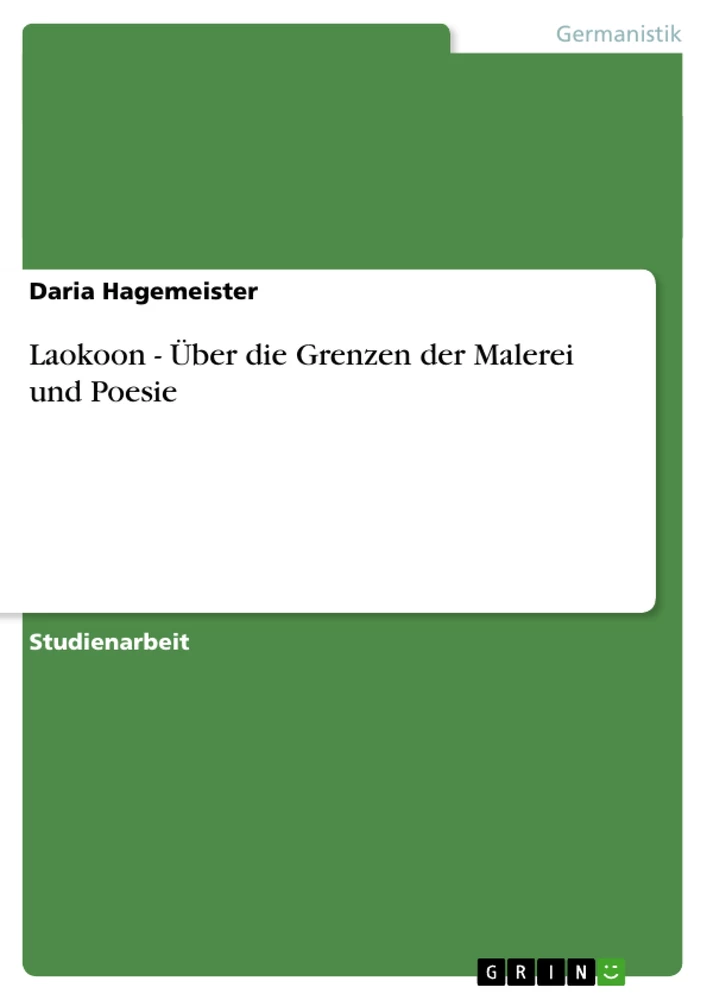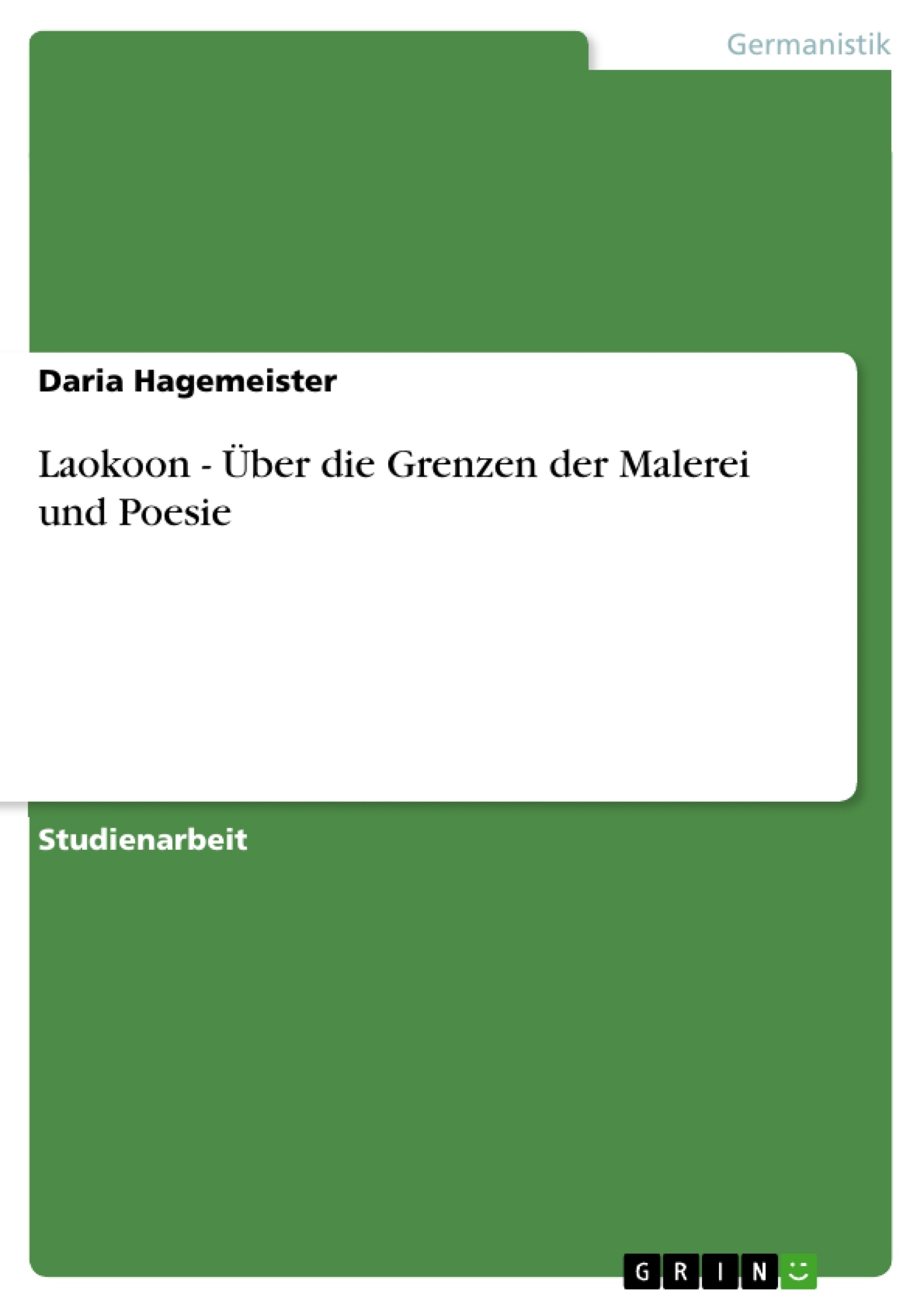Die Wesensbestimmungen sind der Ausgangspunkt für Lessings Postulate. Die Malerei und Plastik einerseits, als räumlich-zeitlich fixierte Kunst, die Koexistierendes darstellt und die Dichtung andererseits, als transitorische Kunst, die Konsekutives beschreibt. In der bildenden Kunst muss der prägnante und fruchtbare Augenblick gewählt werden. Die Einbildungskraft ergänzt den zeitlichen Verlauf. Der gewählte Augenblick muss schön sein, während in der Dichtkunst der gewählte Moment nicht schön sein muss. Wichtig ist die Wirkung auf den Rezipienten, denn die bildende Kunst arbeitet mit natürlichen Zeichen. Die Dichtung hingegen verwendet Worte, welche aber willkürliche Zeichen darstellen. Die Hässlichkeit wird daher durch die Worte abgeschwächt. Das Ekelhafte jedoch ist verboten, denn die Empfindung von Ekel ist immer Natur und niemals Nachahmung.
Von den bildenden Künsten fordert Lessing eine „rührende Verbindung von Schmerz und Schönheit“, welche Forderung er in der Laokoon-Gruppe verwirklicht sieht. Die Wirkung auf den Betrachter ist das Gefühl der Sympathie. Auch für Winckelmann muss sich eine „schöne Seele“ mit einer schönen Form verbinden.
Was die Dichtung anbelangt, so darf moralisch Hässliches das ästhetische Mitleid nicht verhindern. Das Drama ermöglicht die größtmögliche Illusion. Die „Täuschung“ ist Voraussetzung für das ästhetische Mitleid. Mitleid ist die innere Identifizierung mit dem Helden. Die Katharsis ist die Läuterung und diese kann nicht durch Furcht und Schrecken erreicht werden, sondern durch Identifikation und das daraus resultierende ästhetische Mitgefühl, das gleichzeitig ein ethisches ist. Das Resultat ist ein Wechselspiel zwischen moralischer und ästhetischer Identifizierung. Das Drama hat diese Wirkungsabsicht. Das Drama, welches eine Zwischenstellung zwischen Poesie und Malerei einnimmt, kommt daher der Natur sehr nahe. Augen und Ohren werden dadurch aber auch leichter beleidigt. Da sich die geistige Aussage mit einer bewegten Verlebendigung verbindet, kann nur das Drama eine totale Katharsis bewirken. Wenngleich auch die bildenden Künste technisch schwerer - oder besser gesagt - schwieriger sind, so ist doch bei der Dichtung die geistige Leistung höher und auch die Originalität.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Laokoon - oder über die Grenzen der Malerei und Poesie
- Aufbau
- Entstehung
- Wirkung
- Relation zu Raum und Zeit
- Wesensbestimmung
- Die „einfache“ und „doppelte“ Nachahmung
- Regeln der Rezeption
- Die Frage nach dem Geschmack
- Die Laokoon-Debatte
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Gotthold Ephraim Lessings "Laokoon - oder über die Grenzen der Malerei und Poesie". Die Arbeit untersucht den Aufbau, die Entstehung und die Wirkung des Werkes im historischen Kontext, beleuchtet Lessings Auseinandersetzung mit der Ästhetik der bildenden und der Dichtkunst und geht auf die Rezeptionsgeschichte des "Laokoon" ein.
- Untersuchung des Aufbaus und der Entstehungsgeschichte von Lessings "Laokoon"
- Analyse der Lessingschen Unterscheidung zwischen Malerei und Poesie
- Die Rolle von Raum und Zeit in der Darstellung von Kunst
- Rezeption und Wirkung des "Laokoon" im Laufe der Geschichte
- Lessings Auseinandersetzung mit Winckelmann und die daraus resultierende Debatte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Laokoon-Gruppe. Der zweite Abschnitt, der Hauptteil der Arbeit, analysiert Lessings "Laokoon". Es wird der Aufbau des Werkes als Sammlung von Aufsätzen erläutert, die Entstehungsgeschichte im Kontext des Briefwechsels mit Mendelssohn und Lessings Auseinandersetzung mit Winckelmann beleuchtet. Weitere Unterkapitel behandeln Lessings Konzepte der "einfachen" und "doppelten" Nachahmung sowie seine Überlegungen zu Raum, Zeit und den Regeln der Rezeption. Der dritte Abschnitt befasst sich mit der "Laokoon-Debatte" und deren verschiedenen Positionen. Die Zusammenfassung (Kapitel 4) wird in dieser Vorschau nicht berücksichtigt, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Gotthold Ephraim Lessing, Laokoon, Malerei, Poesie, Ästhetik, Raum, Zeit, Nachahmung, Rezeption, Winckelmann, Kunsttheorie, klassische Kunst, "einfache Nachahmung", "doppelte Nachahmung".
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von Lessings „Laokoon“?
Lessing untersucht die Grenzen zwischen der Malerei (bildende Kunst) und der Poesie (Dichtkunst) und wie diese mit Raum und Zeit umgehen.
Wie unterscheiden sich Malerei und Poesie laut Lessing?
Die Malerei stellt koexistierende Dinge im Raum dar, während die Poesie konsekutive (aufeinanderfolgende) Handlungen in der Zeit beschreibt.
Was versteht Lessing unter dem „prägnanten Augenblick“?
In der bildenden Kunst muss der Moment gewählt werden, der am meisten Raum für die Einbildungskraft des Betrachters lässt, um den zeitlichen Verlauf zu ergänzen.
Warum ist Ekel in der Kunst laut Lessing verboten?
Ekel ist eine Empfindung, die immer als Natur und nie als bloße Nachahmung wahrgenommen wird, wodurch die ästhetische Täuschung zerstört wird.
Welche Rolle spielt das Mitleid in der Dichtkunst?
Das Ziel der Dichtung, insbesondere des Dramas, ist die Erregung von Mitleid durch Identifikation mit dem Helden, was zu einer moralischen Läuterung (Katharsis) führt.
- Citar trabajo
- Dr. phil. Daria Hagemeister (Autor), 2008, Laokoon - Über die Grenzen der Malerei und Poesie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120827