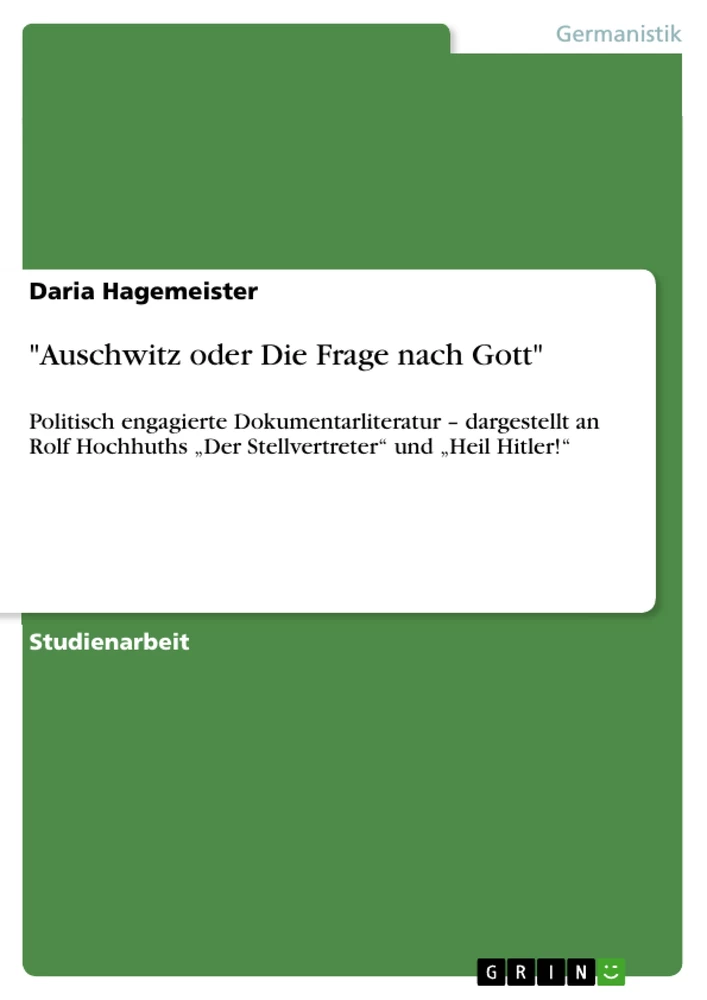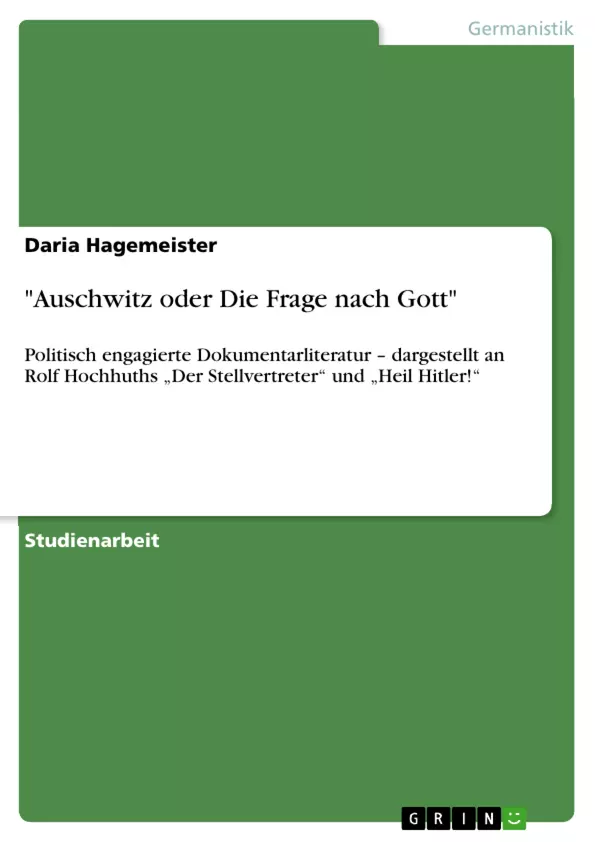Ende Juli 1934 schrieb Karl Kraus „Warum die Fackel nicht erscheint … Mir fällt zu Hitler nichts ein.“ Erst in den 60er Jahren schien im deutschsprachigen Raum diese Sprachlosigkeit überwunden und man sah sich mit der Notwendigkeit der Aufarbeitung der Vergangenheit konfrontiert. Doch oft mündete diese Aufarbeitung darin, einen Schlussstrich darunter zu ziehen und das Geschehene aus der Erinnerung löschen zu wollen. „Im Hause des Henkers soll man nicht vom Strick reden“ meinte Theodor W. Adorno einmal in einer wissenschaftlichen Kontroverse. „Der Gestus, es solle alles vergessen und vergeben sein, der demjenigen anstünde, dem Unrecht widerfuhr, wird von den Parteigängern derer praktiziert, die es begingen. ... Der Nationalsozialismus lebt nach, und bis heute wissen wir nicht, ob bloß als Gespenst dessen, was so ungeheuerlich war, dass es am eigenen Tode noch nicht starb, oder ob es gar nicht erst zum Tode kam; …“ Und tatsächlich war und ist das „Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie“ bis zum heutigen Tag, und zwar nicht nur in Deutschland, „potenziell bedrohlicher denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie“.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Literatur und Vergangenheitsbewältigung
- 1.2 „Der Sinn der Politik ist Freiheit“
- 1.2.1 Die Politik versus das Politische
- 1.3 Für eine „engagierte“ Literatur
- 1.3.1 Die Funktion des Dramas
- 1.3.2 Die Geburt des Dokumentartheaters
- 2 ROLF HOCHHUTH (* 1. APRIL 1931 IN ESCHWEGE)
- 3 „DER STELLVERTRETER“
- 3.1 Der Inhalt
- 3.2 Der Aufbau
- 3.3 Die Figuren
- 3.4 Die Themen
- 3.5 Die Rezeption
- 3.5.1 Kontroversen
- 4 HEIL HITLER
- 4.1 Der Inhalt
- 4.2 Der Aufbau
- 4.3 Die Figuren
- 4.4 Die Themen
- 4.5 Die Rezeption
- 5 Schlussbemerkungen
- 5.1 Das totgesagte Dokumentartheater
- 5.2 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht politisch engagierte Dokumentarliteratur am Beispiel von Rolf Hochhuths Stücken „Der Stellvertreter“ und „Heil Hitler!“. Die Arbeit analysiert die Inhalte, den Aufbau, die Figuren und die Rezeption beider Stücke, um deren Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung zu beleuchten.
- Die Rolle der Literatur in der Vergangenheitsbewältigung
- Analyse der Dramen „Der Stellvertreter“ und „Heil Hitler!“
- Die Rezeption und die Kontroversen um die Stücke
- Das Dokumentartheater der 1960er Jahre
- Politische und gesellschaftliche Implikationen der behandelten Themen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung diskutiert die Bedeutung von Literatur für die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und führt in die Thematik des politisch engagierten Dramas ein. Kapitel 2 bietet einen kurzen biografischen Abriss über Rolf Hochhuth. Kapitel 3 analysiert „Der Stellvertreter“, fokussiert auf Inhalt, Aufbau, Figuren und zentrale Themen. Kapitel 4 widmet sich auf ähnliche Weise „Heil Hitler!“. Die Arbeit schließt mit Schlussbemerkungen, die den Stellenwert des Dokumentartheaters zusammenfassen.
Schlüsselwörter
Politisch engagierte Literatur, Dokumentartheater, Rolf Hochhuth, „Der Stellvertreter“, „Heil Hitler!“, Vergangenheitsbewältigung, Nationalsozialismus, Rezeption, Kontroversen, Drama.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Dokumentartheater der 1960er Jahre?
Es ist eine Form des Dramas, die auf authentischen Dokumenten, Protokollen oder historischen Fakten basiert, um politische und gesellschaftliche Missstände, insbesondere die NS-Vergangenheit, aufzuarbeiten.
Worum geht es in Rolf Hochhuths Stück „Der Stellvertreter“?
Das Stück thematisiert die Haltung von Papst Pius XII. zum Holocaust und kritisiert das Schweigen der katholischen Kirche angesichts der Judenvernichtung.
Warum löste „Der Stellvertreter“ so große Kontroversen aus?
Die Kritik am Papst galt als Tabubruch und führte zu heftigen öffentlichen Debatten über die moralische Mitverantwortung der Kirche und die Grenzen der künstlerischen Freiheit.
Welche Themen behandelt das Stück „Heil Hitler!“?
Auch dieses Werk befasst sich mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und der Frage nach persönlicher und kollektiver Schuld in einer politisch engagierten Weise.
Welche Rolle spielt Literatur bei der Vergangenheitsbewältigung?
Literatur dient dazu, die Sprachlosigkeit gegenüber den Gräueltaten zu überwinden, Erinnerungen wachzuhalten und gesellschaftliche Diskurse über Moral und Politik anzustoßen.
- Citar trabajo
- Dr. phil. Daria Hagemeister (Autor), 2008, "Auschwitz oder Die Frage nach Gott", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120830