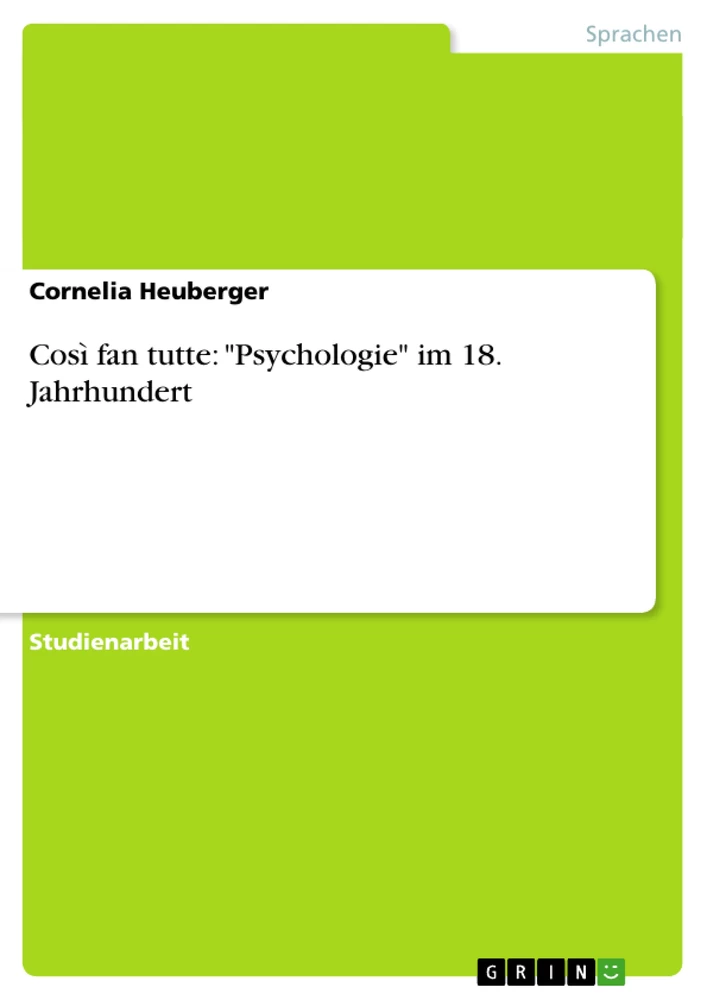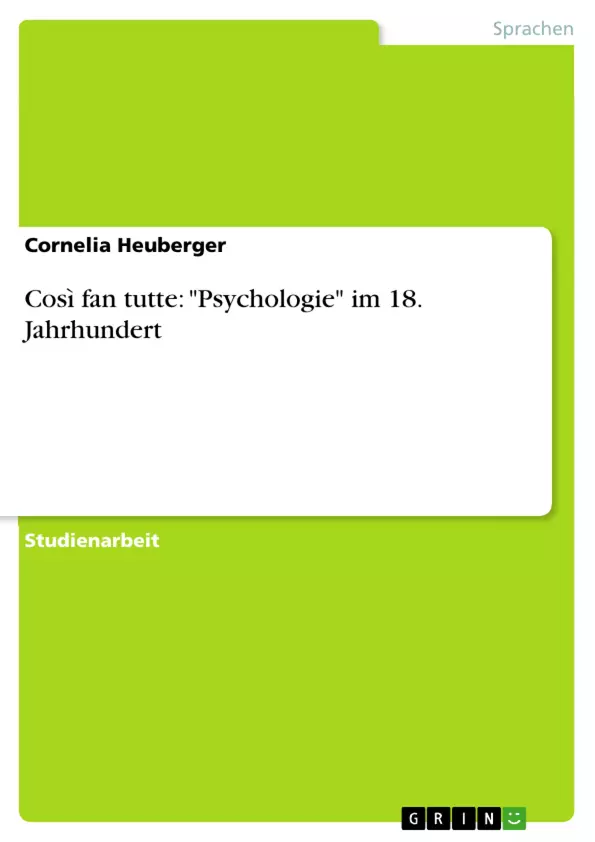Così fan tutte – Mozarts lange Zeit umstrittenste Oper entstand im 18. Jahrhundert zu einer Zeit des Umbruchs. Man befindet sich zwischen Materialismus und Aufklärung und die Protagonisten sehen sich nun mit einer neuen Liebeskonzeption konfrontiert. Mozart und da Ponte versuchen aristokratische und bürgerliche Liebesauffassungen gegenüber zu stellen, und dabei besonderen Schwerpunkt auf den Rationalismus zu legen. Vor dem Hintergrund eines gefährlichen Experiments, einem Spiel mit Gefühlen und der Liebe, ja mit der Psyche des Menschen, wird die Strömung der Empfindsamkeit, die Einheit von Liebe und Ehe, eine Neuerung, die erst kürzlich Einzug in die Gesellschaft gefunden hat, mit kritischem Auge betrachtet. Doch um was geht es eigentlich in dieser so verwirrenden Oper, und warum verlässt der Zuschauer heute noch wie damals die Oper mit einem ungewöhnlich unbehaglichen, nachdenklichen Gefühl? Die Antwort findet sich versteckt in einer geschickt hinter Parodie, Ironie und Realität verborgenen „Psychologie“.
Da Ponte hinterlässt der Regie karge optische, räumliche und mimische Anweisungen. Die Aussage des Stücks muss sich also im Libretto verbergen, in der Handlung, dem Geschehen – und zwar sowohl in den Worten als auch in der Struktur des Libretto. Bei einer genaueren Analyse dieser Aspekte treten verborgene Motivationslagen der Protagonisten hervor, die uns Aufschluss über die Wirkung dieser im Kreuzfeuer der Kritik stehenden Oper geben und eine sinnvolle Interpretation zulassen.
Auf die Vorgabe einer konkreten Bühnenlösung verzichten Mozart und da Ponte absichtlich ausdrücklich, da sie eine Oper für die Ewigkeit kreierten. Sie schufen ein Werk, das sich mit einer zeitlosen Thematik beschäftigt, mit Gefühlen und körperlichen Bedürfnissen. Innerste Triebe und Zerrissenheiten des menschlichen Wesens stehen im Vordergrund. Strebt der Mensch nach Sicherheit, Geborgenheit und Treue, oder ist er auf der Suche nach Freiheit und Abenteuer?
Oder birgt er Tendenzen zu beiden Extremen in sich? Ist der Mensch ein zerrissenes Wesen, das vielleicht selbst nicht weiβ, was es will? Oder sind es vielleicht nur die Frauen, die nicht wissen was sie wollen und somit Herzensleid schaffen?
Antwort auf diese Fragen will nun die folgende Abhandlung liefern, indem sie die einzelnen Charaktere im Hinblick auf ihre jeweilige Situation und ihre emotionalen Entwicklungsstadien beleuchtet und natürlich auch den gesamten Handlungsvorgang von einem psychologischen Standpunkt aus hinterfragt.
Inhaltsverzeichnis
- Thematik einer umstrittenen Oper
- Eine Wette als Rahmenhandlung
- Verborgene Motivationslagen
- Ausgangssituation
- Weg zur Selbstfindung
- Ende gut - alles gut?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung untersucht Mozarts Oper "Così fan tutte" aus psychologischer Perspektive des 18. Jahrhunderts. Sie analysiert die Motivationslagen der Protagonisten und hinterfragt die Handlung anhand der im Libretto verborgenen "Psychologie". Der Fokus liegt auf der Darstellung von Liebe, Treue und der Konfrontation mit der Realität der menschlichen Beziehungen.
- Die Darstellung von Liebe und Treue im 18. Jahrhundert
- Die Rolle der Wette als Rahmenhandlung und ihre Funktion
- Analyse der Charaktere und ihrer emotionalen Entwicklung
- Die Konfrontation mit der Realität und die Verarbeitung von Enttäuschung
- Die "Psychologie" im Libretto und ihre Bedeutung für die Interpretation
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Thematik einer umstrittenen Oper: Dieses Kapitel führt in die Thematik von Mozarts umstrittener Oper "Così fan tutte" ein. Es beleuchtet den gesellschaftlichen Kontext des 18. Jahrhunderts, den Konflikt zwischen Aufklärung und Materialismus und die unterschiedlichen Liebeskonzeptionen, die in der Oper dargestellt werden. Die Bedeutung des Librettos als Träger der Aussage wird hervorgehoben.
Kapitel 2: Eine Wette als Rahmenhandlung: Hier wird die Wette als zentrale Struktur der Oper erläutert und analysiert. Die künstliche und nicht realitätsgetreue Handlung wird im Kontext der "Schule des Lebens" für die Protagonisten betrachtet. Die Funktion der Wette zur Verarbeitung der Wahrheit und Erleichterung der psychologischen Verarbeitung für das Publikum wird thematisiert.
Kapitel 3: Verborgene Motivationslagen (Ausgangssituation): Dieses Kapitel beleuchtet die Ausgangssituation der Oper. Die idealisierte Vorstellung der Treue und die fehlende Berücksichtigung individueller Eigenschaften der Protagonisten werden analysiert. Die Selbstsicherheit und Idealsierung der Partner durch alle Beteiligten wird als wichtiger Aspekt hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Così fan tutte, Mozart, da Ponte, 18. Jahrhundert, Opernlibretto, Psychologie, Liebe, Treue, Wette, Empfindsamkeit, Rationalismus, menschliche Beziehungen, emotionale Entwicklung, Idealsierung, Realität.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt „Così fan tutte“ als Mozarts umstrittenste Oper?
Die Oper thematisiert ein gefährliches Experiment mit menschlichen Gefühlen und Treue, was zu ihrer Entstehungszeit als moralisch fragwürdig und zutiefst unbehaglich empfunden wurde.
Welche Rolle spielt die Wette in der Handlung?
Die Wette dient als Rahmenhandlung und „Schule des Lebens“, in der die Protagonisten mit der Realität ihrer eigenen Triebe und der Zerbrechlichkeit von Treue konfrontiert werden.
Was verrät das Libretto über die Psychologie der Figuren?
Da Lorenzo da Ponte kaum optische Anweisungen gab, verbirgt sich die psychologische Tiefe in der Struktur der Worte und den verborgenen Motivationslagen der zerrissenen Charaktere.
Wie wird das Thema Liebe im 18. Jahrhundert dargestellt?
Die Oper stellt aristokratische und bürgerliche Liebesauffassungen gegenüber und beleuchtet kritisch die Einheit von Liebe und Ehe im Kontext von Rationalismus und Empfindsamkeit.
Geht es in der Oper nur um die Untreue der Frauen?
Obwohl der Titel „So machen es alle (Frauen)“ suggeriert, analysiert die Arbeit die emotionalen Entwicklungsstadien aller Beteiligten und zeigt den Menschen als zerrissenes Wesen zwischen Sicherheit und Abenteuer.
- Citar trabajo
- Cornelia Heuberger (Autor), 2008, Così fan tutte: "Psychologie" im 18. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120892