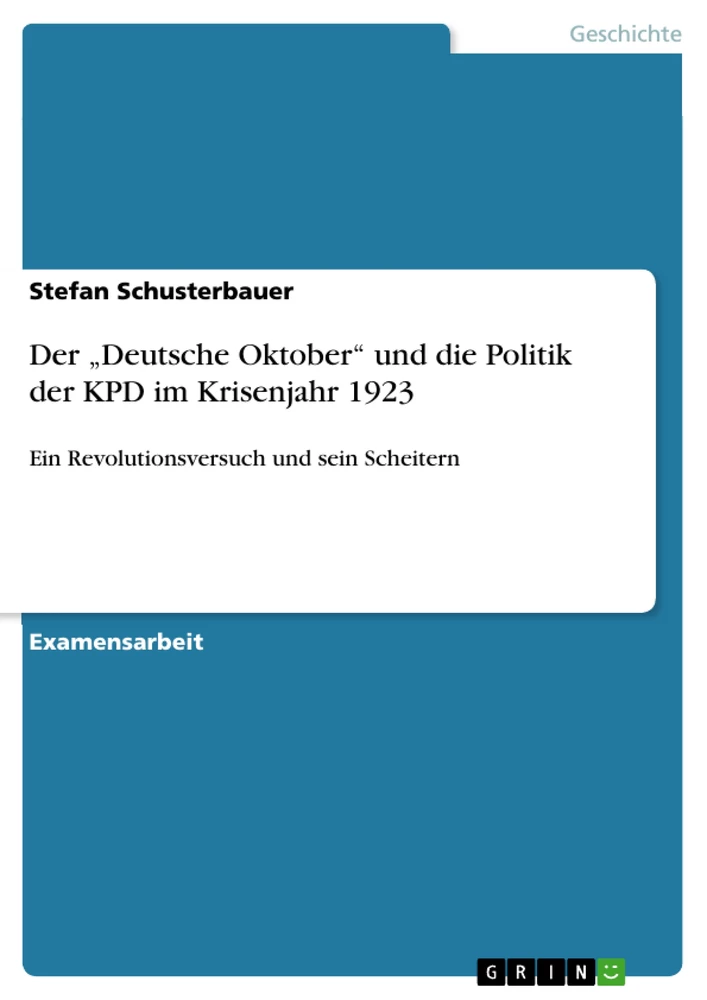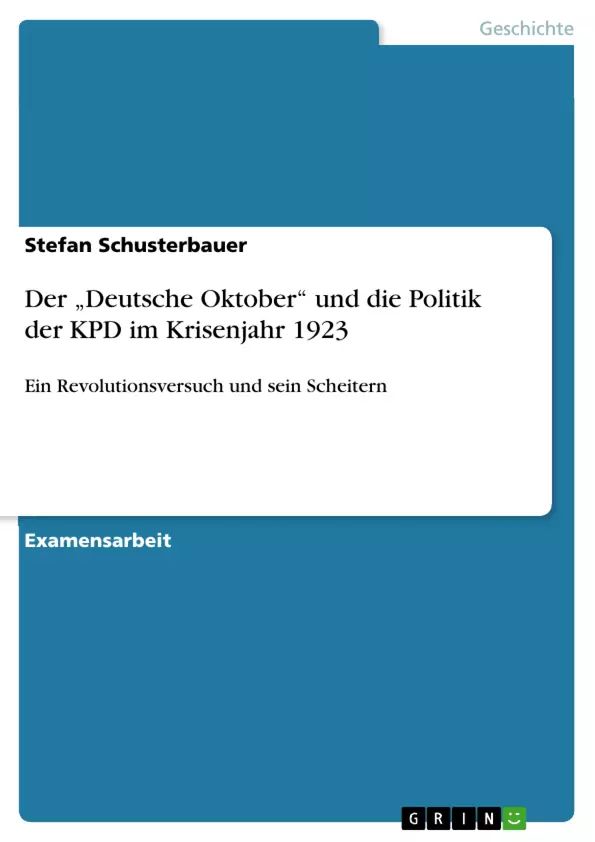Der erste Gedanke, den man mit den Begriffen „Aufstand“ und „1923“ verbindet, führt einen unweigerlich zum so genannten „Hitler-Putsch“, der am 9. November an der Münchener Feldherrenhalle sein unrühmliches Ende nahm. Grund dafür mag sein, dass dieser erste gescheiterte Machtergreifungsversuch des späteren Diktators, im Schulunterricht, in der Literatur und in den Medien ausgiebig unter die Lupe genommen wurde und wird. Dass exakt an jenem 9. November auch der Startschuss für die kommunistische Revolution in Deutschland fallen sollte, ist jedoch nur den wenigsten bekannt. Der „Deutsche Oktober“ ist in der öffentlichen Wahrnehmung, obwohl er einige Parallelen zum „Hitler-Putsch aufweisen kann und ebenfalls gründlich misslang, gewissermaßen ein „Nichtereignis“ der Weltgeschichte.
1. Einleitung
Der erste Gedanke, den man mit den Begriffen „Aufstand“ und „1923“ verbindet, führt einen unweigerlich zum so genannten „Hitler-Putsch“, der am 9. November an der Münchener Feldherrenhalle sein unrühmliches Ende nahm. Grund dafür mag sein, dass dieser erste gescheiterte Machtergreifungsversuch des späteren Diktators, im Schulunterricht, in der Literatur und in den Medien ausgiebig unter die Lupe genommen wurde und wird. Dass exakt an jenem 9. November auch der Startschuss für die kommunistische Revolution in Deutschland fallen sollte, ist jedoch nur den wenigsten bekannt. Der „Deutsche Oktober“ ist in der öffentlichen Wahrnehmung, obwohl er einige Parallelen zum „Hitler-Putsch aufweisen kann und ebenfalls gründlich misslang, gewissermaßen ein „Nichtereignis“[1] der Weltgeschichte.
Die Voraussetzungen für die beiden Ereignisse sind dabei zweifelsohne in der krisenhaften Situation, in der sich Deutschland ein halbes Jahrzehnt nach Ende des Ersten Weltkriegs befand, zu suchen. Ausgelöst durch die hohen Reparationsleistungen, denen Deutschland nur schwer nachkommen konnte, der daraus resultierenden Besetzung des Ruhrgebiets durch französischer Truppen und dem passiven Widerstand der Cuno-Regierung, war die galoppierende Inflation das Sinnbild der schweren Krise des Jahres 1923. Nicht umsonst wird für dieses Jahr treffenderweise der Begriff des „Krisenjahres“ verwendet.
Diese Umstände, in denen ein Großteil der Mittelschicht an den Rand des Existenzminimums gedrängt wurde und sich tagtäglich immer mehr Menschen in spürbarer Armut befanden, waren natürlich ein günstiger Nährboden für einen revolutionären Umsturz. Das erklärt zum einen das Erstarken der Links- wie Rechtsextremen und zum anderen die Überlegungen, die als revolutionär eingeschätzte Situation für die eigenen Ziele zu nutzen.
Entsprechend bereiteten sich auch die deutschen Kommunisten auf den Aufstand vor. Dies taten sie allerdings nicht im Alleingang, sondern gemäß den Instruktionen der Kommunistischen Internationalen (Komintern) und deren russischen Führern. Jene planten, durch eine Revolution im hoch entwickelten Deutschland dem Ziel einer Weltrevolution, in der Berlin das Zentrum sein sollte, näher zu kommen. Diese Führungskräfte, darunter Persönlichkeiten wie Stalin, Sinowjew, Trotzki und Radek, wiesen die Leitung der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) demzufolge an, Vorbereitungen für den bewaffneten Aufstand und die darauf folgende Machtübernahme zu treffen. Gemäß der Moskauer Aufstandsplanung und auf eine telegrafische Aufforderung hin, trat die KPD Mitte Oktober an der Seite der SPD gar in die Kabinette von Sachsen und Thüringen ein, um auf diesem Wege Zugang zu den Waffenlagern der Regierungen zu erlangen und infolgedessen die Arbeiterschaft für den beabsichtigen Kampf zu bewaffnen. Gegenmaßnahmen der Reichsregierung wie der Einmarsch der Reichswehr in Sachsen zwangen die Kommunisten dann aber zu verfrühten Handeln, so dass bereits am 21./22. Oktober losgeschlagen werden sollte. Zuvor wollte die KPD-Führung um Heinrich Brandler aber erst die Stimmung auf der so genannten „Chemnitzer Konferenz“, bei der Vertreter der gesamten sächsischen Arbeiterschaft zugegen waren, ausloten. Brandler erlitt dort jedoch eine eindeutige Abstimmungsniederlage und brach den Aufstand vor dessen eigentlichen Beginn ab, da er vor einem isolierten Vorgehen zurückscheute. Lediglich in Hamburg kam es auf Grund einer falschen Kuriermeldung zu einem aussichtslosen Straßenkampf. Die kommunistische Revolution in Deutschland fand nicht statt.
Diese Arbeit versucht nun, die Ereignisse des „Deutschen Oktobers“ zu analysieren. Dabei soll zunächst der Rahmen abgesteckt werden, indem in Kapitel 2 die Geschichte der KPD bis 1923, der Aufstandsversuch im März 1921 sowie Auswirkungen der russischen Oktoberrevolution beleuchtet werden. Darauf folgt ein Überblick über die Geschehnisse des Krisenjahrs 1923, die die Grundlage für das Entstehen einer als revolutionär eingeschätzten Situation bildeten (Kapitel 3). Das daran anschließende Kapitel 4 beschäftigt sich mit der KPD im Jahr 1923, wobei zuerst nur die Zeit bis zu Beginn der konkreten Aufstandsvorbereitungen behandelt wird. Im Einzelnen wird dabei auf Taktik, Strategie, Aufbau und Stärke, innerparteiliche Konflikte, das Verhältnis zur Sozialdemokratie sowie die Haltung der Partei zu Aufstand und Gewalt eingegangen. Untrennbar verknüpft mit den Plänen einer deutschen Revolution sind die Kommunistische Internationale mit ihrem Leitgedanken einer künftigen Weltrevolution sowie die dortigen Verantwortlichen der Russischen Kommunistischen Partei, die einen außerordentlich großen Einfluss auf die KPD-Führung besaßen. Dieser Aspekt wird in Kapitel 5 eingehender untersucht. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen dann die Kapitel 6 und 7. Im Detail gibt es hier zunächst einen Überblick über die von Moskau aus initiierten Revolutionsvorbereitungen der deutschen Kommunisten und deren praktische Umsetzung in Sachsen, Thüringen und Hamburg, um daraufhin auf die Gegenmaßnahmen der Reichsregierung, die das Scheitern der kommunistischen Aktion forcierten, einzugehen. In den letzten beiden Kapiteln sollen schließlich die Gründe des Scheiterns der geplanten Revolution in Deutschland sowie die Folgen, die sich aus dem Scheitern sowohl für die KPD als auch für die Kommunistische Partei Russlands (RKP) ergaben, herausgearbeitet werden.
Neue Erkenntnisse über den „Deutschen Oktober“ und speziell darüber, dass es die Sowjetführer waren, die die kommunistische Machtergreifung auch in Deutschland beschlossen und planten, lieferte die Öffnung des Geheimarchivs des ZK der KPdSU im Jahr 1995 während der Regierungszeit von Boris Jelzin. Die aufgetauchten Dokumente waren sogar dem Magazin „DER SPIEGEL“ einen sechsseitigen Artikel in einer Ausgabe des Jahres 1995 wert.[2]
Bayerlein nimmt viele dieser Dokumente in seine über hundert Quellen umfassende Quellensammlung aus dem Jahr 2003 auf und liefert somit einen wertvollen Beitrag für die Erarbeitung der Ereignisse zwischen Juli 1923 und Januar 1924. Bayerleins Quellensammlung bildet demnach auch die Grundlage dieser Arbeit. Otto Wenzel hat seine umfangreiche Dissertation über die gescheiterte deutsche Oktoberrevolution aus dem Jahr 1955 ebenfalls anhand der neuen Quellen überarbeitet und 2003 neu herausgebracht. Als Drittes möchte ich an dieser Stelle nur noch auf die Abhandlung von Werner Angress über die Kampfzeit der KPD von 1921 bis 1923 verweisen. Diese erschien zwar schon 1963[3], bietet aber immer noch einen umfassenden Überblick über die Frühzeit der KPD und kann in dieser Beziehung getrost als Standardwerk bezeichnet werden. Die hier erwähnte Literatur und die darüber hinaus verwendeten Darstellungen und Quellen sind im Literaturverzeichnis ab Seite 81 angeführt.
Das Ziel dieser Arbeit wird es sein, mit Hilfe der neu zugänglichen Quellen eine zutreffende Darstellung über Hintergründe, Verlauf und Folgen des kommunistischen Revolutionsversuchs im Jahr 1923 zu liefern. Wie der Untertitel, „Ein Revolutionsversuch und sein Scheitern“, weiter impliziert, soll zudem versucht werden, die Frage nach den Gründen des Scheiterns des „Deutschen Oktobers“ zu beantworten.
2. Die Anfangsjahre der KPD
2.1 KPD 1919 bis 1923
Die KPD entstand nicht durch den unmittelbaren Anstoß der russischen Revolution im Oktober 1917, sondern hat weiter zurück reichende Wurzeln in der deutschen Arbeiterbewegung. Sie ging aus den Strömungen der deutschen Sozialdemokratie hervor, ihre organisatorische Selbstständigkeit war jedoch erst nach einer Spaltung der sozialdemokratischen Partei möglich.[4] Die Abspaltung von der USPD geschah schließlich Ende 1918 und führte zur Gründung der KPD zum Jahreswechsel 1918/19. Zuvor war der Einfluss der Spartakusgruppe um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht auf die Novemberrevolution eher gering gewesen und die Kommunisten waren weder als ideologische noch als organisatorische Einheit aufgetreten. Der Gründungsparteitag ließ dann auch gleich erkennen, dass die äußerste Linke nicht homogen auftrat. Der marxistischen Führung standen u.a. die ultralinken Radikalen entgegen, was sich in Spannungen und Streitigkeiten äußerte, etwa in den Fragen, ob an den Wahlen zur Nationalversammlung teilgenommen werden solle oder wie die Partei zu politischen Terror stehe.[5] Diese schon von Beginn an zu beobachtende Heterogenität sollte die Partei fortan begleiten und ein wesentliches Merkmal der kommunistischen Organisation werden.
Die ideologische Konzeption[6] orientierte sich größtenteils am Vorbild der Kommunistischen Partei Russlands (RKP) und erstrebte als Vertreter der Arbeiterklasse eine Sozialisierung der Wirtschaft mit dem Ziel einer klassenlosen Gesellschaft durch Überwindung des Kapitalismus. Dabei sollte die proletarische Revolution den bürgerlichen Staat zerstören und ihn durch die Diktatur des Proletariats in Form des Rätesystems ersetzen. Auf Grund des zu erwartenden Widerstandes der Herrschenden wäre in Folge dessen ein Bürgerkrieg aber unausweichlich gewesen. In der Anfangszeit der Partei war zudem eine breite innerparteiliche Demokratie eine Selbstverständlichkeit.[7] Ein Zustand, der spätestens im Zuge der Bolschewisierung der Partei nach den Ereignissen im Herbst 1923 kaum noch vorstellbar war.
Die KPD spielte zwar in den revolutionären Nachkriegskämpfen (kurzlebige Räterepubliken etwa in München und Bremen) eine Rolle, konnte ihre innere Struktur aber nur schwer stabilisieren, wozu sicher auch die Ermordung der beiden Parteiführer Rosa Luxemburg[8] und Karl Liebknecht beitrug. Die Herausarbeitung eines klareren politischen Profils und eine deutliche Abgrenzung nach links geschahen jedoch auf dem 2. Parteitag im Oktober 1919, bei dem die radikalen Kreise aus der Partei gedrängt wurden. Tendenzen der ausgeschlossenen Kreise wirkten gleichwohl noch Jahre fort.[9]
Zur Massenpartei werden konnte die KPD zum einen, da sie in der Tradition der deutschen Arbeiterbewegung verwurzelt war. Zum anderen vollzog sich die Stabilisierung der Weimarer Republik in restaurativen Bahnen. Dies führte zu einer Radikalisierung der Arbeiterschaft, wodurch eine Wählerwanderung nach links (von der SPD zur USP und von der USPD zur KPD) zustande kam. Dieser Prozess gipfelte schließlich in der Spaltung der USPD im Oktober 1920, da die Komintern den rechten Flügel nicht aufnehmen wollte, und in der Vereinigung des linken USPD-Flügels mit der KPD, wodurch die KPD auf einen Schlag mehr als 350000 neue Mitglieder verbuchen konnte.[10]
Ab 1921 betrieb die KPD zunächst die Politik der Einheitsfront[11] und richtete einen offenen Brief an alle Arbeiterorganisationen, der in einem Minimalprogramm zur Linderung der wirtschaftlichen Not der Massen aufrief. Dadurch sollten Mitglieder jener Organisationen für die kommunistischen Ziele gewonnen werden.[12] Nach der gescheiterten „März-Aktion“[13] erfolgte ein erneuter Einflussgewinn durch die Rückkehr zur Einheitsfronttaktik, beispielsweise durch das Mitwirken am „Berliner Abkommen“ zusammen mit den sozialdemokratischen Parteien und den Gewerkschaften. Differenzen mit der Komintern zeigten, dass die KPD zu diesem Zeitpunkt keineswegs in die volle Abhängigkeit Moskaus geraten war, obwohl die KPD-Politik bereits sehr von der Komintern und den russischen Führern bestimmt wurde.[14]
Ende 1922 übernahm Heinrich Brandler den Parteivorsitz und setzte die Einheitsfrontpolitik fort, sah sich aber einer starken innerparteilichen Links-Opposition um Ruth Fischer gegenüber. Während Brandler Realpolitik betrieb und die Macht schrittweise erobern wollte, machte sich die Linke für eine Politik ohne Umwege und Kompromisse und für den gewaltsamen Aufstand stark, der direkt zur Diktatur des Proletariats führen sollte.[15] In Anbetracht der permanenten Krisensituation des Jahres 1923 waren die innerparteilichen Spannungen, Kontroversen und Uneinigkeiten sicherlich nicht gerade förderlich, die günstigen äußeren Umstände für das Erreichen kommunistischer Ziele auszunutzen.
2.2 Märzaktion
Schon im März 1921 kam es zu einer bewaffneten Revolte in Mitteldeutschland[16], die auf Betreiben der Kominternführung[17] auch von der KPD mitgetragen wurde. Die KPD wollte einerseits die Furcht vor dem Putschismus nach der Niederlage von 1919 überwinden[18], anderseits führten das Hochgefühl potentieller Schlagkraft nach dem Zusammenschluss mit der USPD sowie der Rücktritt der Repräsentanten des bisherigen aktionsfeindlichen Kurses, Paul Levi und Clara Zetkin, dazu, dass die Partei kampfbereit war und einen offensiven Kurs einschlug.[19]
Dem Generalstreikaufruf folgten etwa 200.000 bis 300.000 Arbeiter. Die sich meist spontan entwickelnden Kämpfe wurden aber bereits nach wenigen Tagen blutig niedergeschlagen, woraufhin der Streikaufruf zurückgenommen wurde. Die eigentlichen Kämpfe mit Polizei- und Reichswehrtruppen wurden allerdings nicht von der kommunistischen Partei oder gar der Zentrale ausgetragen und organisiert, sondern von ad hoc sich zusammenfindenden Arbeitertruppen unter Führung von „proletarischen Rebellen“ wie z.B. Max Hoelz[20]. Koordinierungsversuche der Partei blieben in Ansätzen stecken, später wurde sogar das Eingeständnis der völligen militärischen Desorganisation gemacht. Letztendlich verlief der Aufstand unabhängig von den Weisungen der kommunistischen Partei, die für das Entstehen zumindest mitverantwortlich war.[21]
Die Märzaktion markierte einen Einschnitt in der Entwicklung der KPD. Die Parteizentrale bekannte zum einen, dass die organisatorische und ideologische Kleinarbeit zur Erziehung der Proletariatsmassen nahezu vollkommen versäumt wurde[22], und zum anderen hatte die Niederlage unmittelbare Konsequenzen für die weitere Vorgehensweise von KPD und Komintern. Das bedeutete für die KPD eine Abkehr von der Offensivtheorie sowie einen Ausbau der Einheitsfronttaktik und für die Komintern und die RKP im zwischenstaatlichen Bereich eine temporäre Rückkehr zur herkömmlichen Diplomatie im Sinne von Koexistenz statt Weltrevolution.[23] Langfristiges Ziel blieb dennoch die Vorbereitung der Revolution. Auf dem Weg dahin war es aber nötig, für bestimmte Zeit ein Zusammenleben mit dem Kapitalismus zu arrangieren.[24]
Die Scheu, Entscheidungskämpfe auszutragen, wurde in der Märzaktion zwar überwunden, die Märzkämpfe in Mitteldeutschland müssen aber als verfrühte Initiative angesehen werden, die das Kräftepotential der revolutionär gestimmten Arbeiterschaft bei weitem überstieg und deshalb zum Scheitern verurteilt war. Die Revolution in Deutschland war zunächst aufgeschoben, was aber nicht die Aufhebung der Revolutionspläne bedeutete. Nur war dazu eine detailliertere Vorbereitung und Organisation nötig, worauf zwei Jahre später Wert gelegt werden sollte. Nichtsdestotrotz sollten aber auch die negativen Erfahrungen von 1921 insbesondere für die Parteirechte um Heinrich Brandler bei den zu fällenden Entscheidungen im Herbst 1923 eine Rolle spielen.
2.3 Auswirkungen der russischen Oktoberrevolution
Die Oktoberrevolution im zaristischen Russland im Jahr 1917 besaß selbstverständlich einen allzeit präsenten Vorbildcharakter für die deutschen Kommunisten. Sie sorgte so, durch die Legitimation der russischen Errungenschaften, für einen nicht unerheblichen Einfluss der RKP und der Komintern, in der die wichtigsten Posten durch Mitglieder der RKP besetzt waren, auf die KPD.
So übernahm auch die KPD die grundsätzliche Einstellung gegenüber dem Einsatz von bewaffneter Gewalt. Insbesondere Lenin war es hier, der immer wieder auf die entscheidende Bedeutung von bewaffneter Gewalt und die Aussichtslosigkeit einer friedlichen Machteroberung hinwies. Gerade in diesem Punkt führten unterschiedliche Haltungen innerhalb der deutschen Arbeiterschaft dazu, dass sich der Spaltungsprozess in der deutschen Arbeiterbewegung wesentlich beschleunigte und dass die KPD in die Isolation geriet.[25]
Ende 1920 stellte Lenin und mit ihm der dritte Kongress der Komintern ein Abebben der revolutionären Welle fest, woraufhin eine Kursanpassung auf die Schaffung einer Arbeitereinheitsfront vorgenommen wurde, um so die Mehrheit der Arbeiterklasse zu gewinnen und an die Aufgabe der Machtergreifung heranzuführen. Trotz dieser Kurskorrektur hielten die Kommunisten der ersten Generation die internationale Lage immer noch für revolutionär. Und auch der Selbsterhaltungstrieb der bürokratischen Strukturen forderte die Überzeugung, dass die Komintern neue revolutionäre Erschütterungen brauche, um den Beweis für die eigene Notwendigkeit zu erhalten.[26] Demzufolge war das revolutionäre Potential, durch eine gewaltsame Aktion zur Macht zu kommen, keineswegs abhanden gekommen, sondern wartete nur darauf, in einer geeigneten Situation abgerufen zu werden. Die Ereignisse im Herbst 1923 belegen dies.
3. Das Krisenjahr 1923
Das Krisenjahr 1923 bot eine Fülle von Ereignissen und Vorgängen, wie sie in so tief einschneidender und vielfältiger Bedeutung schwer in einem anderen Jahr der Weltgeschichte auf so engem Raum zusammengedrängt zu finden sein werden. Gleichzeitig markierte es den Höhepunkt der krisenhaften Zustände in den ersten Nachkriegsjahren und fasst die Schwierigkeiten, mit denen die junge Weimarer Republik zu kämpfen hatte (in Form von außenpolitischen Spannungen, innenpolitischer Instabilität und der verheerenden wirtschaftlichen Entwicklung) recht anschaulich zusammen.
In Schlagworten prägten neben dem Revolutionsversuch der Linken, der in dieser Arbeit ausführlich behandelt wird, folgende Ereignisse das Jahr: Der Ruhrkampf als (größtenteils) unblutige, auf wirtschaftliche Aspekte beschränkte Austragung von Feindseligkeiten der Hauptgegner des ersten Weltkriegs, Deutschland und Frankreich, mit umgekehrten Vorzeichen. Die Hyperinflation als letztes Stadium der höchst einseitig zu Ungunsten des Mittelstandes sich vollziehenden Begleichung der inneren Kriegskosten. Der Hitlerputsch als Höhepunkt der Aktionen der Rechten und Sinnbild des Konflikts zwischen Bayern und dem Reich. Der Separatismus im Rheinland und in der Pfalz als innerdeutscher Versuch, die Reichseinheit aufzulösen. Und schließlich die beginnende Konsolidierung nach Bildung der Großen Koalition unter Reichskanzler Stresemann, die während ihres kurzen Bestehens die gefährliche Krise mit Maßnahmen wie dem Abbruch des passiven Widerstandes, dem Ermächtigungsgesetz und der Einführung der Rentenmark zu entschärfen vermochte.[27]
Die wichtigste Voraussetzung all dieser Ereignisse des Jahres 1923 war sicherlich die Ruhrkrise, die am 11. Januar mit dem Einmarsch französischer und belgischer Truppen ins entmilitarisierte Ruhrgebiet begann, nachdem relativ geringfügige Lieferversäumnissen Deutschlands an den Kriegssieger vorausgegangen waren. Acht Tage später reagierte die deutsche Reichsregierung unter Reichskanzler Cuno und gab die Anweisung zum „passivem Widerstand“. Auf Grund der Verhinderung von Kohlelieferungen ins unbesetzte Reichsgebiet war Deutschland von seinem industriellen Zentrum abgeschnitten und dadurch mit Kosten für die Erhaltung der Bevölkerung belastet. Die Folge waren gewaltige Verluste an Volksvermögen, wodurch das Ziel der französischen Besatzungsmacht, eine wirtschaftliche Erschöpfung des „Erbfeindes“ herbeizuführen, zweifellos erreicht wurde. Aktiver Widerstand wurde zumeist von ehemaligen Angehörigen der Freikorps betrieben. Die größte Aufmerksamkeit zog dabei der „Fall Schlageter“ auf sich, der nicht nur von nationalen Kreisen instrumentalisiert wurde, sondern auch in den parteitaktischen Überlegungen der KPD Beachtung fand.[28] Erst der Rücktritt des Cuno-Kabinetts am 12. August und der neue Kurs der Stresemann-Regierung zur Stabilisierung der Währung führten am 26. September zur Beendigung des passiven Widerstands.[29]
Die ungeheuren Unterstützungssummen für Rhein und Ruhr hatten das Land aber an den Rand des wirtschaftlichen Zusammenbruchs geführt und waren die Hauptursache der Hyperinflation. Die Ursachen für die Inflation waren zwar vielfältig und begannen nicht erst im Jahr 1923 (Kriegsanleihen, Reparationsleistungen, etc.), die Auswirkungen kamen allerdings in diesem Jahr in kaum vorstellbarer Weise zum Tragen und führten dazu, dass die ehemalige europäische Großmacht unaufhaltsam auf den wirtschaftlichen Abgrund zusteuerte. Die rapide Geldentwertung traf dabei besonders den Mittelstand, der größtenteils enteignet wurde, generell die Lohnempfänger sowie Rentner und Pensionäre, die allesamt ein beachtliches Absinken ihrer Lebensstandards hinnehmen mussten. Trotz all der Nöte gab es auch Profiteure dieser Entwicklung, darunter die Landwirtschaft, die entschuldet wurde und die Industrie, die Riesengewinne verbuchen konnte. Der Großteil der Bevölkerung war jedoch negativ betroffen. Daher war es nicht verwunderlich, dass radikale Gruppen und Parteien, sowohl der Rechten als auch der Linken, versuchen sollten, diese extreme Krisensituation auszunutzen und darüber hinaus Anhänger in den Kreisen der Mittelschicht, die ihnen ansonsten verschlossen waren, für sich zu gewinnen.[30]
Die rechte Bewegung hatte dabei ihr zentrales Betätigungsfeld in Bayern und erlebte ihren Höhepunkt im so genannten „Hitler-Putsch“, der später propagandistisch verklärt werden sollte, aber im Grunde kläglich scheiterte und der ohne die weitere Entwicklung der deutschen Geschichte sicherlich nur eine Randnotiz darstellen würde. Dennoch dürfen die republikfeindlichen Tendenzen der bayrischen Landesregierung nicht unerwähnt bleiben, welche nationalsozialistische Ziele wie den Marsch auf Berlin oder die Vorbereitung zum Kampf gegen das „bolschewistische“ Sachsen inhaltlich mittrug, sodass ein handfester Konflikt zwischen Bayern und dem Reich entstand. Folglich wurde die junge Republik nicht nur von links bedroht, sondern sah sich auch einer realen Bedrohung von rechten, reaktionären Kreisen ausgesetzt.[31]
Daneben ergaben sich durch die Ruhrkrise neue Chancen für die separatistischen Kräfte, insbesondere im Rheinland und in der Pfalz. Diese schlossen sich nahezu ohne Vorbehalte der französischen Besatzungsmacht an, die grundsätzlich zu deren Unterstützung bereit war, und strebten die Loslösung vom Reich an. Erst im Herbst 1923 fühlten sich die Separatisten in der Lage zum Handeln und besetzten beispielsweise öffentliche Gebäude in Aachen, Krefeld und Mönchengladbach, wobei ihnen auch hier die aktive Unterstützung der französischen Generale vor Ort zu Gute kam. Die Bevölkerung und die ortsansässige Polizei leisteten aber in der Regel Widerstand, sodass sich die separatistischen Bestrebungen im Rheinland nicht durchsetzen konnten und die Bewegung ab Ende November allmählich zusammenbrach. Ähnliche Vorgänge spielten sich in der Pfalz ab, wo sogar die „Pfälzische Republik im Vaterlande der rheinischen Republik“ ausgerufen wurde. Mangelnder Rückhalt beim Großteil der Bevölkerung ließ den pfälzischen Separatismus aber schließlich auch, Anfang Januar 1924, zum Erliegen kommen.[32]
Um die vielfältigen Krisenherde unter Kontrolle zu bekommen, entschlossen sich am 13. August die SPD, die DVP, die DDP und das Zentrum, eine große Koalition unter dem nationalliberalen DVP-Politiker Gustav Stresemann zu bilden. Der Beendigung des passiven Widerstandes durch die neue Reichsregierung schlossen sich Maßnahmen politischer und wirtschaftlicher Art an. Innenpolitisch wurde ein Ermächtigungsgesetz verabschiedet und General von Seeckt in der Folge mit der vollziehenden Macht betraut, was schließlich u.a. zum temporären Verbot von KPD und NSDAP führte. Als zweites großes Projekt wurde die Währungsreform und damit die Einführung der Rentenmark angegangen. Hierbei gelang es, den Kurs der Mark zu halten, da die Bevölkerung schnell Vertrauen zur neuen Währung fasste und die Rentenmark annahm. Auch wenn die Große Koalition nur verhältnismäßig kurze Zeit Bestand hatte[33], wurden wichtige Schritte zur Stabilisierung der gefährdeten Republik eingeleitet. Ebenfalls begünstigt durch Regierungswechsel in Frankreich und Großbritannien[34], hatte die Weimarer Republik so die innen- und außenpolitische Bedrohung ihrer Existenz abgewehrt und konnte in eine Phase der Konsolidierung, wenn auch einer sehr fragilen, eintreten.[35]
4. Die KPD 1923
4.1 Einheitsfront und Arbeiterregierung
Die Neuorientierung der russischen Außenpolitik ab 1921, die eine zeitweilige Koexistenz mit dem sich stabilisierenden Westeuropa anstrebte, verlangte ein Suchen nach Partnern, die zu einer Verständigung mit dem kommunistischen Russland sowie den kommunistischen Parteien in den einzelnen Ländern bereit waren. Angestrebt wurde daher eine Arbeitereinheitsfront.[36] Um dies zu erreichen wurde seit Sommer 1921 die Zusammenarbeit mit Nichtkommunisten in immer weitere Bereiche ausgedehnt[37] und gemäß den vorgegebenen Einheitsfrontparolen weitete man die Agitation auf die verschiedensten Schichten der Bevölkerung aus und wandte sich nicht mehr nur an das Industrieproletariat.[38]
Im Rahmen der Einheitsfronttaktik wurde nun immer deutlicher unterschieden zwischen einer „Einheitsfront von oben“, die Angebote zur Zusammenarbeit an die sozialistischen und gewerkschaftlichen Führungen und Organisationen vorsah, und einer „Einheitsfront von unten“, die das Ziel hatte, mit den unteren Organen und Mitgliedern der sozialistischen Parteien unter Ausschluss der Führungen zusammenzuarbeiten und letztlich diese gegen ihre eigenen Führungen aufzuwiegeln und die Organisationen zu zersetzen. Innerhalb der KPD führten unterschiedliche Auffassungen in dieser Frage zu erheblichen Differenzen. Während die „rechten“ Kommunisten eine „Einheitsfront von oben“ anstrebten, setzte sich der gegenüberliegende Parteiflügel vehement für die „Einheitsfront von unten“ ein.[39]
Auch im Jahr 1923 bildete die Einheitsfronttaktik das Fundament aller kommunistischen Politik, da es zur Eroberung der Macht der Unterstützung der Mehrheit der Arbeiterschaft und der Neutralisierung eines Großteils der übrigen Bevölkerung[40] bedurfte. Dem Beispiel Russlands folgend, glaubten die Kommunisten in Mitteleuropa an einen zukünftigen Sprung in der Entwicklung, der sie unversehens vor eine Revolution stellen sollte und ihnen die Mehrheit der Arbeiter zuführte.[41] Grundlage dafür war die Einheitsfronttaktik. Diese sollte, in der Gesamtheit der Mittel, das Gesamtgefüge der nichtkommunistischen Arbeiterparteien auflockern und in Verwirrung bringen, um die Mitglieder von den Führern zu lösen und zur KPD zu führen.[42] Auch wenn es als Widerspruch erscheint, wurden dazu sowohl Verhandlungen mit den sozialdemokratischen Führern geführt, als auch jene Führer als verbrecherisch und konterrevolutionär bezeichnet. Absicht war es dabei, einen Keil zwischen Spitze und Basis zu schieben und im Endeffekt eine Spaltung der Sozialdemokratie zu erreichen.[43]
Der 8. Parteitag der KPD stand deshalb ganz im Zeichen der Einheitsfrontlinie und beschäftigte sich mit der Frage, ob und unter welchen Umständen Kommunisten in die Regierungen in Sachsen und Thüringen eintreten sollten, was wiederum zu einer Konfrontation von Parteirechten und Parteilinken führte.[44] Ohnehin war die Schaffung einer „Arbeiterregierung“ ein weiteres Nahziel der Einheitsfronttaktik[45]. Diese war jedoch nicht im Sinne einer kommunistisch-sozialdemokratischen Koalitionsregierung, sondern einzig und allein zur Überwindung des kapitalistischen Systems gedacht, wobei es nahezu zwangsläufig zum bewaffneten Kampf, wenn nicht gar zum Bürgerkrieg kommen musste.[46] Dies wird sofort klar, wenn man sich die Aufgaben einer Arbeiterregierung vor Augen führt:
„1. Bewaffnung des Proletariats, 2. Entwaffnung der bürgerlichen, konterrevolutionären Organisationen, 3. Kontrolle der Produktion, 4. Abwälzung der Hauptlasten der Steuern auf die Reichen, 5. Brechung des Widerstandes der Bourgeoisie.“[47]
Dass die Arbeiterregierung einer parlamentarischen Konstellation entspringen konnte, wurde nicht ausgeschlossen, was die praktische Umsetzung in Sachsen und Thüringen[48] dann auch bestätigen sollte. Es muss allerdings angefügt werden, dass dieser Schritt nur ein Mittel zum Zweck war: Ziel war es keineswegs bloß Reformen zu erreichen, sondern die gesamte kapitalistische Gesellschaftsordnung zu stürzen.
4.2 Schlageter-Kurs und Nationale Einheitsfront
Im Jahr 1923 strebte die KPD nicht nur eine Einheitsfront des Proletariats an, sondern sie war auch darauf aus, Kreise der Bevölkerung, die durch die bisherige Agitation nicht erfasst worden waren, dem kommunistischen Lager zuzuführen. Das Mittel, das dazu angewandt wurde, war die Nationale Einheitsfronttaktik oder, sich auf eine bekannte Rede Karl Radeks beziehend, der „Schlageter-Kurs“ bzw. die „Schlageter-Linie“.
Auch wenn es schon Tendenzen eines Nationalbolschewismus innerhalb der kommunistischen Bewegung gegeben hatte[49], konnten diese keine nennenswerten Teile der Partei auf ihre Seite ziehen, waren schnell isoliert und wurden gar von höchster Stelle verurteilt.[50]
1923 führten nun auch strategische Überlegungen der Sowjetunion zu einem Rückgriff auf den Nationalbolschewismus. Sie erkannte die Gelegenheit, die seit Rapallo bestehende Kooperation mit Deutschland zur Frontstellung gegen die Westmächte auszubauen, eine Stärkung des Vertragspartners gegenüber Frankreich zu erreichen und, durch die Zusammenarbeit mit den Nationalisten, den deutsch-französischen Gegensatz zu verschärfen.[51]
Die Linke der KPD wollte zwar zunächst die Ruhrkrise für ihre eigenen revolutionären Ziele ausnutzen und legte eine kaum gedrosselte Aktivität an den Tag[52]. Mit dem Einvernehmen der Komintern-Führung wurde dann allerdings eine Resolution[53] verfasst, mit der die KPD in den Ruhrkämpfen die Haltung anzeigen sollte, dass ihr nationale Interessen nicht gleichgültig erschienen und die nationale Einstellung kein Kompromiss war, sondern den Führungsanspruch der Arbeiterschaft aufrechterhielt. In der Resolution von Mitte Mai hieß es:
„Aufgabe der Kommunistischen Partei ist es, den breiten kleinbürgerlichen und intellektuellen nationalistischen Massen die Augen darüber zu öffnen, dass nur die Arbeiterklasse, nachdem sie gesiegt hat, imstande sein wird, den deutschen Boden, die Schätze der deutschen Kultur und die Zukunft der deutschen Nation zu verteidigen. (…) die deutsche Arbeiterklasse an die Macht gelangt, wird imstande sein, die Sympathien der Volksmassen in anderen Ländern zu erobern, die es den imperialistischen Mächten erschweren werden, ihre Vernichtungspolitik gegen die deutsche Nation zu Ende zu führen.“[54]
Daher erregte Radeks „Schlageter-Rede“ vom 21. Juni vor der ‚Erweiterten Exekutive der Komintern’, bei der er den nach einem Sabotageakt von der französischen Besatzungsmacht hingerichteten Freikorpskämpfer Albert Schlageter als einen „mutigen Konterrevolutionär“, aber auch als einen „Wanderer ins Nichts“ bezeichnete[55], weder besondere Aufmerksamkeit beim Auditorium, noch wurde sie als besonders sensationell empfunden. Sie stand vielmehr in der seit Beginn der Ruhrkrise betriebenen nationalen Einheitsfronttaktik, die mit ausdrücklicher Billigung Moskaus, wenn nicht sogar auf dessen Initiative hin, betrieben wurde.[56]
Radek formulierte zwei Alternativen: Entweder man nahm den Kampf gegen Sowjetrussland und die deutschen Kommunisten auf oder man schloss sich dem Kampf gegen die kapitalistische Entente und die deutsche Regierung an, wobei wirksamer Widerstand gegen den Versailler Vertrag auf Dauer nur von den Kommunisten zu erwarten sein sollte. Formell war dies ein Bündnisangebot an alle, die sich für die kommunistischen Ziele einspannen ließen, aber auch eine Kriegsandrohung an diejenigen, die auf ihren eigenen Zielen beharrten.[57] Auf diesem Wege wurde eine doppelte Zielsetzung ausgegeben: Zum einen sollten neue Anhänger für die kommunistische Bewegung geworben werden, vorrangig aus den durch die Krise verarmten und verbitterten unteren Schichten des Mittelstandes. Zum anderen wurde eine Spaltung der verschiedenen nationalen Gruppen und des faschistischen Gegners erwartet, der durch die Ruhrkrise ungemein erstarkte und als einer der Hauptfeinde angesehen wurde[58]. Daher lief die organisatorische und ideologische Bekämpfung des Rechtsradikalismus auch weiter fort und wurde nicht unterbrochen.[59]
Ein für die KPD positiver Effekt der nationalen Einheitsfrontaktik war das Heranziehen von Fachleuten aus den Bereichen Militär, Wissenschaft und Ingenieurswesen, die in und nach einer Revolution von Nutzen sein konnten. Nachteile ergaben sich in der partiellen Verwirrung der eigenen Mitglieder durch den neuen Kurs, was eine ungünstige Rückwirkung auf die Arbeiter nach sich zog.[60]
Im Gesamtblick erregte das vorübergehende, scheinbare Zusammenarbeiten von Links- und Rechtsextremen ein beträchtliches Aufsehen, beschied der KPD aber wenig greifbare Erfolge, da kaum auf Resonanz bei den verarmten Mittelständlern gestoßen wurde. In sozialdemokratischen Kreisen verstärkte sich sogar die Ablehnung gegen ein Paktieren mit den Kommunisten.[61] Allerdings war diese Taktik, und mehr als eine solche war es auch zu keinem Zeitpunkt[62], schon dann zweckmäßig und als Teilerfolg zu verbuchen, wenn es glückte, bestimmte Bevölkerungsschichten zu neutralisieren. Teilweise gelang dies auch.[63]
Dennoch blieb dieses Intermezzo nur Episode und sollte spätestens mit Beginn der Vorbereitung der deutschen Revolution im Herbst 1923 ad acta gelegt werden.
4.3 Die KPD in der Ruhrkrise
In der Ruhrkrise stand der deutsche Kommunismus vor einem Dilemma. Auf der einen Seite wurde der westliche Imperialismus verdammt, der hier durch die französische Besatzungsmacht repräsentiert wurde. Auf der anderen Seite bestand nach wie vor das Ziel, die bestehende Ordnung in Deutschland zu zerstören. Dies gipfelte in der ungewohnten Situation, dass die KPD im Ruhrkampf mit denselben Interessen wie die Reichsregierung aufwartete, zumal eine Stärkung Frankreichs keinesfalls im sowjetischen Interesse[64] lag. Und dennoch wollte bzw. konnte sie sich nicht dem nationalen Kurs der Reichsregierung anschließen, weil das gewissermaßen ihre Selbstaufgabe bedeutet hätte. Zwischen den Fronten stehend, war die Parteilinie in dieser Angelegenheit dann auch sehr gewunden, oft sogar widersprüchlich.[65]
Im Wesentlichen versuchte die KPD, die Ruhrkrise als eine Auseinandersetzung der deutschen und französischen Bourgeoisie darzustellen, die auf dem Rücken der deutschen Arbeiterschaft ausgetragen werden würde.[66] Die offizielle Parteilinie wurde dabei durch einen von der Zentrale veröffentlichten Leitartikel vorgegeben, der am 23. Januar im Zentralorgan der Partei, „Die Rote Fahne“, erschien. Die Losung, die beide Parteiziele in sich zu vereinen suchte, lautete in der Großschlagzeile: „Schlagt Poincaré und Cuno an der Ruhr und an der Spree“.[67] Die Umsetzung dieser ausgegebenen kommunistischen Losung schuf von Anfang an Schwierigkeiten. Die klarste Anweisung, wie sie in der Praxis zu verstehen sei, gab Paul Fröhlich in einem Artikel in der Internationalen Presse-Korrespondenz Anfang März 1923:
„Der Kampf gegen Poincaré muss durch systematische Sabotage im Ruhrgebiet durchgeführt werden, als proletarische Aktion und mittels revolutionärer Durchdringung der imperialistischen Armee. Gegen Cuno durch Bekämpfung des Nationalismus als Ideologie und durch Ausnutzung der gegenwärtigen Situation, die Arbeiterklasse in ihren Verteidigungskämpfen anzuführen und die Massen für den Generalstreik zu mobilisieren.“[68]
Dennoch ergaben sich Schwierigkeiten beim Vorgehen gegen die Reichsregierung auf Grund des intensiven Patriotismus, der die Menschen ergriff und sie für Argumente gegen Cuno unempfänglich machte. Daher legten sich die Kommunisten zunächst vor Ort darauf fest, den Besatzungsbehörden Widerstand zu leisten, um möglichst großen Einfluss auf die Ruhrarbeiter zu gewinnen, was gänzlich der Einheitsfrontpolitik entsprach.[69] Trotzdem versuchte die Parteizentrale dort, wo es sich anbot, Misstrauen gegen die deutsche Regierung zu schüren sowie Sympathien für sich selbst zu wecken, und widmete den Ereignissen im Ruhrgebiet größte Aufmerksamkeit.[70]
[...]
[1] Broué, S. 59
[2] Die Welt erobern, in: Der Spiegel, Nr. 44/1995, S. 51-56.
[3] Die deutsche Ausgabe folgte 1973.
[4] Vgl. Weber, Kommunismus S. 31.
[5] Vgl. ebd., S. 39ff.
[6] Zur ideologischen und programmatischen Konzeption der KPD siehe auch: Flechtheim, S. 328f.
[7] Vgl. Weber, Kommunismus, S. 56f; Weber, Vorwort S. 20.
[8] Insbesondere der Tod Rosa Luxemburgs bedeutete wohl auf weite Sicht eine Tragödie für den demokratischen Sozialismus und die internationale Arbeiterbewegung. Vgl. Flechtheim, S. 131
[9] Vgl. Weber, Vorwort, S. 20f; Weber, Kommunismus, S. 78f.
[10] Vgl. Weber, Kommunismus S. 82f. Der Zusammenschluss von KPD und USPD kam auch daher zustande, weil die „21 Bedingungen zur Aufnahme in die Komintern“ vorschrieben, dass es nur eine kommunistische Partei pro Land geben durfte. Auch die Namensgebung wurde vorgeschrieben: „Im Zusammenhang damit müssen alle Parteien, die der Kommunistischen Internationale angehören wollen, ihre Benennung ändern. Jede Partei, die der Kommunistischen Internationale angehören will, hat den Namen zu tragen: Kommunistische Partei des und des Landes (Sektion der Kommunistischen Internationale).“ (Leitsätze über die Bedingungen der Aufnahme in die Kommunistische Internationale, S. 394)
[11] Eine detaillierte Darstellung der Einheitsfronttaktik findet sich in Kapitel 4.1.
[12] Vgl. Weber, Kommunismus, S. 85ff.
[13] Siehe Kapitel 2.2.
[14] Vgl. Weber, Vorwort, S. 23; Weber, Kommunismus, S. 89.
[15] Vgl. Weber, Kommunismus, S. 90f; Meyer-Levine, S. 71f.
[16] Ein umfangreiche Darstellung der Ereignisse liefert auch: Angress, S. 139-257.
[17] Vorrangig geschah dies um den russischen Arbeitern neue Erfolge der Weltrevolution zu demonstrieren und von der misslichen Lage in Russland (bspw. vom Kronstädter Matrosenaufstand) abzulenken. Vgl. Weber, Kommunismus, S. 88.
[18] Vgl. Weber, Vorwort, S. 22.
[19] Vgl. Bock, S. 297f.
[20] Hoelz´ Schilderung der Ereignisse aus dem März 1921 findet sich in: Hoelz, Max, Vom weißen Kreuz zur roten Fahne, Jugend-, Kampf- und Zuchthauserlebnisse, Frankfurt/M., 1969.
[21] Vgl. Bock, S. 299ff.
[22] Das Scheitern des Aufstands wäre die Folge dieser Versäumnisse gewesen : „Der Märzaufstand im Jahre 1921 aber musste schon deshalb zu Falle kommen, weil er militärisch auch nicht einen Augenblick eine einheitliche Organisation, eine einheitliche Leitung zustande zu bringen vermochte und weil wieder die vielen militärischen Leitungen auch nicht einen Augenblick im Einklang mit der politischen Leitung der Bewegung standen.“ (Anonym erschienenen Schrift der Zentrale, S. 9)
[23] Vgl. Goldbach, S. 95.
[24] Vgl. ebd., S. 98. Dazu aus einer Rede Karl Radeks auf der Allrussischen Parteienkonferenz im Mai 1921: „Lenin hat ganz recht, wenn er sagt, dass wir mit der Tatsache eines unvermeidlichen Zusammenlebens mit dem Kapitalismus für eine Zeitlang rechnen müssen. Eine deutsche Revolution wird uns nicht sobald die Hilfe leisten können, wozu Deutschland jetzt im Stande wäre.“ (zit. nach Goldbach, S. 97.)
[25] Vgl. Ludewig, S. 25f, 28.
[26] Vgl. Firsov, S. 33.
[27] Vgl. Nolte, S. 109.
[28] Eine ausführlichere Betrachtung der Geschehnisse um Albert Schlageter erfolgt in Kapitel 4.2.
[29] Vgl. Nolte, S. 110ff.
[30] Vgl. ebd., S. 113f.
[31] Vgl. ebd., S. 119f.
[32] Vgl. Nolte, S. 125f.
[33] Die Regierung verfügte über keine parlamentarische Mehrheit mehr, nachdem die sozialdemokratischen Minister aus Protest gegen die ungleiche Behandlung von Sachsen und Bayern aus der Regierung ausgetreten waren, sodass die Koalition am 6. Oktober 1923 beendet wurde. Das zweite Kabinett Stresemanns war bis zum 30. November im Amt. Als Nachfolger von Stresemann wurde dann der Zentrumspolitiker Marx berufen, der trotz allem politischen Umbruchs die Kontinuität der wirtschaftlichen Direktion bewahrte. Vgl. Nolte, S. 127.
[34] In Frankreich löste der Sozialist Herriot Ministerpräsident Poincaré ab, der die treibende Kraft bei der Besatzung des Ruhrgebiets gewesen war und in England trat der Labour-Politiker MacDonald kurzzeitig an die Stelle des Konservativen Baldwin.
[35] Vgl. Nolte, S. 127f.
[36] Vgl. Holzer, S. 31f.
[37] Vgl. Goldbach, S. 101.
[38] Vgl. Buber-Neumann, S. 45.
[39] Vgl. Weber, Kommunismus, S. 86. Über die parteiinternen Auseinandersetzungen in Bezug auf die anzuwendende Einheitsfronttaktik in den Anfangsjahren der KPD siehe auch: Hemje-Oltmans, Dirk, Arbeiterbewegung und Einheitsfront - Zur Diskussion der Einheitsfronttaktik in der KPD 1920/21, Berlin, 1973.
[40] Radek: (…), wird die Bauernschaft in Deutschland keine entscheidende Rolle spielen. Dafür wird dort die Kleinbourgeoisie von enormer Bedeutung sein. Daher die ungeheure Bedeutung ihrer Neutralisierung.“ (Konspekt der Debatte des Politbüros, S.120)
[41] Vgl. Wenzel, S. 27 f.
[42] Vgl. ebd., S. 30f. Auch der Vorsitzende des Exekutiv-Komitees der Komintern (EKKI) Sinowjew machte keinen Hehl daraus, dass die Einheitsfronttaktik die Massen schneller auf die „Seite des Kommunismus herüberziehen“ sollte. (Internationale Presse-Korrespondenz, 1. Jg., 1921, S. 353)
[43] Vgl. Wenzel S. 31. Deutlich geht dieses Bestreben auch aus den Thesen des 8. Parteitages der KPD hervor. Die Einheitsfronttaktik wird als ein „Kampf um die Loslösung der Massen von der reformistischen Taktik und Führung“ bezeichnet. Sie werde Erfolg haben „trotz der Sabotage und des Widerstandes der reformistischen Führer, da immer stärker werdende Schichten auch der sozialdemokratischen Arbeiter in diese Kämpfe mit eintreten. Die Einheitsfront wird praktisch hergestellt durch die gemeinsame Abwehr der Offensive des Kapitals durch die Arbeiter.“ (Bericht über die Verhandlungen des 8. Parteitags der Kommunistischen Partei Deutschlands, S. 416)
[44] Vgl. Buber-Neumann, S. 55f.
[45] Vgl. Goldbach, S. 101.
[46] Vgl. Wenzel, S. 33.
[47] Protokoll des Vierten Weltkongresses der Kommunistischen Internationale, S. 1016.
[48] Siehe Kapitel 6.3.
[49] Etwa der „Hamburger Nationalbolschewismus“ der Linksradikalen Laufenberg und Wolffheim, der ,während des Ersten Weltkriegs entwickelt, schon auf Grund der nationalen Orientierung über außenpolitische Überlegungen im völligen Gegensatz zum konsequenten Internationalismus stand. Vgl. Bock, S. 274f.
[50] Lenin konstatierte die „himmelschreienden Absurditäten des Nationalbolschewismus“, die unvereinbar mit dem Programm einer proletarisch-revolutionären Partei zu sein schienen. Vgl. Bock, S. 278.
[51] Vgl. Wenzel, S. 103; Goldbach, S. 117, Weber, Kommunismus, S. 91.
[52] Vgl. Goldbach, 118f.
[53] Protokoll des fünften Kongress der Kommunistischen, S. 713.
[54] Vgl. Wenzel, S. 108.
[55] Die Rede Radeks Leo Schlageter, der Wanderer ins Nichts findet sich in: Internationale Presse-Korrespondenz 105, Berlin, 1923, S. 885f. oder in: Weber, Hermann (Hrsg.), Der deutsche Kommunismus. Dokumente, Köln, Berlin, 1963, S. 142ff.
[56] Vgl. Goldbach, 121f.
[57] Vgl. Wenzel, S. 115.
[58] Vgl. Angress, S. 372; Goldbach, S. 122.
[59] Trotz aller Nationalen Einheitsfrontbestrebungen wurde die faschistische Lehre und Politik in dieser Zeit mit aller Schärfe attackiert, was sich insbesondere durch die Organisation des landesweit geplanten „Antifaschistentages“ am 29. Juli äußerte. Vgl. Goldbach, S. 124; Wenzel, S. 117.
[60] Vgl. Wenzel S. 123.
[61] Vgl. Goldbach S. 124.
[62] Aus diesem Grund wurde der „Schlageter-Kurs“ auch von Parteirechter und Parteilinker mitgetragen.
[63] Vgl. Angress S. 384.
[64] Karl Radek etwa sah die Auswirkungen des Versailler Vertrages zunächst nicht als ein Instrument für die Beschleunigung der proletarischen Revolution in Deutschland, sondern vielmehr als geeignetes Mittel ein militärisch-diplomatisches Bündnis zwischen Deutschland und der Sowjetunion herbeizuführen. Vgl. Carr, S. 412.
[65] Vgl. Angress, S. 327; Wenzel, S. 66.
[66] Vgl. Angress, S. 330.
[67] Die Rote Fahne, Nr. 18, Berlin, 23.1.1923
[68] Fröhlich, S. 183f.
[69] Vgl. Angress, S. 331f.
[70] Vgl. Wenzel, S. 68.
- Citar trabajo
- Stefan Schusterbauer (Autor), 2007, Der „Deutsche Oktober“ und die Politik der KPD im Krisenjahr 1923, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/120995