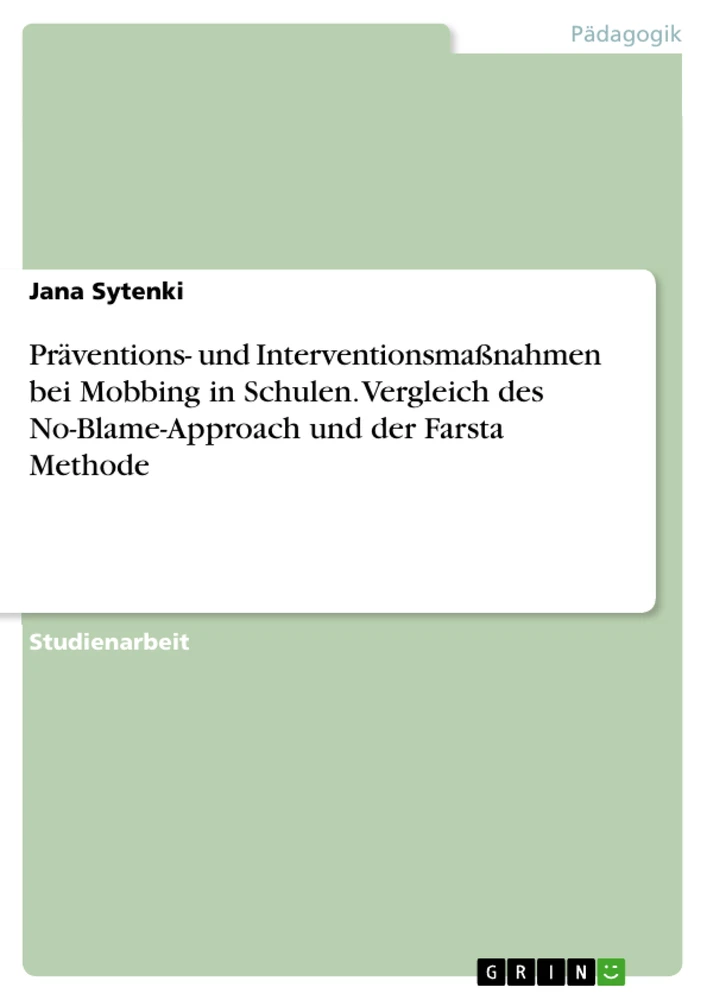Mobbing ist ein allgegenwärtiges Thema in unserer Gesellschaft. Jeder Mensch hat eine ungefähre Vorstellung, wenn er mit dem Begriff "Mobbing" konfrontiert wird. Eine Sonderauswertung der im Jahr 2017 von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung veröffentlichten PISA Studie, sagt aus, dass jede*r sechste Schüler*in im Alter von 15 Jahren regelmäßig Opfer von Mobbinghandlungen wird. Nach einer Studie der Bertelsmann- Stiftung haben doppelte so viele Schüler*innen Angst davor, ein Opfer von verbaler oder non-verbaler Gewalt zu werden. Eine weitere Auswertung der Bundeszentrale für politische Bildung zeigte, dass Kinder und Jugendliche, die in ihrer Schulzeit gemobbt wurden, unter lebenslangen psychischen wie auch physischen Folgen leiden. Aus diesem Grund ist die zeitnahe Durchführung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen an Schulen wichtiger als je zuvor.
Dem zu Folge beschäftigt sich diese Facharbeit mit den zwei Präventions- und Interventionsmaßnahmen "No-Blame-Approach" und der "Farsta Methode". Im Rahmen dieser Ausarbeitung soll die Forschungsfrage „Inwieweit ähneln und
unterscheiden sich die Präventions- und Interventionsmaßnahmen "No-Blame Approach" und die "Farsta Methode" bei Mobbing in Schulen“ beantwortet werden.
Die folgende Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Das erste Kapitel umfasst die Einleitung der Forschungsfrage und der Zielsetzung sowie die Methodik und den Aufbau. Im zweiten Kapitel wird Grundlagenwissen für das Thema "Mobbing" sowie "Mobbing in deutschen Schulen" hergestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den Präventions- und Interventionsmaßnahmen "No-Blame-Approach" und der "Farsta Methode". Darauf folgt das vierte Kapitel, welches sich mit der Analyse der Unterschiede der zuvor genannten Methoden befasst. Anschließend erfolgt im fünften Kapitel eine kritische Stellungnahme zu den Ergebnissen der Analyse. Den Abschluss bildet das Fazit in Kapitel fünf.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsfrage und Zielsetzung
- Methodik und Aufbau
- Mobbing im Überblick
- Definition und Abgrenzung zum Konflikt
- Die Akteure
- Psychische und physische Folgen
- Mobbing in deutschen Schulen
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen
- Die Farsta Methode
- Ziele
- Durchführung
- Vorteile und Nachteile
- Das No-Blame-Approach
- Ziele
- Durchführung
- Vorteile und Nachteile
- Analyse der Unterschiede der Präventions- und Interventionsmaßnahmen „No-Blame-Approach“ und „Farsta Methode“
- Kritische Betrachtung der Ergebnisse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit untersucht die Präventions- und Interventionsmaßnahmen „No-Blame-Approach“ und die „Farsta Methode“ im Kontext von Mobbing an Schulen. Ziel ist es, die Ähnlichkeiten und Unterschiede der beiden Ansätze zu analysieren, um ein tieferes Verständnis ihrer jeweiligen Stärken und Schwächen zu gewinnen.
- Definition und Abgrenzung von Mobbing zu Konflikten
- Charakterisierung von Mobbing-Akteuren und den Auswirkungen auf Betroffene
- Analyse der „Farsta Methode“ und des „No-Blame-Approach“ als Präventions- und Interventionsmaßnahmen
- Vergleich der beiden Methoden hinsichtlich ihrer Ziele, Durchführung und Effektivität
- Kritische Bewertung der Ergebnisse und Ableitung von Empfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Mobbing ein, stellt die Forschungsfrage nach den Ähnlichkeiten und Unterschieden der beiden Interventionsmethoden, „No-Blame-Approach“ und „Farsta Methode“, vor und beschreibt die Methodik und den Aufbau der Arbeit.
- Mobbing im Überblick: Dieses Kapitel liefert eine Definition von Mobbing, grenzt es von Konflikten ab und beleuchtet die typischen Merkmale von Mobbinghandlungen. Zudem werden die Akteure im Mobbingprozess und deren typische Verhaltensweisen diskutiert, sowie die psychischen und physischen Folgen von Mobbing für Betroffene.
- Mobbing in deutschen Schulen: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Verbreitung von Mobbing in deutschen Schulen und beleuchtet die Ursachen und Folgen für die betroffenen Schüler*innen.
- Präventions- und Interventionsmaßnahmen: Dieses Kapitel stellt die „Farsta Methode“ und den „No-Blame-Approach“ als zwei gängige Präventions- und Interventionsmaßnahmen vor. Es werden die Ziele, Durchführung und die jeweiligen Vor- und Nachteile der Methoden im Detail beschrieben.
- Analyse der Unterschiede der Präventions- und Interventionsmaßnahmen „No-Blame-Approach“ und „Farsta Methode“: Dieses Kapitel analysiert die Unterschiede zwischen den beiden Methoden im Hinblick auf ihre Herangehensweise, ihre Zielgruppen und ihre Effektivität. Dabei wird die Frage untersucht, welche Methode sich für welche Situationen am besten eignet.
Schlüsselwörter
Die Facharbeit konzentriert sich auf die Präventions- und Interventionsmaßnahmen „No-Blame-Approach“ und die „Farsta Methode“ im Kontext von Mobbing in Schulen. Kernbegriffe sind Mobbing, Konflikt, Täter, Opfer, Prävention, Intervention, Analyse, Vergleich und Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „No-Blame-Approach“ bei Mobbing?
Es ist eine Interventionsmethode, die auf Schuldzuweisungen verzichtet und stattdessen eine Unterstützungsgruppe bildet, um eine Lösung für das Opfer zu finden.
Wie funktioniert die „Farsta-Methode“?
Im Gegensatz zum No-Blame-Approach setzt die Farsta-Methode auf direkte Konfrontation der Täter durch Lehrer, um das Mobbingverhalten sofort zu stoppen.
Wie häufig ist Mobbing an deutschen Schulen?
Laut PISA-Sonderauswertung von 2017 ist jeder sechste 15-jährige Schüler in Deutschland regelmäßig Opfer von Mobbing.
Was sind die langfristigen Folgen von Schulmobbing?
Betroffene leiden oft lebenslang unter psychischen Folgen wie Depressionen, Ängsten oder physischen psychosomatischen Beschwerden.
Welche Methode eignet sich besser für die Praxis?
Die Arbeit analysiert die Unterschiede und zeigt auf, dass die Wahl der Methode von der Schwere des Mobbings und der Schulkultur abhängt.
- Quote paper
- Jana Sytenki (Author), 2021, Präventions- und Interventionsmaßnahmen bei Mobbing in Schulen. Vergleich des No-Blame-Approach und der Farsta Methode, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1210347