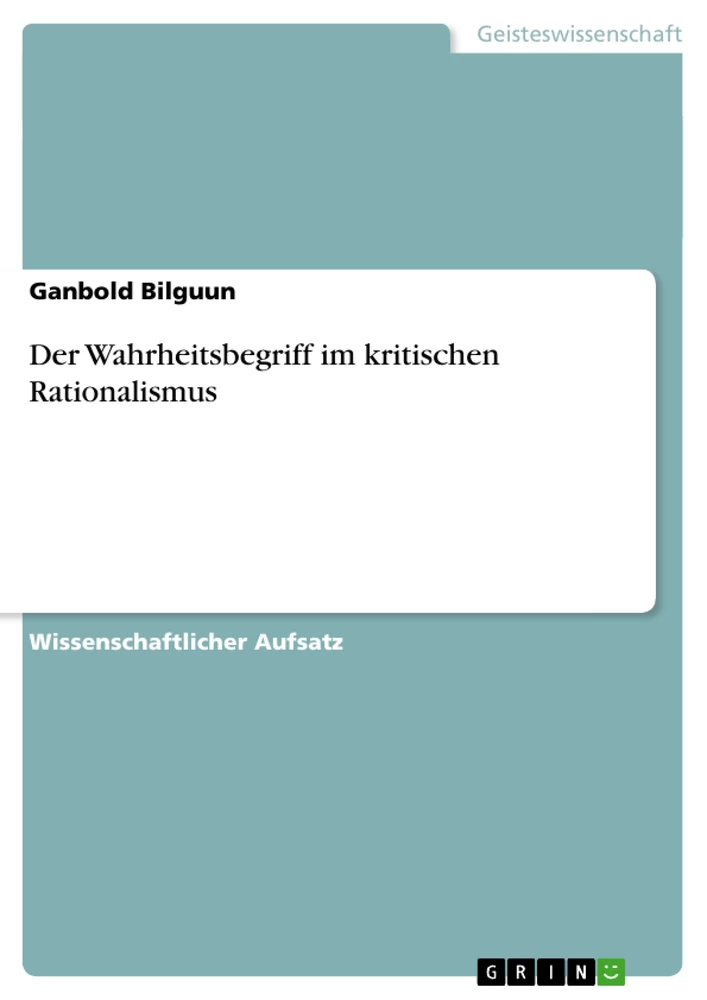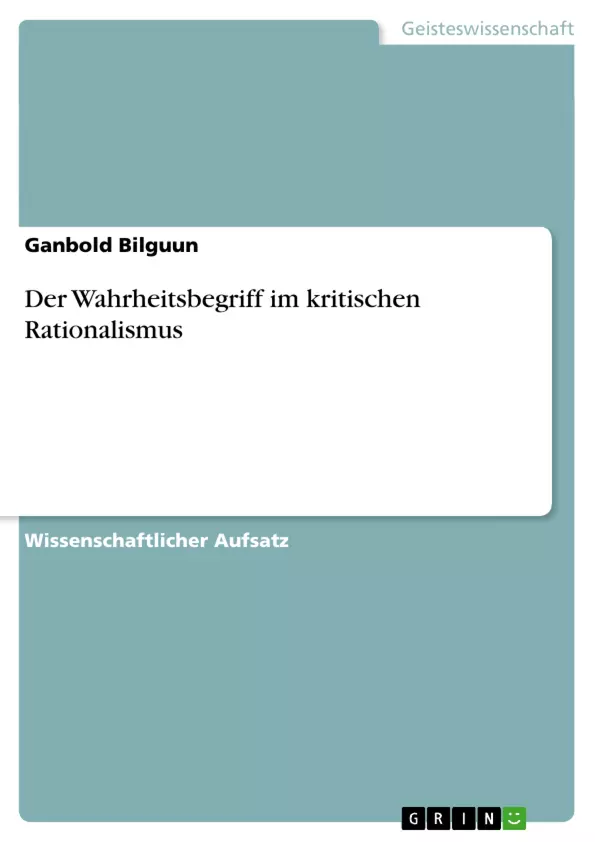Eine der großen Menschheitsfragen – die Frage nach der Wirklichkeit der Wirklichkeit und wie wir sie erfahren können – hat der deutsche Philosoph Emanuel Kant in dem berühmten Satz „Was können wir wissen?“ auf den Punkt gebracht. Eine ganze philosophische Teildisziplin, die Epistemologie (Erkenntnistheorie), beschäftigt sich ausschließlich mit den Voraussetzungen für die Produktion unseres Wissens über die Welt. Im Laufe der Geschichte hat es sich dabei mehrfach erwiesen, dass gesichert geglaubte Wissensbestände sich im Nachhinein als nur vorübergehend richtig bewährt haben. Als zwei berühmte Beispiele sollen hier nur die Ablösung des geozentrischen durch das heliozentrische Weltbild und der Wechsel von der Newtonschen Mechanik zu Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie genannt werden.
Diesem Umstand, dass es ein absolutes, endgültiges Wissen nicht gibt und es viel-mehr historisch determiniert ist und in einem ständigen Prozess der Revision voran-getrieben wird, trägt die von dem in Wien geborenen Philosophen Karl R. Popper (1902-1994) begründete Schule des kritischen Rationalismus Rechnung.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Der Wahrheitsbegriff im kritischen Rationalismus
3. Induktion und Deduktion: Das Induktionsproblem
4. Schluss: Der kritische Realismus – Theorie oder Lebenseinstellung?
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Eine der großen Menschheitsfragen – die Frage nach der Wirklichkeit der Wirklichkeit und wie wir sie erfahren können – hat der deutsche Philosoph Emanuel Kant in dem berühmten Satz „Was können wir wissen?“ auf den Punkt gebracht. Eine ganze philosophische Teildisziplin, die Epistemologie (Erkenntnistheorie), beschäftigt sich ausschließlich mit den Voraussetzungen für die Produktion unseres Wissens über die Welt. Im Laufe der Geschichte hat es sich dabei mehrfach erwiesen, dass gesichert geglaubte Wissensbestände sich im Nachhinein als nur vorübergehend richtig bewährt haben. Als zwei berühmte Beispiele sollen hier nur die Ablösung des geozentrischen durch das heliozentrische Weltbild und der Wechsel von der Newtonschen Mechanik zu Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie genannt werden.
Diesem Umstand, dass es ein absolutes, endgültiges Wissen nicht gibt und es vielmehr historisch determiniert ist und in einem ständigen Prozess der Revision vorangetrieben wird, trägt die von dem in Wien geborenen Philosophen Karl R. Popper (1902-1994) begründete Schule des kritischen Rationalismus Rechnung.
Den Grundstein zu seiner Theorie legte er in der 1934 erstmals erschienenen Logik der Forschung:[1] Ausgehend von Sokrates Satz „Ich weiß, dass ich nichts weiß“ glaubte Popper bis zum Ende seines Lebens daran, dass der eigentliche Wert wissenschaftlicher Theorien und des durch sie produzierten Wissens nicht in ihrer Allgemeingültigkeit und Überzeitlichkeit bestehe, sondern dass sie potentiell falsifizierbar, also widerlegbar, sein müssten.[2] Was Theorien leisten können, ist, dass sie „[…] vorläufige Formulierungen und Hypothesen liefern, die in kritischer Diskussion stetige Überprüfung und Verbesserung zulassen.“[3] Im trial-and-error -Verfahren findet eine Theorie solange Anwendung, bis sie widerlegt, modifiziert oder durch eine geeignetere ersetzt wurde usw. Wissenschaft ist also in Poppers Augen ein im Grunde unabschließbarer Prozess der Annäherung an die Wahrheit, wenngleich diese unerreichbar ist. Mit einem Zitat von Wilhelm von Humboldt, dem Begründer der nach ihm benannten Berliner Universität, ausgedrückt, betrachtete Popper „[…] Wissenschaft als etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Aufzufindendes".[4] Laut Eberhard Döring lassen sich in Poppers Gesamtwerk zwei übergreifende Fragenkomplexe ausmachen: Zum Einen die Frage nach dem Abgrenzungskriterium (Wie kann richtige Wissenschaft von Pseudowissenschaft unterschieden werden?)[5] und zum Anderen beschäftigte er sich mit dem Problem der Induktion, womit das Aufstellen verallgemeinerbarer Aussagen auf der Grundlage „[…] singulärer empirischer Beobachtungen“[6] gemeint ist.
Neben dem Wahrheitsbegriff im kritischen Rationalismus möchte dieser kurze Aufsatz sich also mit dem sogenannten Induktionsproblem und seiner Behandlung durch Karl Popper beschäftigen. Wie Hans Albert in seinem Aufsatz Varianten des kritischen Rationalismus hinweist, gibt es den kritischen Rationalismus als eine in sich geschlossene Denkrichtung zwar bei Popper, seine Schüler und Anhänger haben ihn aber nicht in allen Punkten übernommen und zum Teil sehr eigene Vorstellungen entwickelt.[7] Demzufolge kann das Ziel dieser Darstellung nur sein, die Kernpunkte dieser Denkrichtung vorzustellen. Größere Ausführlichkeit hätte den zur Verfügung stehenden Rahmen gesprengt, so dass vielleicht als unzulässig empfundene Verkürzungen komplexer Zusammenhänge vorgenommen werden mussten. Im abschließenden Erörterungsteil möchte ich auf den persönlichen Eindruck eingehen, den der kritische Rationalismus bei mir hinterlassen hat, und mich mit der Frage beschäftigen, inwieweit es sich hier nicht nur um eine Theorie, sondern um eine Lebenseinstellung handelt.
2. Der Wahrheitsbegriff im kritischen Rationalismus
Wie aus der Einleitung ersichtlich geworden ist, gibt es im kritischen Rationalismus keinen Platz mehr für letzte, unabänderliche Theorien oder Wahrheiten. Als Grundannahme wird davon ausgegangen, dass die Realität als eine „[…] subjektunabhängige Objektivität“[8] existiert. D. h., dass es dort draußen eine unabhängig vom Beobachter bestehende objektive Wirklichkeit gibt, die auch dann fortbesteht, wenn der Beobachter zum Beispiel einen Mittagsschlaf machen oder sterben würde. Das Mittel, dessen der Mensch sich zum Erkennen dieser Realität bedient, ist die Vernunft. Rationalismus bedeutet also vereinfacht gesagt, dass der Mensch sich zum Erkennen der Welt seines Verstandes bedient. Laut Johannes Hirschberger muss hierbei aber zwischen „[…] dem Rationalismus als einer erkenntnistheoretischen Grundhaltung und dem Rationalismus als einer wissenschaftlichen oder schulischen Methodik“[9] unterschieden werden. Anders als häufig unterstellt, sei der Rationalismus nämlich keine „[…] reine Begriffsphilosophie“, die „[…] alle Erkenntnis nur aus der Vernunft entspringen lassen“[10] wolle. Bereits Descartes hätte gefordert, dass der Philosoph bei seinen Betrachtungen die Empirie, die Erfahrung der sinnlichen Welt, nicht außer Acht lassen dürfe.[11] Auch Popper lehnte einen Rationalismus, der auf eine Ergänzung durch die Erfahrung verzichtet, ab. Für ihn umfasste der Begriff sowohl Empirismus als auch Intellektualismus, „[…] in derselben Weise, in der die Wissenschaft von Experimenten wie auch vom Denken Gebrauch macht.“[12] Aber dennoch wird von den Rationalisten „[…] das Notwendige, sei es des Seins, sei des Geistes oder der Werte“[13] stärker als das empirische Material gewichtet. Was laut Hirschberger den Rationalismus wesentlich vom Empirismus unterscheidet, ist der Fakt, dass letzterer die Erfahrung der Sinne als die „[…] Vollendung und das Ganze“[14] betrachtet und nicht mehr an eine unsichtbare, der sinnlichen Erfahrung unzugängliche Wirklichkeit glaubt. „Da sie [die Sinneserfahrung; Anm. v. mir, B.G.] aber niemals abgeschlossen ist, weil der Weltprozeß weitergeht, kann es hier keine ewigen, notwendigen, das Partikulare transzendierenden allgemeingültigen Wahrheiten, Werte und Ideale geben.“[15] Das ist bemerkenswert, da das letzte Zitat von Hirschberger sich ja auf den Empirismus bezieht, aber eigentlich das Wirklichkeitsverständnis Poppers, der sich als Rationalisten bezeichnet, wiedergibt.
[...]
[1] Vgl.: Döring, Eberhard: Karl R. Popper. Einführung in Werk und Leben. Bonn 2 1992, S. 9.
[2] Vgl.: Schorrp, Maria: Popper, Karl Raimund. In: Metzler Philosophen Lexikon. Von den Vorsokratikern bis zu den neuen Philosophen. Hrsg. v. Bernd Lutz. Stuttgart u. a. 3 2003, S. 565.
[3] Döring: Karl R. Popper. Einführung in Werk und Leben, S. 9.
[4] Humboldt, Wilhelm von: Ueber die innere und äussere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. In: W. v. H. Werke in 5 Bänden. Bd. IV: W. v. H. Schriften zur Politik und zum Bildungswesen. Hrsg. v. Andreas Flitner u. Klaus Giel. Stuttgart 1964, S. 257.
[5] Vgl.: Ebd., S. 14.
[6] Ebd.
[7] Albert, Hans: Varianten des kritischen Rationalismus. In: Karl Poppers kritischer Rationalismus heute: zur Aktualität kritisch-rationaler Wissenschaftstheorie. Hrsg. v. Jan M. Böhm, Heiko Holweg und Claudia Hoock. Tübingen 2002, S. 3.
[8] Ebd., S. 15.
[9] Hirschberger, Johannes: Geschichte der Philosophie. Bd. II: Neuzeit und Gegenwart (Sonderausgabe). Köln 2003, S. 87
[10] Ebd.
[11] Vgl.: Ebd., S. 88.
[12] Popper, Karl: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Bd. II: Falsche Propheten: Hegel, Marx und die Folgen. Hrsg. v. Hubert Kiesewetter. Tübingen 8 2003, S. 262f.
[13] Ebd.
[14] Ebd.
[15] Ebd.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern des Wahrheitsbegriffs bei Karl Popper?
Wahrheit ist im kritischen Rationalismus ein Ideal, dem man sich nur annähern kann. Absolutes, endgültiges Wissen gibt es nicht.
Was besagt das Falsifikationsprinzip?
Wissenschaftliche Theorien müssen potenziell widerlegbar (falsifizierbar) sein. Eine Theorie gilt so lange als bewährt, bis sie widerlegt wird.
Was versteht man unter dem Induktionsproblem?
Es beschreibt die Unmöglichkeit, von Einzelfällen (Induktion) auf allgemeingültige Gesetze zu schließen. Popper setzt stattdessen auf Deduktion.
Wie unterscheidet sich Rationalismus von Empirismus?
Rationalismus betont die Vernunft als Erkenntnisquelle. Popper verbindet dies mit der Erfahrung (Empirie), lehnt aber rein induktive Erfahrung als Wahrheitsquelle ab.
Ist der kritische Rationalismus mehr als eine wissenschaftliche Theorie?
Ja, er kann auch als Lebenseinstellung verstanden werden, die durch Fehlertoleranz, Kritikfähigkeit und ständige Überprüfung von Überzeugungen geprägt ist.
- Citation du texte
- BA Ganbold Bilguun (Auteur), 2008, Der Wahrheitsbegriff im kritischen Rationalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121125