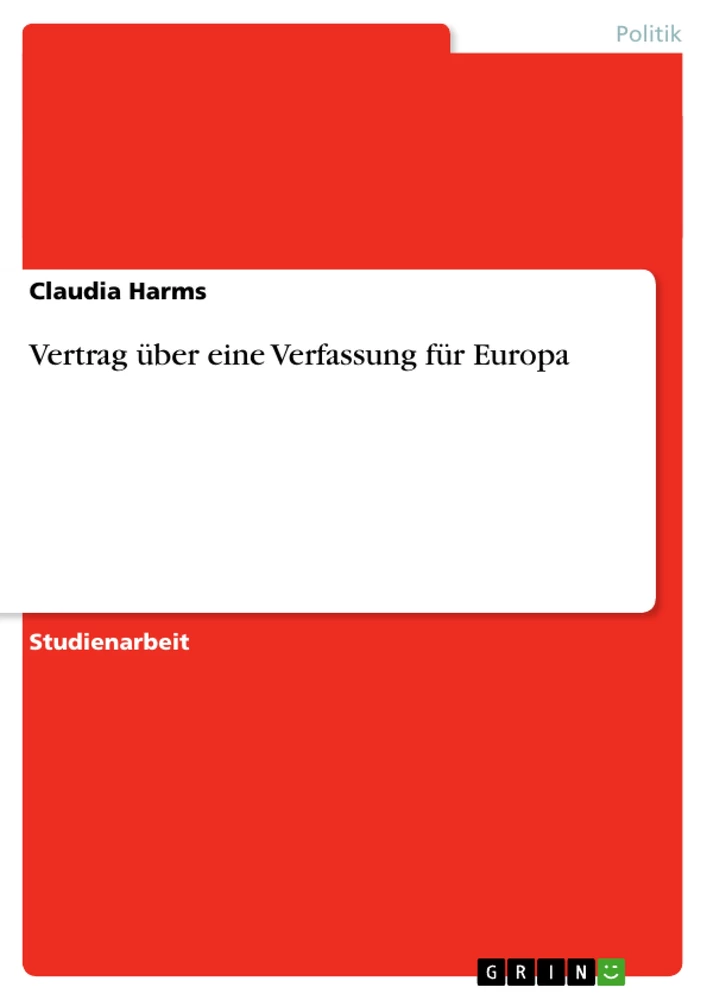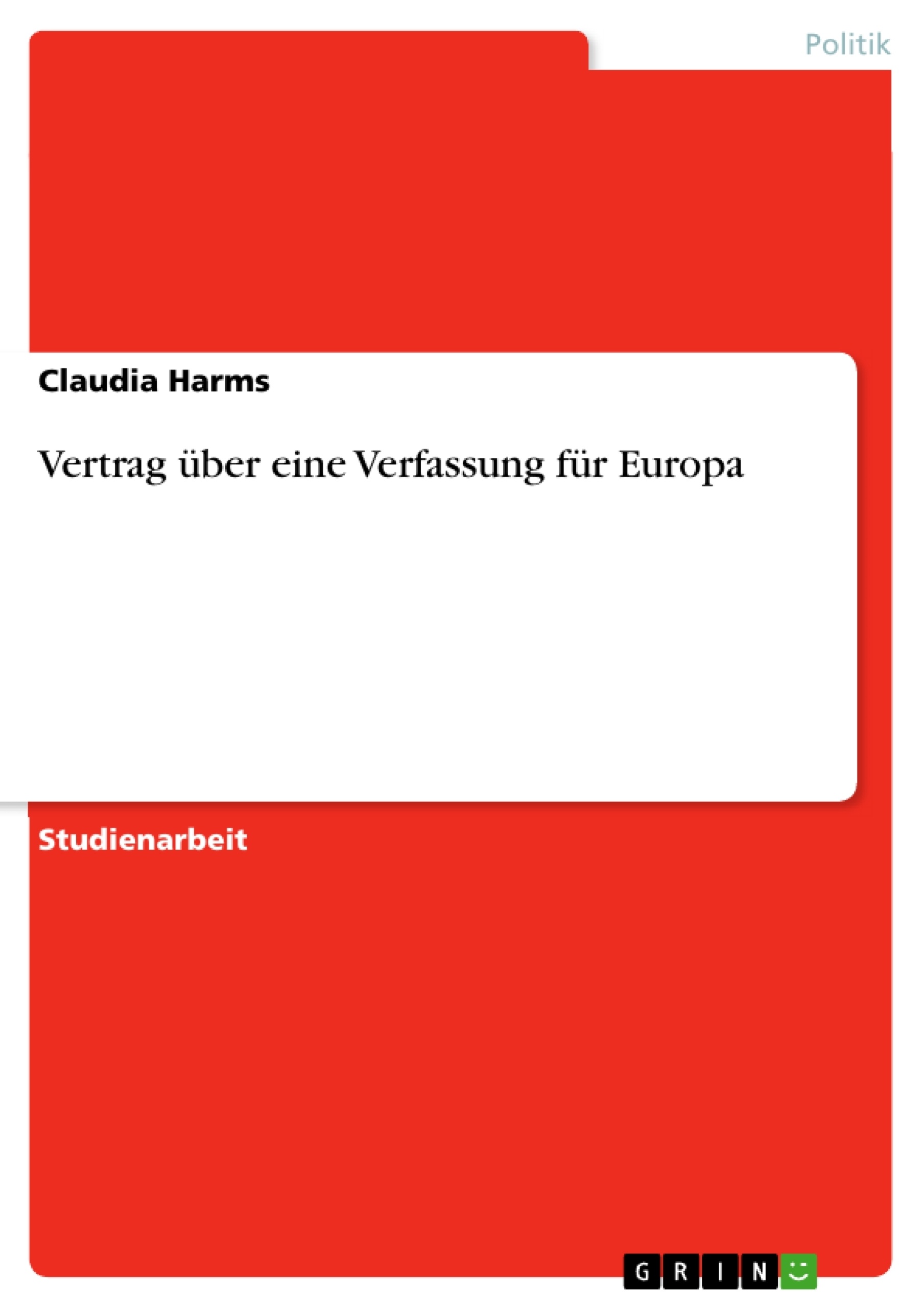Der Europäische Verfassungsvertrag ist verabschiedet – der Ratifizierungsprozess läuft in den Mitgliedstaaten der EU seit einiger Zeit. Die Bürger Frankreichs und der Niederlande haben mit Mehrheit sich schon dagegen ausgesprochen. Die deutsche Ratspräsidentschaft möchte einen Fahrplan entwickeln, wie der inzwischen ins Stocken geratene Prozess wieder in Gang und zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden kann.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit folgenden Fragestellungen:
1. Welche Vor- bzw. Nachteile bringt das Verfahren des Konvents, mit dem der Vertrag für
eine Verfassung vorbereitet worden ist, gegenüber den bisher üblichen Regierungskonferenzen?
2. Wie definiert man eine „Verfassung“? Handelt es sich bei dem vorliegenden Text um eine Verfassung?
3. Inwieweit würde sich bei dem Inkrafttreten des Verfassungsvertrags das Machtgleichgewicht
der EU-Organe untereinander ändern?
4. Wäre eine EU-Verfassung nach dem vorliegenden Text eher wirtschaftsliberal oder eher sozialstaatlich ausgerichtet?
Inhaltsverzeichnis
- Welche Vor- bzw. Nachteile bringt das Verfahren des Konvents, mit dem der Vertrag für eine Verfassung vorbereitet worden ist, gegenüber den bisher üblichen Regierungskonferenzen?
- Wie definiert man eine „Verfassung“? Handelt es sich bei dem vorliegenden Text um eine Verfassung?
- Inwieweit würde sich bei dem Inkrafttreten des Verfassungsvertrags (VVE) das Machtgleichgewicht der EU-Organe untereinander ändern?
- Wäre eine EU-Verfassung nach dem vorliegenden Text eher wirtschaftsliberal oder eher sozialstaatlich ausgerichtet?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert den Vertrag über eine Verfassung für Europa, indem sie dessen Entstehungsgeschichte, insbesondere das Konventsverfahren, untersucht und die potenziellen Auswirkungen auf das Machtgleichgewicht der EU-Organe sowie die wirtschafts- und sozialpolitische Ausrichtung bewertet. Die Arbeit setzt sich kritisch mit den Vor- und Nachteilen des Konvents im Vergleich zu traditionellen Regierungskonferenzen auseinander.
- Vergleich des Konventsverfahrens mit traditionellen Regierungskonferenzen
- Definition und Charakterisierung einer Verfassung im Kontext der EU
- Auswirkungen des Verfassungsvertrags auf das Machtgleichgewicht der EU-Organe
- Wirtschafts- und sozialpolitische Ausrichtung des Verfassungsvertrags
- Legitimität und Transparenz des Konventsverfahrens
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Dieses Kapitel vergleicht das Konventverfahren mit herkömmlichen Regierungskonferenzen. Es werden die Vorteile des Konvents hinsichtlich Legitimität, Transparenz und Beteiligung der Bürger hervorgehoben. Gleichzeitig werden die Nachteile wie der zeitaufwendige Prozess und das faktische Vetorecht der Mitgliedsstaaten angesprochen.
Kapitel 2: Kapitel 2 befasst sich mit der Definition des Begriffs „Verfassung“ und untersucht, ob der vorliegende Vertrag diese Kriterien erfüllt. Dieser Abschnitt analysiert die konstitutionellen Aspekte des Vertragstextes.
Kapitel 3: Kapitel 3 analysiert die potenziellen Auswirkungen des Vertrags auf das Machtgleichgewicht innerhalb der EU-Institutionen. Es werden die Veränderungen der Machtverhältnisse zwischen den Organen der EU im Falle eines Inkrafttretens untersucht.
Schlüsselwörter
Vertrag über eine Verfassung für Europa, Konventsverfahren, Regierungskonferenzen, EU-Organe, Machtgleichgewicht, Legitimität, Transparenz, Wirtschaftsliberalismus, Sozialstaat, Verfassungsrecht, Europäische Integration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einem Konvent und einer Regierungskonferenz?
Ein Konvent ist transparenter und bezieht Parlamentarier sowie die Zivilgesellschaft ein, während Regierungskonferenzen klassische diplomatische Verhandlungen zwischen Exekutiven hinter verschlossenen Türen sind.
Ist der EU-Verfassungsvertrag rechtlich gesehen eine echte Verfassung?
Dies ist umstritten. Er enthält zwar konstitutionelle Elemente, bleibt aber völkerrechtlich ein Vertrag zwischen souveränen Staaten, was die Definition einer „Verfassung“ verkompliziert.
Wie hätte sich das Machtgleichgewicht der EU-Organe durch den Vertrag verändert?
Der Vertrag sah eine Stärkung des Europäischen Parlaments und eine Neudefinition der Kompetenzen zwischen Kommission, Rat und Parlament vor, um die demokratische Legitimität zu erhöhen.
War die geplante EU-Verfassung eher wirtschaftsliberal oder sozialstaatlich?
Kritiker sahen oft eine wirtschaftsliberale Dominanz durch die Verankerung des Binnenmarktes, während Befürworter auf die Aufnahme der Grundrechtecharta als sozialstaatliches Element verwiesen.
Warum scheiterte der Ratifizierungsprozess in einigen Ländern?
Insbesondere in Frankreich und den Niederlanden lehnten die Bürger den Vertrag in Referenden ab, was den Prozess ins Stocken brachte und zur Reflexionsphase führte.
- Arbeit zitieren
- Claudia Harms (Autor:in), 2007, Vertrag über eine Verfassung für Europa, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121315