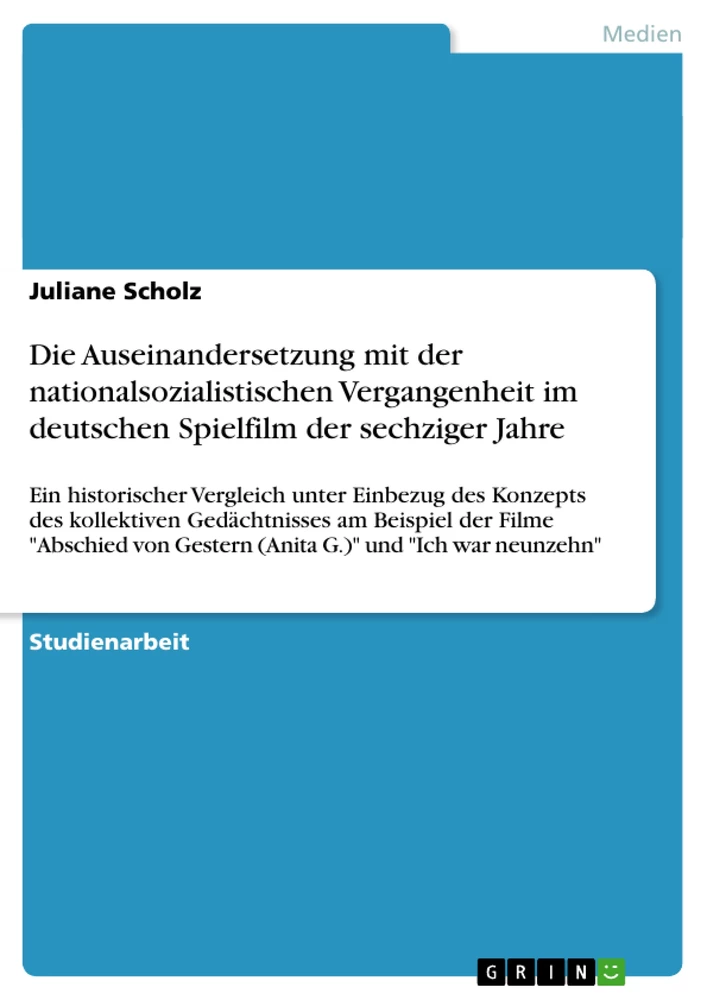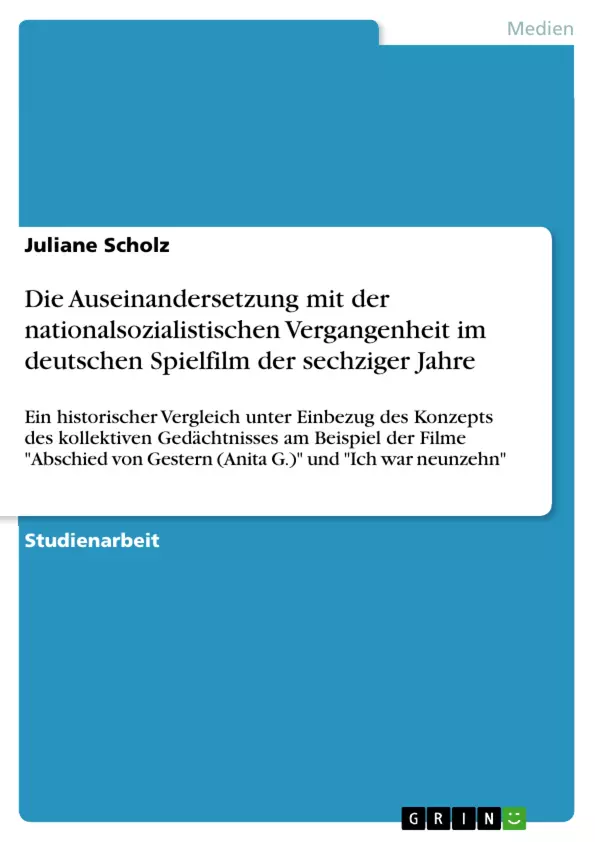In der vorliegenden Arbeit soll anhand des Vergleichs zweier Filme die Auseinandersetzung beider deutscher Staaten mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in den sechziger Jahren erhellt werden. Insofern handelt es sich um einen historischen Vergleich der Narrative und Motive, die durch den Film einerseits in die Gesellschaft hinein vermittelt werden. Als methodisches Konstrukt soll das kulturelle Gedächtnis nach ASSMANN ET AL. das filmanalytische Vorgehen insofern erweitern, als dass Film weder als ein reines sozipolitisches Konstrukt, noch als Kunstprodukt für sich allein steht, sondern immer ein komplexer Prozess aus künstlerischen Darstellungsformen und ästhetischen Praktiken, aber auch aus historisch-kulturellen Praktiken und sozialer Bedingtheit darstellt. Neben der Methode der Filmanalyse mit Bezugnahme auf den Produktions- und Rezeptionskontext der einzelnen Werke werden auch kulturpolitische Rahmenbedingungen in Rückbindung an ihre Wirkung auf die Filmwerke aber auch die kollektive Identität der Deutschen analysiert.
Nach einem Methodenteil, der die Theorieprobleme ausführen wird, folgen im Hauptteil die Filmanalysen der Werke Abschied von Gestern von ALEXANDER KLUGE aus dem Jahr 1966 und Ich war neunzehn von KONRAD WOLF aus dem Jahr 1968.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Film und kulturelles Gedächtnis
- 2.1 Das kollektive Gedächtnis Assmanns und seine Anwendung auf das Medium Film
- 2.2 Medien und ihre Doppelstellung
- 2.3 Das kollektive Gedächtnis als integrativer methodischer Ansatz
- 2.4 Spielfilm zwischen Fiktion und Authentizität
- 3. Kulturpolitik in der DDR
- 3.1 Sozialistischer Realismus und Filmproduktion
- 3.2 Das 11. Plenum und seine Folgen
- 3.3 Ich war neunzehn
- 3.3.1 ästhetische Stilmittel
- 3.3.2 Analyse der Narrative zur Entstehung des Nationalsozialismus und Schuldfrage
- 3.3.3 Opfer des Nationalsozialismus
- 3.3.4 Zusammenfassung Ich war neunzehn
- 4. Kulturpolitik in der BRD
- 4.1 Der Niedergang des Kinos in der BRD
- 4.2 Neuer Deutscher Film
- 4.3 Abschied von Gestern (Anita G.)
- 4.3.1 ästhetische Stilmittel
- 4.3.2 Analyse der Narrative des Nationalsozialismus
- 4.3.3 Die Vergangenheit in der Gegenwart - Täter und Opfer
- 4.3.4 Zusammenfassung Abschied von Gestern
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auseinandersetzung beider deutscher Staaten mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in den 1960er Jahren anhand eines Vergleichs der Filme "Abschied von Gestern" und "Ich war neunzehn". Der Fokus liegt auf der Analyse der Narrative und Motive, die durch diese Filme vermittelt wurden, unter Einbezug des Konzepts des kollektiven Gedächtnisses nach Assmann. Die kulturpolitischen Rahmenbedingungen und deren Einfluss auf die Filme und die kollektive Identität werden ebenfalls betrachtet.
- Der historische Vergleich der filmischen Darstellung der NS-Vergangenheit in der DDR und BRD
- Die Rolle des kollektiven Gedächtnisses in der Verarbeitung der NS-Vergangenheit
- Analyse der Narrative zur Entstehung des Nationalsozialismus und der Schuldfrage
- Die Darstellung von Tätern und Opfern im Kontext der NS-Vergangenheit
- Der Einfluss von Kulturpolitik auf die filmische Darstellung der Geschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit und die methodische Vorgehensweise. Kapitel 2 erläutert das Konzept des kollektiven Gedächtnisses nach Assmann und dessen Anwendung auf das Medium Film, wobei die Doppelstellung von Medien als Speicher und Verbreitungsmedien hervorgehoben wird. Kapitel 3 analysiert die Kulturpolitik der DDR, den Sozialistischen Realismus und die Auswirkungen des 11. Plenums auf die Filmproduktion, gefolgt von einer detaillierten Analyse von "Ich war neunzehn". Kapitel 4 befasst sich mit der Kulturpolitik der BRD, dem Niedergang des Kinos und dem Neuen Deutschen Film, mit anschließender Analyse von "Abschied von Gestern".
Schlüsselwörter
Kollektives Gedächtnis, Film und Erinnerungskultur, Nationalsozialismus, DDR, BRD, "Abschied von Gestern", "Ich war neunzehn", Kulturpolitik, Filmanalyse, Narrative, Schuldfrage, Täter und Opfer.
Häufig gestellte Fragen
Wie verarbeiteten Filme der 60er Jahre die NS-Vergangenheit?
Filme dienten als Medium des kulturellen Gedächtnisses, um Narrative über Schuld, Täter und Opfer in die Gesellschaft zu vermitteln.
Was ist das Thema von Konrad Wolfs „Ich war neunzehn“?
Der DDR-Film thematisiert die Rückkehr eines jungen Emigranten als Rotarmist nach Deutschland und reflektiert die Schuldfrage und den Sozialistischen Realismus.
Worum geht es in Alexander Kluges „Abschied von Gestern“?
Dieser Film des Neuen Deutschen Films (BRD) zeigt die Schwierigkeiten einer jungen Frau, die mit der NS-Vergangenheit ihrer Familie in der Gegenwart konfrontiert wird.
Welchen Einfluss hatte die Kulturpolitik in der DDR auf den Film?
Die DDR-Filmproduktion war stark vom Sozialistischen Realismus und politischen Ereignissen wie dem 11. Plenum der SED geprägt, was die künstlerische Freiheit einschränkte.
Was bedeutet „Kulturelles Gedächtnis“ nach Assmann im Filmkontext?
Film wird als Speicher und Vermittler historischer Erfahrungen betrachtet, der die kollektive Identität einer Nation entscheidend mitformt.
- Citation du texte
- Juliane Scholz (Auteur), 2008, Die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit im deutschen Spielfilm der sechziger Jahre , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121373