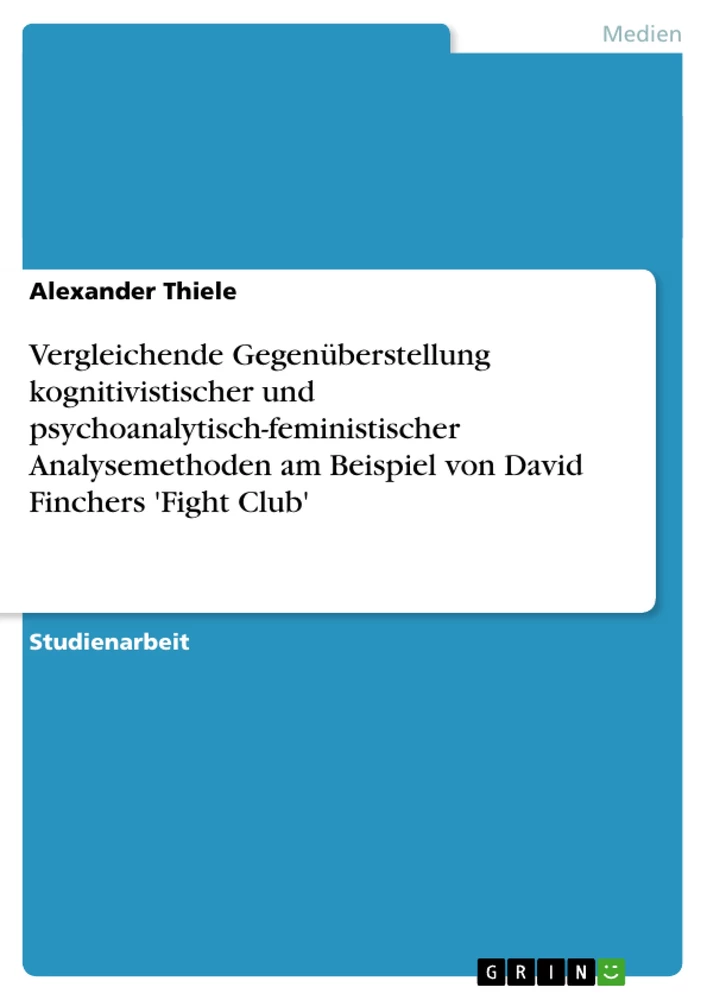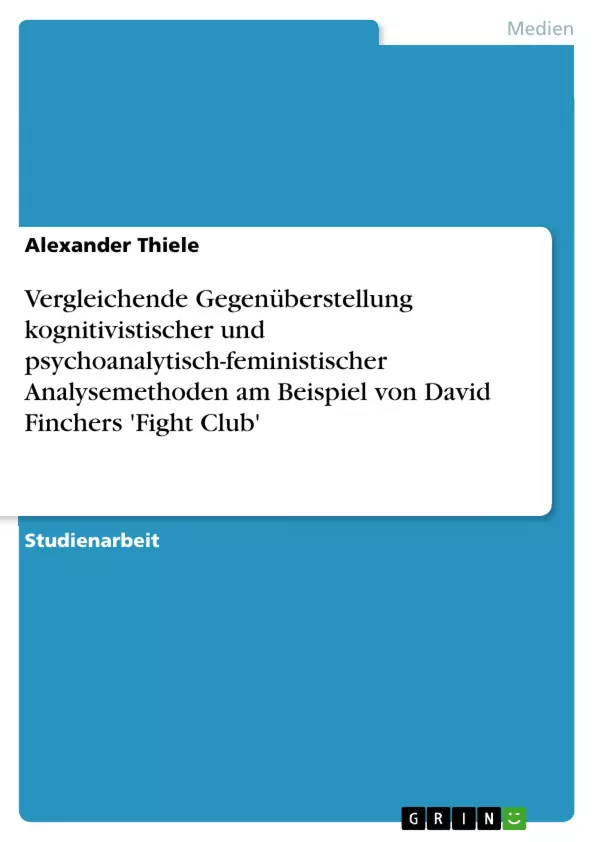„Oberflächenrausch“, so überschreibt Jens Eder seinen Essayband über das postmoderne/-klassische Kino der 90er, das ist „die Inszenierung von Oberflächen, das Design von Texturen. Licht und Schatten, Glanz und Stumpfheit, Haut und Membran.“ FIGHT CLUB (David Fincher, 1999) ist in vielerlei Hinsicht der ultimative Oberflächenrausch zum Ende des Mil-lenniums. Aber was verbirgt sich hinter den körperlichen (Haut und Körper) und ideologi-schen (Männlichkeit, Kapitalismus) Fassaden, die in diesem Film so systematisch zerstört werden? Und wie kann dieser Oberflächenrausch und seine Zerschlagung gedeutet werden? Dieser Frage möchte ich mich von zwei wissenschaftlichen Positionen annähern, die sich in ihrer Methodik diametral gegenüberstehen: Kognitivismus und Poststrukturalismus.
In einem ersten Teil der Arbeit soll es mir um einen kurzen Vergleich der beiden Forschungs-richtungen gehen. Basierend auf einer tabellarischen Gegenüberstellung (siehe Anhang) von Methode, Herangehensweise und geistesgeschichtlichem Hintergrund möchte ich in einem zweiten Teil die herausgearbeitete theoretische Folie über den Film legen. FIGHT CLUB bietet auf der rein denotativen Ebene für eine kognitivistische Analyse ein Reihe von Zugängen und interessanten Fragestellungen, deren konnotative Hintergründe dann für eine poststrukturalis-tische (hier: psychoanalytisch-feministisch) Betrachtung Ansatzpunkt für eine vertiefende Analyse sein können. Für eine kognitivistische Herangehensweise bietet sich vor allem die Narrationstheorie von BORDWELL an, die ich schlaglichtartig zur Verdeutlichung der Ar-beitsweise auf den Film anwenden werde. Demgegenüber gestellt werde ich den poststruktu-ralistischen Zugang zum Film am Beispiel einer feministischen Analyse herausarbeiten, um in einem abschließenden Teil zu einer Bewertung der beiden grundsätzlich verschiedenen Zu-gänge in Bezug auf Nützlichkeit, Anwendbarkeit und Erkenntnisgewinn zu kommen. Ob der von BORDWELL eingeleitete cognitive turn in den Filmwissenschaften tatsächlich einen konstruktiven Beitrag zum Verständnis von Filmen leistet und ob die von den Kognitivisten vorgetragene Kritik an den Grand Theories berechtigt ist, stelle ich im Weiteren zur Diskus-sion.
Für die psychoanalytisch-feministische Analyse Fight Clubs werde ich mich an der These orientieren, dass der Film sich zwar vordergründig als >Männerfilm< darstellt, eigentlich aber einen Abgesang auf Männlichkeit, Patriarchat und damit unweigerlich auf ein kapitalistisches und frauenfeindliches System darstellt und seine eigentliche Heldin in der Figur Marla Singers findet. Da ich den Film als bekannt voraus setzen kann, verzichte ich auf eine Inhaltsangabe im Fließtext und verweise auf das Sequenzprotokoll im Anhang.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Post-Theorie vs. Grand Theory - Eine Abgrenzung
- Poststrukturalismus: Theorie und Methode
- Kognitivistische Filmanalyse
- Fight Club zwischen Positivismus und Hermeneutik
- Was leistet die kognitivistische Filmanalyse nach Bordwell?
- Warum Psychoanalyse und Feminismus helfen können
- Blickstrukturen
- Kritik an Patriarchat und Kapitalismus
- Eine neue Männlichkeit/Weiblichkeit?
- Marla Singer als Heldin der Geschichte
- Bob als Zwischenstadium
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht kognitivistische und psychoanalytisch-feministische Analysemethoden anhand von David Finchers Film „Fight Club“. Ziel ist es, die Nützlichkeit, Anwendbarkeit und den Erkenntnisgewinn beider Ansätze zu bewerten und die Kritik des Kognitivismus an den „Grand Theories“ zu diskutieren. Die Arbeit untersucht, wie die Oberflächen des Films gedeutet werden können.
- Vergleich kognitivistischer und psychoanalytisch-feministischer Analysemethoden
- Anwendung der Bordwell'schen Narrationstheorie auf „Fight Club“
- Feministische Analyse von „Fight Club“ im Hinblick auf Männlichkeit, Patriarchat und Kapitalismus
- Bewertung der Erkenntnisgewinne beider Analysemethoden
- Diskussion des „cognitive turn“ in den Filmwissenschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach der Deutung der Oberflächen in „Fight Club“ und die gewählte Methodik vor: den Vergleich von Kognitivismus und Poststrukturalismus. Kapitel 2, „Post-Theorie vs. Grand Theory - eine Abgrenzung“, vergleicht die beiden Forschungsrichtungen anhand von Methode, Herangehensweise und geistesgeschichtlichem Hintergrund. Der Poststrukturalismus wird als Oberbegriff für verschiedene theoretische Diskurse eingeführt, die ein objektives Wissen anzweifeln. Kapitel 3, „Fight Club zwischen Positivismus und Hermeneutik“, wendet die kognitivistische Analyse nach Bordwell auf den Film an und kontrastiert dies mit einer feministischen Analyse. Dabei wird die These untersucht, dass der Film, obwohl vordergründig als Männerfilm präsentiert, einen Abgesang auf Männlichkeit, Patriarchat und Kapitalismus darstellt und seine eigentliche Heldin in Marla Singer findet.
Schlüsselwörter
Kognitivistische Filmanalyse, Psychoanalytisch-feministische Filmanalyse, Poststrukturalismus, David Fincher, Fight Club, Bordwell, Narrationstheorie, Männlichkeit, Patriarchat, Kapitalismus, Oberflächenrausch, Grand Theories, Post-Theory.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Kognitivismus“ in der Filmanalyse?
Ein Ansatz, der untersucht, wie Zuschauer Filme durch kognitive Prozesse (Wahrnehmung, Denken, Schlussfolgern) verstehen, oft basierend auf David Bordwells Theorien.
Wie deutet die feministische Analyse den Film „Fight Club“?
Sie sieht den Film als Abgesang auf das Patriarchat und den Kapitalismus, wobei Marla Singer als die eigentliche Heldin interpretiert wird.
Was bedeutet der Begriff „Oberflächenrausch“ im Kontext der 90er-Jahre-Filme?
Es beschreibt die Inszenierung von Texturen, Licht und Design als zentrales Element des postmodernen Kinos, das über die reine Handlung hinausgeht.
Warum wird David Bordwells „Cognitive Turn“ diskutiert?
Bordwell kritisierte die klassischen „Grand Theories“ (wie Psychoanalyse) und forderte eine wissenschaftlichere, auf Beweisen basierende Analyse der Filmwahrnehmung.
Welche Rolle spielt die Figur „Bob“ in der Analyse?
Bob wird als Zwischenstadium der Männlichkeit betrachtet, das die Krise patriarchaler Strukturen im Film verdeutlicht.
- Citar trabajo
- Alexander Thiele (Autor), 2005, Vergleichende Gegenüberstellung kognitivistischer und psychoanalytisch-feministischer Analysemethoden am Beispiel von David Finchers 'Fight Club', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121456