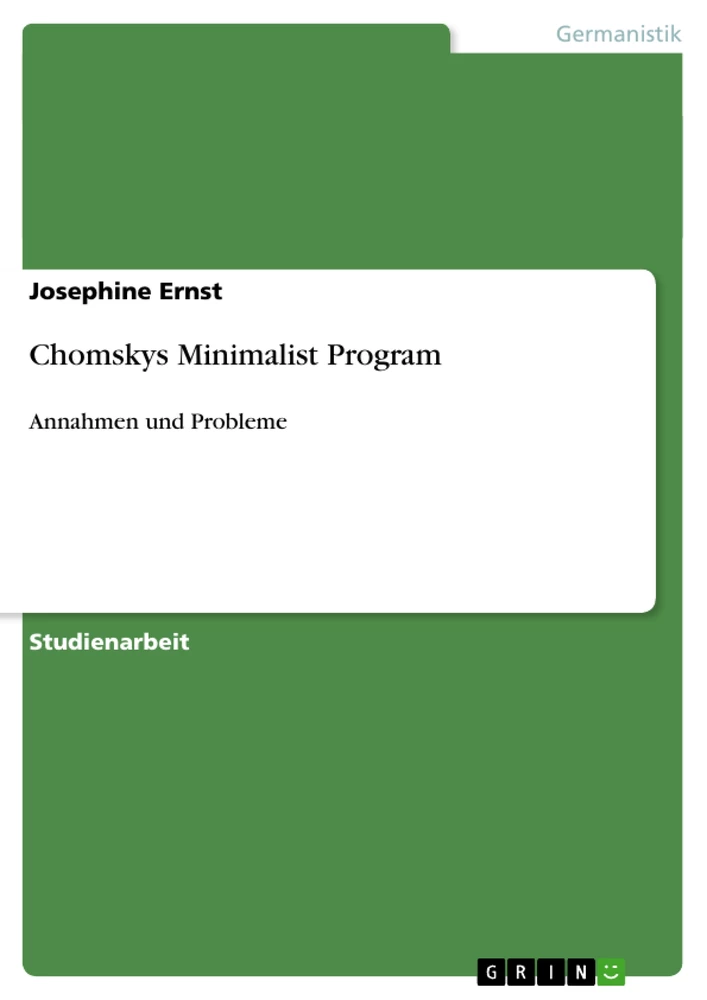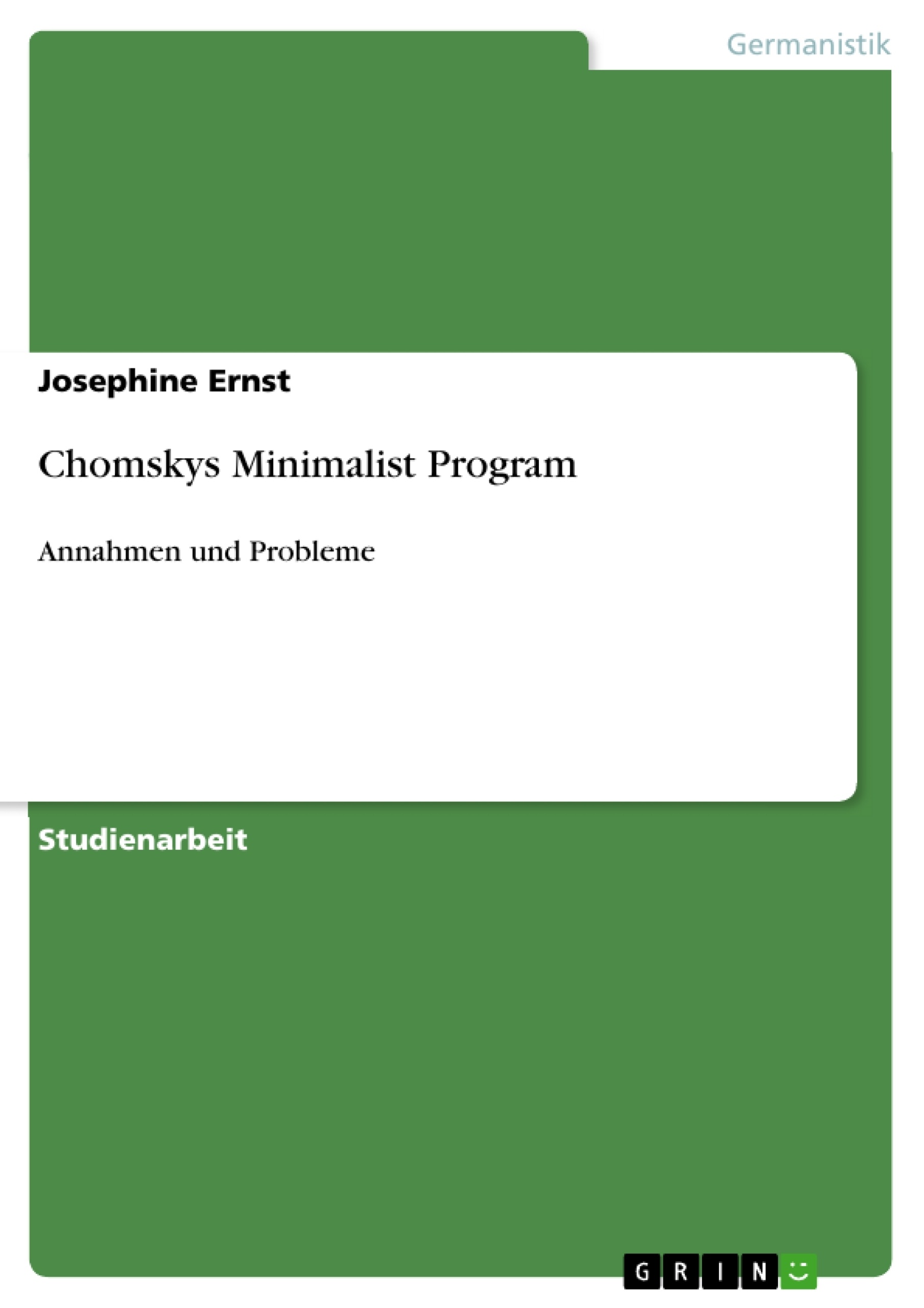Zahlreiche Wissenschaften versuchen immer wieder ihre theoretischen Ansätze zu minimieren um universal möglichst viele Aspekte abzudecken. Auch im Bereich der Grammatik, genauer gesagt der so genannten Generativen Grammatik, sollte ein Anstoß zur Minimierung aller bestehenden Konstituenten vorgebracht werden. Einer der ersten ausbuchstabierten Versuche dessen scheint zwar von Noam Chomsky selbst zur Bedingung der Minimalität getroffen worden zu sein, jedoch folgten 1990 erst noch Gedanken zum Minimalismus von Rizzi in der Theorie der Relativierten Minimalität, die in diesem Rahmen von Bedeutung sind. Dieses wird hier allerdings vorausgesetzt und nicht näher darauf eingegangen, falls nicht unbedingt notwendig.
Mit seinem Minimalistischen Programm (MP) versuchte Noam Chomsky nun gleich zwei Ansprüchen gerecht zu werden. Auf der einen Seite nahm er die Annahmen der Universalgrammatik (UG) als grundlegend. Das bedeutet, dass grammatische Phänomene für verschiedene Sprachen denselben Erklärungen unterliegen. Anspruch einer UG ist es somit, „von endlichen Mitteln unendlichen Gebrauch machen“ zu können. Was allerdings das Minimalistische betrifft, versucht Chomsky auf zweierlei Art, diese zu einer Theorie zu verflechten. Program nennt er es nun allerdings deswegen, weil er es noch nicht für eine ausgereifte Theorie hält. Bis heute haben die verschiedenen Versuche nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt. So bestehen verschiedene Ansatzpunkte, die jedoch meist bald teils oder vollkommen widerlegt werden. Wissenschaftliche Lücken, die nicht geschlossen werden können, Eliminierung von Daten, die schlicht unzureichend sind sowie teilweise scheinbar willkürlich getroffene Festlegungen erschweren eine vollkommen fundierte Version des Minimalismus in der Generativen Grammatiktheorie.
Im Folgenden sollen die Annahmen Chomskys dargestellt werden, so wie sie seit 1992, nachdem der Aufsatz A minimalist program for linguistic theory veröffentlicht wurde, bestanden haben. Dabei soll auf Grundlegendes des Programms Bezug genommen werden, das die Wissenschaft bis heute rezipiert hat. Angesichts dessen werden Problemkreise angesprochen werden, die eben dafür sorgen, dass das MP den Status einer Theorie noch nicht erlangt hat.
Vorwiegend anhand von Beispielen des Deutschen sollen Erklärungen folgen, die zum Verständnis des Gedankengangs beitragen. Jedoch ist dies nicht immer möglich. Deswegen sind Belege aus anderen Sprachen, zum Beispiel dem Englischen teilweise unverzichtbar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Hinführung
- 2. Chomskys Minimalist Program
- 2.1. Die Derivation
- 2.2. Ökonomie
- 2.3. Neuerungen
- 3. Probleme
- 3.1. Willkür bei Subjekten?
- 3.2. Ökonomie bei Split Infl?
- 4. Schlussbetrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht Chomskys Minimalistisches Programm (MP) in der generativen Grammatik. Ziel ist es, die Annahmen des MP darzustellen und bestehende Probleme zu beleuchten, die verhindern, dass es den Status einer vollständigen Theorie erlangt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Kernprinzipien des MP und analysiert kritische Punkte.
- Annahmen des Minimalistischen Programms
- Ökonomieprinzipien in der Syntax
- Derivation und syntaktische Operationen
- Problemfelder und Kritikpunkte am MP
- Vergleich mit früheren Konzeptionen der Generativen Grammatik
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Hinführung): Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und erläutert den Hintergrund des Minimalistischen Programms im Kontext der generativen Grammatik und der Suche nach einer minimalen, universalen Grammatiktheorie. Es werden frühere Ansätze erwähnt, auf die das MP aufbaut.
Kapitel 2 (Chomskys Minimalist Program): Dieses Kapitel beschreibt die zentralen Annahmen des Minimalistischen Programms, einschließlich der Grundoperationen (Select und Merge), der Rolle des Lexikons, und der Operation Move. Es wird ein Modell der Satzgenerierung vorgestellt und Neuerungen im Vergleich zu früheren Ansätzen aufgezeigt.
Kapitel 3 (Probleme): Dieses Kapitel befasst sich mit kritischen Punkten des MP. Es werden Probleme im Zusammenhang mit der Willkürlichkeit bei Subjekten und der Ökonomie bei Split Infl angesprochen. Diese Probleme zeigen die Grenzen des Programms auf.
Schlüsselwörter
Minimalistisches Programm, Generative Grammatik, Noam Chomsky, Universalgrammatik, Ökonomieprinzip, Derivation, Move-α, Syntax, Lexikon, LF (logische Form), PF (phonetische Form), Problemfelder, Sprachtheorie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Minimalistische Programm (MP) von Noam Chomsky?
Das MP ist ein Ansatz in der generativen Grammatik, der versucht, sprachliche Phänomene mit einem Minimum an theoretischen Mitteln und unter Annahme der Universalgrammatik zu erklären.
Warum nennt Chomsky es ein "Programm" und keine "Theorie"?
Chomsky betrachtet es noch nicht als voll ausgereifte Theorie, da es wissenschaftliche Lücken, unzureichende Daten und teilweise willkürliche Festlegungen enthält.
Welche Rolle spielt das Ökonomieprinzip im MP?
Das Ökonomieprinzip besagt, dass syntaktische Operationen (wie Move) so effizient und sparsam wie möglich ablaufen müssen.
Was sind die Grundoperationen im Minimalistischen Programm?
Zu den zentralen Operationen gehören "Select" (Auswahl aus dem Lexikon), "Merge" (Zusammenfügen von Einheiten) und "Move" (Verschiebung).
Welche Probleme werden am MP kritisiert?
Kritikpunkte sind unter anderem die Willkürlichkeit bei der Behandlung von Subjekten und Probleme bei der Umsetzung der Ökonomie im Bereich "Split Infl".
- Citation du texte
- Josephine Ernst (Auteur), 2009, Chomskys Minimalist Program, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121461