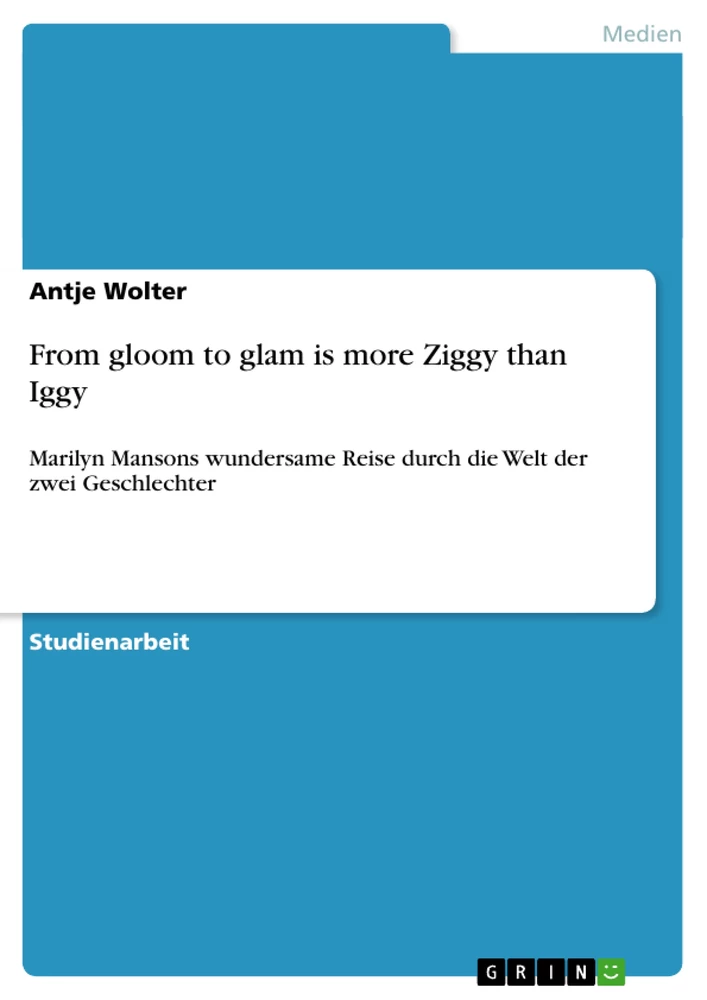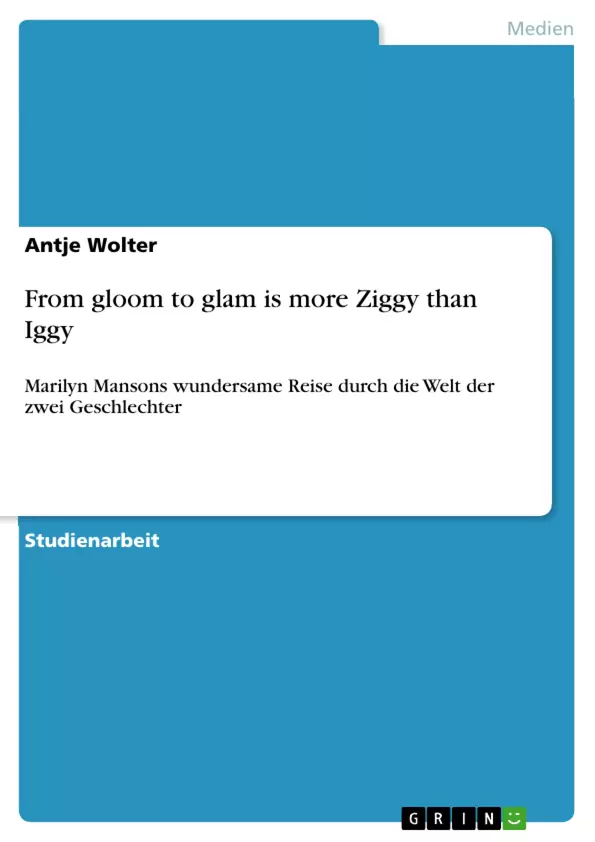... sorgfältiger bearbeitet werden können. Eine höchst interessante und ansprechende Arbeit!
Einleitung: Nur wenigen Zeitgenossen wurde dermaßen viel Aufmerksamkeit zuteil wie Marilyn Manson. Die Menschen lassen sich regelrecht in zwei Gruppen teilen, in die, die ihn lieben und die, die ihn hassen. Dazwischen gibt es nicht viel. Der Name ist Programm. Manson (eigentlich Brian Warner) benennt sich nicht nur zweigeschlechtlich, er gibt sich auch sonst gerne in der Öffentlichkeit androgyn. Alle Bandnamen sind zusammengesetzt aus dem einer amerikanischen Pop-Ikone, zumeist weibliche Schönheiten wie Marilyn Monroe oder Twiggy, und einem brutalen Serienkiller, wie Charles Manson oder Ramirez. Er spielt mit den Geschlechtergrenzen, wo er nur kann. Mit jedem Album, das er und seine Band herausbringen, wechselt er seine Identität oder besser sein äußeres Erscheinungsbild, mit dem er sich dann völlig identifiziert. Es sagt von sich selbst, dass er alle zehn Minuten eine andere Person ist. Alles bei Marilyn Manson ist Inszenierung, ist gewollt, ist Kunst. Die Band ist nicht nur für die Musik da und um den Rest kümmern sich dann Plattenfirma und Management, nein, Marilyn Manson bestimmt alles selbst, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Er
kümmert sich um die Videos, um die Promotion und um alles, was über seine Person geredet wird. Wer oder was ist Marilyn Manson? Ist er nun Marilyn oder Manson? Fast täglich gibt es neue Versuche seinem Geheimnis auf die Schliche zu kommen, neue Interpretationen und Definitionen, Skandale und Gerüchte, Erklärungsversuche und psychologische Gutachten. Doch das bringt rein gar nichts, außer der weisen Erkenntnis: Erwarte das Unerwartete.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Androgyne
- 2.1 Platon über kugelige Mannweiber und Weibmänner
- 2.2 Mansons Vorbilder
- 3 Von Glam, Pailletten und Plateausohlen
- 3.1 Triptychon, das Werk des Marilyn Manson
- 3.2 The Long Hard Road Out Of Hell
- 3.2.1 Das Video
- 3.3 The Dope Show
- 3.3.1 Das Video
- 4 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die androgynen Aspekte in der Kunstfigur Marilyn Manson und deren Entwicklung im Kontext des Glamrocks. Sie analysiert die Inszenierung von Geschlecht und Identität in Mansons Werk und setzt dies in Bezug zu philosophischen und historischen Vorbildern.
- Androgynie als künstlerisches Konzept
- Marilyn Mansons Entwicklung und Transformation seiner Kunstfigur
- Der Einfluss des Glamrocks auf Mansons Stil und Image
- Platons Philosophie und die Bedeutung der Androgynie
- Die Rolle von Musikvideos in der Inszenierung von Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die polarisierende Wirkung von Marilyn Manson auf die Öffentlichkeit. Es wird die androgyn präsentierte Kunstfigur und deren gezielte Inszenierung thematisiert.
Kapitel 2 (Das Androgyne): Dieses Kapitel definiert Androgynie und beleuchtet Platons philosophische Betrachtungsweise dieses Konzepts. Anschließend wird der Einfluss von Mansons Vorbildern auf seine androgynen Darstellungen diskutiert.
Kapitel 3 (Von Glam, Pailletten und Plateausohlen): Dieses Kapitel befasst sich mit dem Glamrock als stilistischem und ideologischem Kontext für Mansons Androgynie. Es wird die Geschichte des Glamrocks und die Bedeutung des Images für Künstler dieser Ära beleuchtet. Ein Abschnitt behandelt die "Triptychon"-Trilogie von Marilyn Manson und deren Entwicklung.
Schlüsselwörter
Marilyn Manson, Androgynie, Glamrock, Geschlechterrollen, Identität, Inszenierung, David Bowie, Platon, Musikvideo, Kunstfigur, Identitätskonstruktion.
Häufig gestellte Fragen
Warum spielt Marilyn Manson so stark mit Geschlechtergrenzen?
Androgynie ist ein zentrales künstlerisches Konzept von Marilyn Manson, um zu provozieren, Identitäten zu dekonstruieren und die Grenzen zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit aufzuheben.
Welchen Einfluss hat der Glamrock auf Marilyn Manson?
Manson nutzt Stilelemente des Glamrocks wie Pailletten, Plateausohlen und exzessive Inszenierung, ähnlich wie Vorbilder wie David Bowie (Ziggy Stardust).
Was bedeutet der Name „Marilyn Manson“?
Der Name kombiniert eine Pop-Ikone (Marilyn Monroe) mit einem Serienkiller (Charles Manson), was die Dualität von Schönheit und Grausamkeit in der US-Kultur symbolisiert.
Welche Rolle spielt Platons Philosophie in dieser Untersuchung?
Die Arbeit bezieht sich auf Platons Mythos der Kugelmenschen, um die historische und philosophische Tiefe des androgynen Konzepts zu beleuchten.
Ist Marilyn Manson eine reine Kunstfigur?
Ja, alles an Manson ist Inszenierung. Er kontrolliert seine Videos, Promotion und sein Erscheinungsbild akribisch als Teil eines Gesamtkunstwerks.
- Citation du texte
- Dipl.Des. Antje Wolter (Auteur), 2002, From gloom to glam is more Ziggy than Iggy, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121513