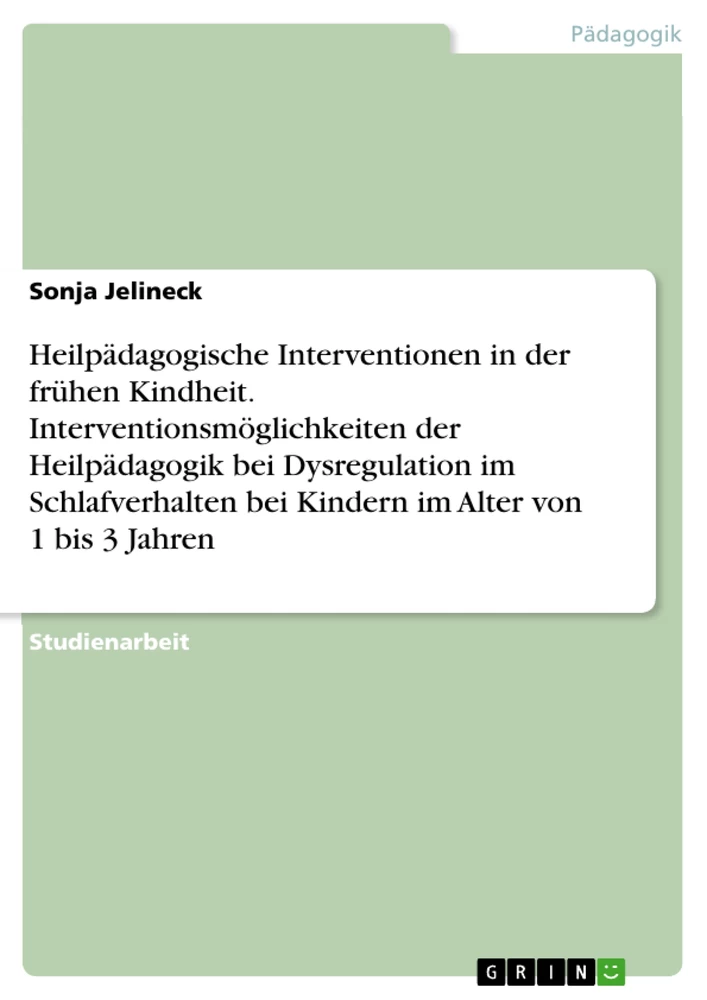In der Seminararbeit geht es um Interventionsmöglichkeiten der Heilpädagogik bei Dysregulation im Schlafverhalten bei Kindern im Alter von ein bis drei Jahren. Dazu wird zunächst ein kurzer Überblick über Schlaf und Schlafstörungen bei Kleinkindern gegeben. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf heilpädagogischen Interventionen und ihren neurobiologischen Begründungen. Alle gewählten Interventionen stammen aus dem Bereich der Elternberatung, allerdings mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Schlafentwicklung als bio-psycho-sozialem Prozess sowie der hohen interpersonellen und kulturellen Variabilität von Schlaf.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Schlaf und Dysregulation des Schlafverhaltens
- 3 Heilpädagogische Interventionen
- 3.1 Erwartungsmanagement
- 3.2 Schlafhygiene
- 3.3 Schlafpraktiken in den „Mommy Wars\" und systemische Beratung
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht heilpädagogische Interventionsmöglichkeiten bei Schlafregulationsstörungen bei Kindern im Alter von ein bis drei Jahren. Es wird ein Überblick über Schlaf und Schlafstörungen gegeben, wobei der Schwerpunkt auf heilpädagogischen Interventionen und ihren neurobiologischen Grundlagen liegt. Die Arbeit berücksichtigt die Schlafentwicklung als bio-psycho-sozialen Prozess und die interpersonelle und kulturelle Variabilität von Schlaf.
- Schlafstörungen bei Kleinkindern und deren Ursachen
- Heilpädagogische Interventionen in der Elternberatung
- Neurobiologische Grundlagen des Schlafs
- Kulturelle und soziale Einflüsse auf den Schlaf
- Variabilität von Schlafmustern bei Kleinkindern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einleitung betont die essentielle Bedeutung des Schlafs und die Herausforderungen, die Schlafstörungen bei Kleinkindern für Eltern darstellen. Sie führt in das Thema der heilpädagogischen Interventionen bei Schlafregulationsstörungen bei Kindern im Alter von ein bis drei Jahren ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf heilpädagogischen Interventionen aus der Elternberatung, unter Berücksichtigung der bio-psycho-sozialen Aspekte der Schlafentwicklung und der kulturellen Variabilität von Schlaf. Die Arbeit beschränkt sich aus Platzgründen auf Kernaspekte.
2 Schlaf und Dysregulation des Schlafverhaltens: Dieses Kapitel behandelt die organischen und nicht-organischen Ursachen von Schlafregulationsstörungen. Es differenziert zwischen verschiedenen Arten von Schlafstörungen gemäß ICD-10-GM und ICSD-3, einschließlich Insomnien, Hypersomnien, Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus und Parasomnien. Die Prävalenz von Schlafproblemen bei Kleinkindern wird diskutiert, wobei die großen Unterschiede in den Angaben aus verschiedenen Kulturkreisen hervorgehoben werden. Das Kapitel erklärt die Regulation des Schlaf-Wach-Verhaltens durch Schlafhomöostase und den zirkadianen Rhythmus und beleuchtet den aktuellen Forschungsstand bezüglich Schlafnormen bei Kleinkindern, der als lückenhaft beschrieben wird, besonders im Hinblick auf die kulturelle Variabilität der Schlafdauer.
3 Heilpädagogische Interventionen: Dieses Kapitel beschreibt heilpädagogische Interventionen für Eltern von Ein- bis Dreijährigen mit Schlafproblemen. Es betont die Schwierigkeit, evidenzbasierte Empfehlungen zu geben, aufgrund des begrenzten Forschungsstandes. Die dargestellten Beratungsansätze umfassen das Erwartungsmanagement für Eltern, Hinweise zur Schlafhygiene und die Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Erziehungsansätzen der „Mommy Wars“ (z.B. „Cry it out“ vs. bedürfnisorientierte Erziehung). Die Bedeutung der kulturellen Prämissen von Schlafhygiene und die transaktionale Beziehung zwischen Kinderschlaf und Kontextfaktoren werden herausgestellt. Die hohe Variabilität des Schlafverhaltens und die interkulturellen Unterschiede in Bezug auf die Bewertung von Kinderschlaf werden ausführlich behandelt.
Schlüsselwörter
Schlafstörungen, Kleinkinder, Heilpädagogik, Elternberatung, Schlafregulation, Neurobiologie des Schlafs, Schlafhygiene, Erwartungsmanagement, kulturelle Variabilität, ICD-10-GM, ICSD-3.
Häufig gestellte Fragen zu: Heilpädagogische Interventionen bei Schlafregulationsstörungen bei Kindern im Alter von ein bis drei Jahren
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht heilpädagogische Interventionsmöglichkeiten bei Schlafregulationsstörungen bei Kindern im Alter von ein bis drei Jahren. Sie beleuchtet Schlaf und Schlafstörungen, fokussiert auf heilpädagogische Interventionen und deren neurobiologische Grundlagen, berücksichtigt die Schlafentwicklung als bio-psycho-sozialen Prozess und die interpersonelle und kulturelle Variabilität von Schlaf.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Schlafstörungen bei Kleinkindern und deren Ursachen, heilpädagogische Interventionen in der Elternberatung, neurobiologische Grundlagen des Schlafs, kulturelle und soziale Einflüsse auf den Schlaf sowie die Variabilität von Schlafmustern bei Kleinkindern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einführung): Betont die Bedeutung des Schlafs, die Herausforderungen durch Schlafstörungen bei Kleinkindern für Eltern und führt in das Thema der heilpädagogischen Interventionen ein. Der Fokus liegt auf heilpädagogischen Interventionen aus der Elternberatung unter Berücksichtigung bio-psycho-sozialer Aspekte und kultureller Variabilität. Kapitel 2 (Schlaf und Dysregulation des Schlafverhaltens): Behandelt organische und nicht-organische Ursachen von Schlafregulationsstörungen, differenziert zwischen verschiedenen Arten von Schlafstörungen (gemäß ICD-10-GM und ICSD-3), diskutiert die Prävalenz von Schlafproblemen bei Kleinkindern und erklärt die Regulation des Schlaf-Wach-Verhaltens. Kapitel 3 (Heilpädagogische Interventionen): Beschreibt heilpädagogische Interventionen für Eltern von Ein- bis Dreijährigen mit Schlafproblemen, betont die Schwierigkeit evidenzbasierter Empfehlungen aufgrund begrenzten Forschungsstandes und umfasst Beratungsansätze wie Erwartungsmanagement, Hinweise zur Schlafhygiene und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Erziehungsansätzen ("Mommy Wars"). Die Bedeutung kultureller Prämissen von Schlafhygiene und die transaktionale Beziehung zwischen Kinderschlaf und Kontextfaktoren werden hervorgehoben. Kapitel 4 (Fazit): [Inhalt nicht explizit in der Zusammenfassung angegeben]
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlafstörungen, Kleinkinder, Heilpädagogik, Elternberatung, Schlafregulation, Neurobiologie des Schlafs, Schlafhygiene, Erwartungsmanagement, kulturelle Variabilität, ICD-10-GM, ICSD-3.
Welche Altersgruppe wird betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich auf Kinder im Alter von ein bis drei Jahren.
Welche Art von Interventionen werden besprochen?
Die Arbeit konzentriert sich auf heilpädagogische Interventionen, die in der Elternberatung Anwendung finden.
Welche Klassifizierungssysteme werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt die ICD-10-GM und die ICSD-3 zur Klassifizierung von Schlafstörungen.
Welche Aspekte der Schlafregulation werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Schlafhomöostase und den zirkadianen Rhythmus als Regulationsmechanismen des Schlaf-Wach-Verhaltens.
Wie wird die kulturelle Variabilität berücksichtigt?
Die Arbeit betont die großen Unterschiede in der Prävalenz von Schlafproblemen und in den Schlafmustern zwischen verschiedenen Kulturkreisen und analysiert den Einfluss kultureller Prämissen auf Schlafhygiene und die Bewertung von Kinderschlaf.
- Citar trabajo
- Sonja Jelineck (Autor), 2022, Heilpädagogische Interventionen in der frühen Kindheit. Interventionsmöglichkeiten der Heilpädagogik bei Dysregulation im Schlafverhalten bei Kindern im Alter von 1 bis 3 Jahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1215478