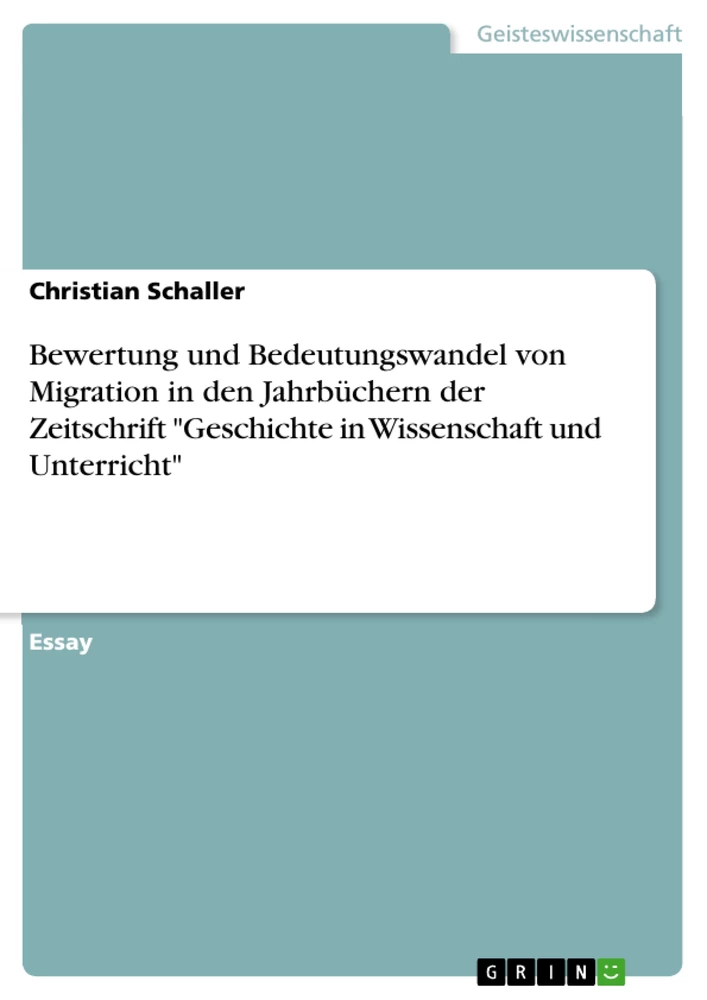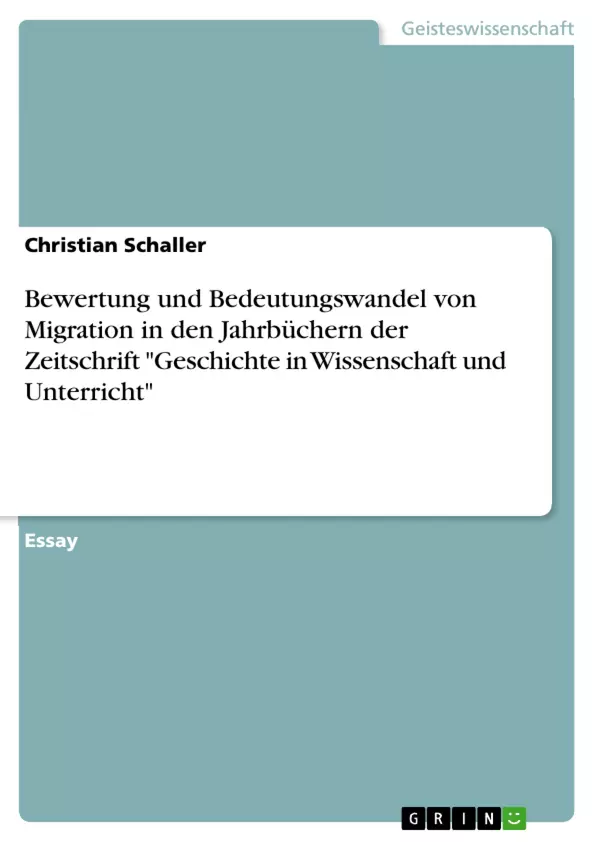Die Bundesrepublik Deutschland sah sich lange Zeit nicht als Einwanderungsland. Angesichts der jüngsten sogenannten Flüchtlingskrise gewannen Wanderung und Integration jedoch sukzessive ein immer höheres und anhaltendes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit. Trotz der selbstverständlich zugestandenen Einzigartigkeit jedes historischen Ereignisses kann man den grundsätzlichen Prozess einer "Flüchtlingskrise" keineswegs als Novum betrachten. In der Geschichte hatte es immer wieder große Fluchtbewegungen gegeben – sei es vor Klima- und Naturkatastrophen, Kriegen oder auch Genozid. In allen Epochen gab es Menschen, die in ihrem ursprünglichen Heimatland keine Zukunft mehr sahen oder um Freiheit und Leben fürchteten und darum Unterschlupf in stabileren Ländern oder Regionen suchten. Migration war stets eine kulturelle Konstante der Menschheit. Umso zentraler und tiefgreifender muss darum auch der Umbruch des deutschen Geschichtsbewusstseins und allgemein der geschichtskulturellen Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten aufgefasst werden.
Der vorliegende Essay will sich darum der Fragestellung annehmen, welchem Bedeutungswandel der Begriff „Migration“ unterlag. In den vergangenen Dekaden erweiterte sich die Didaktik der Geschichte in Deutschland von einer Schulfachdidaktik zu einem gesamtgesellschaftlichen Interesse. Darum sollen im begrenzten Rahmen des Essays die Jahrbücher der Fachzeitschrift "Geschichte in Wissenschaft und Unterricht" (kurz: GWU, im Folgenden vereinfacht mit nachgestelltem Erscheinungsjahr) exemplarisch herangezogen werden. Als angedachte Schnittstelle zwischen Geschichtswissenschaft und Fachdidaktik verbinden sie eine wissenschaftliche Herangehensweise, eine Vermittlung der zeitgenössischen Bildungspolitik sowie eine schülerfreundliche Pädagogik.
Im Folgenden sollen in chronologischer Reihenfolge exemplarische Jahrbücher der GWU von 1950 bis 2016 herangezogen werden, in denen – quer durch alle historischen Epochen – Thematiken wie Migration oder auch Integration behandelt werden. Im Fokus steht die Frage, welche Rolle oder Relevanz der Migration beigemessen wurde und wird. Dabei soll aufgezeigt werden, wie historische Wanderungsbewegungen in den letzten Jahrzehnten in Deutschland gedeutet und gewertet wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Bewertung und Bedeutungswandel von Migration in den Jahrbüchern der Zeitschrift „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht“
- Einleitung
- Migration als Thema in der GWU von 1950 bis 2016
- GWU 1950: Allgemeine Themen
- GWU 1951: Spätantike
- GWU 1953: Vertreibung und Zwangsumsiedlung
- GWU 1955: Germanische Stämme der Spätantike
- GWU 1957: Wandlungen der deutschen Sozialstruktur
- GWU 1958: Europäisierung und Enteuropäisierung der Erde
- GWU 1962: Reichtum und Gefahr der Mittellage Deutschlands
- GWU 1964: Konfessionelle Lage in Brandenburg-Preußen und Österreich
- GWU 1967: Volk, Nation, Vaterland und politische Bildung
- GWU 1970: Der Islam im Geschichtsunterricht
- GWU 1971: Abwanderung westdeutscher Bevölkerung in den ostelbischen Siedlungsraum
- GWU 1973: Die deutsche Auswanderung in der Mitte des 19. Jahrhunderts
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay untersucht den Bedeutungswandel des Begriffs "Migration" in den Jahrbüchern der Fachzeitschrift "Geschichte in Wissenschaft und Unterricht" (GWU) von 1950 bis 2016. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle, die Migration in den unterschiedlichen Epochen des Geschichtsunterrichts einnimmt, sowie auf der Deutung und Bewertung historischer Wanderungsbewegungen in Deutschland.
- Die Entwicklung des Geschichtsbewusstseins in Deutschland im Kontext von Migration
- Die Darstellung von Migration in der Geschichtsdidaktik und ihre Bedeutung für den Unterricht
- Die unterschiedlichen Perspektiven auf Migration in der GWU
- Die Rolle von politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen für die Wahrnehmung von Migration
- Die Bedeutung von Einzelschicksalen und kollektiven Erfahrungen im Kontext von Migration
Zusammenfassung der Kapitel
Der Essay beginnt mit einer Analyse der ersten GWU-Ausgaben aus den 1950er Jahren. Diese fokussieren auf grundlegende Themen wie die Rolle der Geschichtswissenschaft und die Neudefinition von National- und Geschichtsbewusstsein. In der GWU 1951 wird die Darstellung der Spätantike thematisiert, wobei der Fokus auf den römischen Staat und die Wechselwirkung zwischen der romanischen und germanischen Bevölkerung liegt. In der GWU 1953 befasst sich Fritz Gause mit der "Vertreibung und Zwangsumsiedlung" nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei er die verschwimmende Grenze zwischen Zwang und Freiwilligkeit von Migranten problematisiert. Im Laufe der 1950er und 1960er Jahre widmen sich die Jahrbücher zunehmend den Themen "Völkerwanderung" und "Bevölkerungsentwicklung", ohne jedoch die Thematik der Migration in den Vordergrund zu stellen.
Die GWU 1962 beleuchtet die "Mittellage Deutschlands" im Kontext von Migration, wobei die Wechselwirkungen zwischen Nord- und Süddeutschland, Frankreich und Skandinavien beleuchtet werden. Die GWU 1964 thematisiert die "konfessionelle Lage" in Brandenburg-Preußen und Österreich, wobei die Bedeutung von Migration für die Entwicklung dieser Regionen hervorgehoben wird. In der GWU 1967 werden "Volk, Nation und Vaterland" im Kontext der politischen Bildung behandelt, wobei die nationalistische Strömung der Zeit beleuchtet wird. Die Jahrbücher der 1970er Jahre widmen sich vermehrt dem Judentum, Antisemitismus, dem Holocaust und dem Islam, wobei die Darstellung von Migration in den Kontext dieser Themen gestellt wird. Die GWU 1971 untersucht die Abwanderung westdeutscher Bevölkerung in den ostelbischen Siedlungsraum im Mittelalter, während die GWU 1973 die "deutsche Auswanderung in der Mitte des 19. Jahrhunderts" behandelt, wobei die Motivationen der Auswandernden, die Rolle des Staates und die öffentlichen Meinungen beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Migration, Geschichtsbewusstsein, Geschichtsdidaktik, Geschichtsunterricht, "Geschichte in Wissenschaft und Unterricht", GWU, Deutschland, Vertreibung, Zwangsumsiedlung, Nationalismus, Identität, Integration, Integration, Einwanderung, Auswanderung, Deutung, Bewertung, Politische Bildung, Soziale Geschichte, Individuelle Schicksale.
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich der Begriff Migration im Geschichtsunterricht gewandelt?
Die Arbeit zeigt auf, dass Migration von einem Randthema in den 1950ern zu einer zentralen kulturellen Konstante der Menschheitsgeschichte in der heutigen Didaktik wurde.
Welche Rolle spielt die Zeitschrift GWU in dieser Untersuchung?
Die Fachzeitschrift „Geschichte in Wissenschaft und Unterricht“ dient als Schnittstelle zwischen Forschung und Schulpraxis, um den Wandel des Geschichtsbewusstseins zu analysieren.
Wurden Flucht und Vertreibung bereits in den 1950ern thematisiert?
Ja, jedoch oft unter dem Fokus der deutschen Zwangsumsiedlungen nach dem Zweiten Weltkrieg und der Neudefinition des Nationalbewusstseins.
Wann rückten Themen wie Integration und der Islam stärker in den Fokus?
Ab den 1970er Jahren finden sich vermehrt Beiträge zu religiöser Vielfalt, Antisemitismus und der Geschichte des Islams im Kontext des Geschichtsunterrichts.
Ist Migration laut der GWU ein neues Phänomen?
Nein, die untersuchten Jahrbücher belegen, dass Wanderungsbewegungen (z. B. Völkerwanderung, Auswanderung im 19. Jh.) in allen Epochen präsent waren.
- Citar trabajo
- Christian Schaller (Autor), 2017, Bewertung und Bedeutungswandel von Migration in den Jahrbüchern der Zeitschrift "Geschichte in Wissenschaft und Unterricht", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1215484