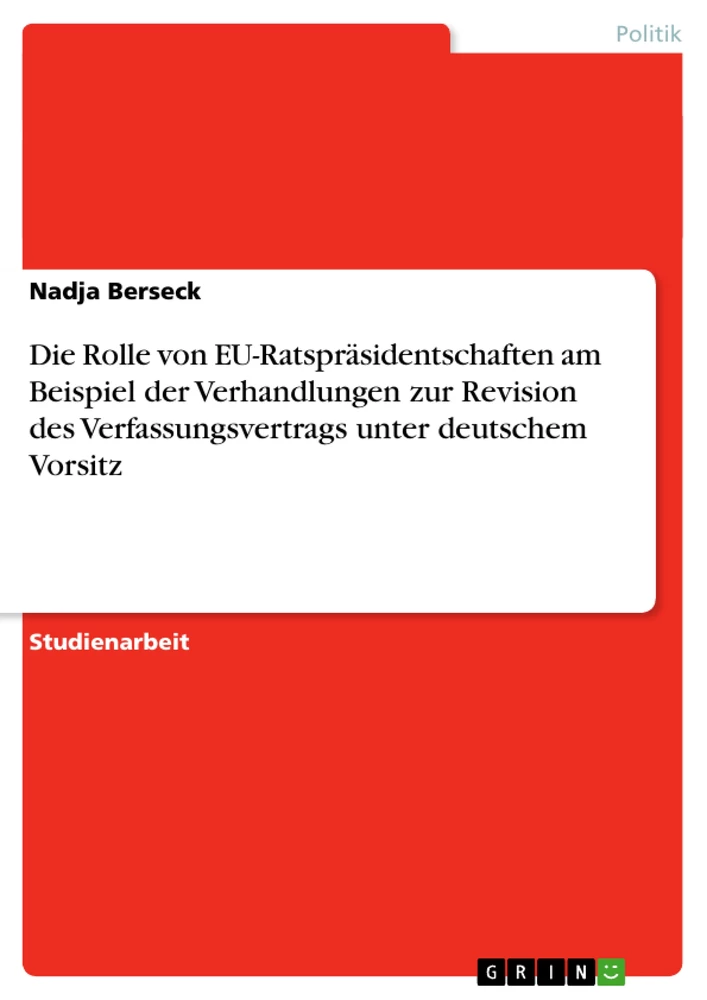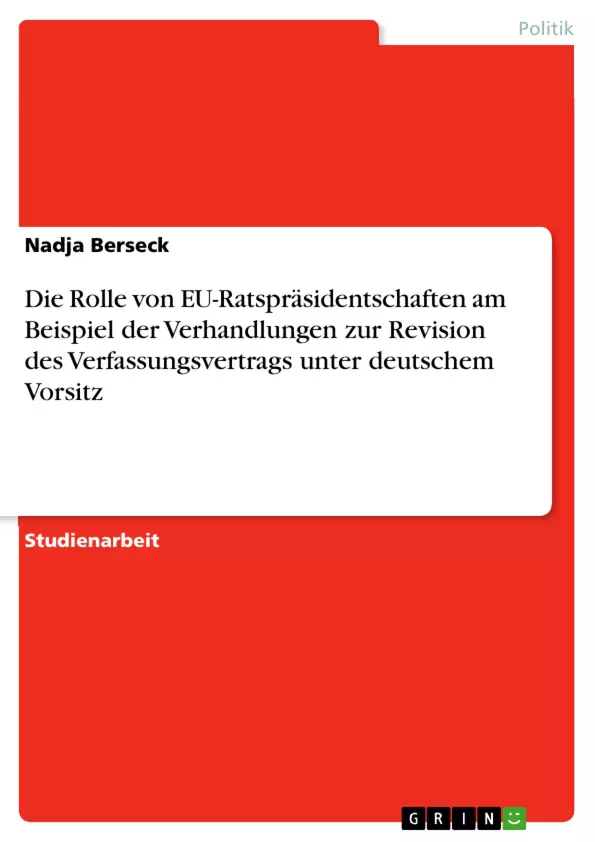Seit dem non und nee im Mai und Juni 2005 bei den Referenden in den beiden Gründerstaaten
Frankreich und den Niederlanden überschattete die Verfassungskrise die europapolitische
Landschaft. Neben der Ratlosigkeit über den weiteren Umgang mit dem Verfassungsvertrag
herrschte auch grundsätzliche Orientierungslosigkeit über die Zielrichtung der europäischen
Integration. Vor diesem Hintergrund übernahm die deutsche Bundesregierung im Januar 2007
für 6 Monate den EU-Ratsvorsitz. Ihr ambitioniertes Arbeitsprogramm war breit gefächert und
dicht gefüllt: Angefangen bei Fragen nach der Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit des
europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells über die Schaffung einer Grundlage für die
dringend erforderliche europäische Energiepolitik und die Bekämpfung des internationalen
Terrorismus bis hin zur Erarbeitung einer neuen Ostpolitik sowie konkrete Vorschläge zur
Weiterentwicklung der Nachbarschaftspolitik. Im Zentrum der deutschen Präsidentschaft stand
allerdings zweifellos die V-Frage: Die Bundesregierung sollte durch die Wiederbelebung der
Verhandlungen zum Verfassungsvertrag die Handlungsfähigkeit der EU unter Beweis stellen.
Die Erwartungen an die deutsche Präsidentschaft waren also besonders hoch. Doch kann eine
Ratspräsidentschaft diese Anforderungen mit ihren nur begrenzten prozeduralen Gestaltungs-
und Einwirkungsmitteln überhaupt erfüllen?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, müssen zunächst die Funktionen und
Handlungsmöglichkeiten von EU-Ratspräsidentschaften untersucht werden. Die vorliegende
Arbeit widmet sich der Analyse des strukturellen Umfelds von EU-Ratspräsidentschaften mit
ihren Erfolgs- und Scheiterungsfaktoren. Dies soll am Beispiel der Verhandlungen des
deutschen Vorsitzes zur Revision des Reformvertrags verdeutlicht werden. Es geht nicht
darum, eine rein inhaltlich-normative Bewertung der Verhandlungsergebnisse unter deutschem
Vorsitz vorzunehmen, sondern diese Arbeit konzentriert sich auf die Funktionsanalyse und die
in ihrem Rahmen identifizierten Erfolgsfaktoren und Handlungsbeschränkungen. Um die
Analyse zu komplettieren, wird die Funktionsbilanz mit den im Reformvertrag vorgesehen
Änderungen im Ratssystem in Bezug gesetzt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Rolle von EU-Ratspräsidentschaften
- 2.1. Entwicklung der EU-Ratspräsidentschaft von der EGKS bis zum Vertrag von Nizza
- 2.2. Funktionen von EU-Ratspräsidentschaften
- 2.3. Determinanten zur Durchführung von EU-Ratspräsidentschaften
- 2.3.1. Ratspräsidentschaftsspezifische Faktoren
- 2.3.2. EU-interne Faktoren
- 2.3.3. EU-externe Faktoren
- 2.4. Bewertung von EU-Ratspräsidentschaften
- 3. Die Verhandlungen zur Revision des Verfassungsvertrags unter deutschem Vorsitz
- 3.1. Rahmenbedingungen des deutschen Vorsitzes
- 3.2. Ausgangslage und Anforderungen an den deutschen Vorsitz
- 3.2.1. Ratspräsidentschaftsspezifische Faktoren
- 3.2.2. EU-interne Faktoren
- 3.2.3. EU-externe Faktoren
- 3.3. Die deutsche Verhandlungsstrategie
- 3.4. Die Funktionen der deutschen Ratspräsidentschaft
- 3.4.1. Koordinationsfunktion
- 3.4.2. Vermittlerfunktion
- 3.4.3. Initiativfunktion
- 4. Im Reformvertrag vorgesehene Änderungen im Ratssystem
- 4.1. Vorteile und Defizite der aktuellen Ratspräsidentschaft
- 4.2. Der künftige EU-Präsident
- 4.3. Die künftige Vorsitzfunktion in der Außenpolitik
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle von EU-Ratspräsidentschaften, insbesondere die des deutschen Vorsitzes 2007 während der Verhandlungen zur Revision des Verfassungsvertrages. Ziel ist es, die Funktionen, Handlungsmöglichkeiten und Einflussfaktoren von Ratspräsidentschaften zu untersuchen und deren Erfolg und Scheitern zu beleuchten. Die Analyse wird mit den im Reformvertrag vorgesehenen Änderungen des Ratssystems in Beziehung gesetzt.
- Historische Entwicklung der EU-Ratspräsidentschaft
- Funktionen und Aufgaben von Ratspräsidentschaften
- Einflussfaktoren auf die erfolgreiche Durchführung einer Ratspräsidentschaft (interne und externe Faktoren)
- Analyse der deutschen Ratspräsidentschaft 2007
- Reformen des Ratssystems im Vertrag von Lissabon
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung beschreibt die Verfassungskrise der EU nach den gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden und die hohen Erwartungen an den deutschen EU-Ratsvorsitz 2007, insbesondere bezüglich der Revision des Verfassungsvertrages. Die Arbeit konzentriert sich auf die Funktionsanalyse der Ratspräsidentschaft und deren Erfolgsfaktoren.
Kapitel 2 (Die Rolle von EU-Ratspräsidentschaften): Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die historische Entwicklung der EU-Ratspräsidentschaft, ihre Funktionen und die Einflussfaktoren, die ihre Aufgabenerfüllung erleichtern oder erschweren. Es werden interne und externe Determinanten der Ratspräsidentschaft untersucht.
Kapitel 3 (Die Verhandlungen zur Revision des Verfassungsvertrags unter deutschem Vorsitz): Hier wird die Ausgangslage und die Anforderungen an den deutschen Vorsitz im Jahr 2007 analysiert. Es werden die deutsche Verhandlungsstrategie sowie die Erfüllung der Koordinations-, Vermittlungs- und Initiativfunktion beleuchtet. Die Kapitel 3.2.1-3.2.3 beschreiben die ratspräsidentschaftsspezifischen, EU-internen und EU-externen Faktoren, die den deutschen Vorsitz beeinflussten.
Kapitel 4 (Im Reformvertrag vorgesehene Änderungen im Ratssystem): Dieses Kapitel befasst sich mit den im Vertrag von Lissabon vorgesehenen Reformen des Ratssystems und deren Auswirkungen auf zukünftige Ratspräsidentschaften.
Schlüsselwörter
EU-Ratspräsidentschaft, Verfassungsvertragsrevision, deutscher EU-Vorsitz 2007, Institutionelles Gefüge der EU, Verhandlungsstrategien, Erfolgsfaktoren, handlungsbeschränkende Faktoren, Vertrag von Lissabon, Europäischer Rat, Außenbeauftragter.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die EU-Ratspräsidentschaft?
Die Ratspräsidentschaft leitet die Sitzungen des Rates, setzt politische Schwerpunkte und fungiert als Vermittler zwischen den Mitgliedstaaten, um Kompromisse zu finden.
Was war die zentrale Aufgabe des deutschen Vorsitzes 2007?
Die wichtigste Aufgabe war die Wiederbelebung des EU-Verfassungsvertrags nach den gescheiterten Referenden in Frankreich und den Niederlanden (V-Frage).
Was sind die Erfolgsfaktoren einer Ratspräsidentschaft?
Dazu zählen Verhandlungsgeschick, eine klare Strategie, ein stabiles EU-internes Umfeld und die Fähigkeit zur Koordination zwischen den verschiedenen EU-Institutionen.
Wie hat der Vertrag von Lissabon das Ratssystem verändert?
Er führte das Amt des ständigen Präsidenten des Europäischen Rates und des Hohen Vertreters für Außenpolitik ein, was die Bedeutung der halbjährlich wechselnden Präsidentschaft etwas reduzierte.
Was bedeutet die „Vermittlerfunktion“ der Präsidentschaft?
Die Präsidentschaft muss als „ehrlicher Makler“ agieren, um nationale Eigeninteressen zurückzustellen und tragfähige Mehrheiten für europäische Entscheidungen zu organisieren.
- Citation du texte
- Nadja Berseck (Auteur), 2007, Die Rolle von EU-Ratspräsidentschaften am Beispiel der Verhandlungen zur Revision des Verfassungsvertrags unter deutschem Vorsitz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121575