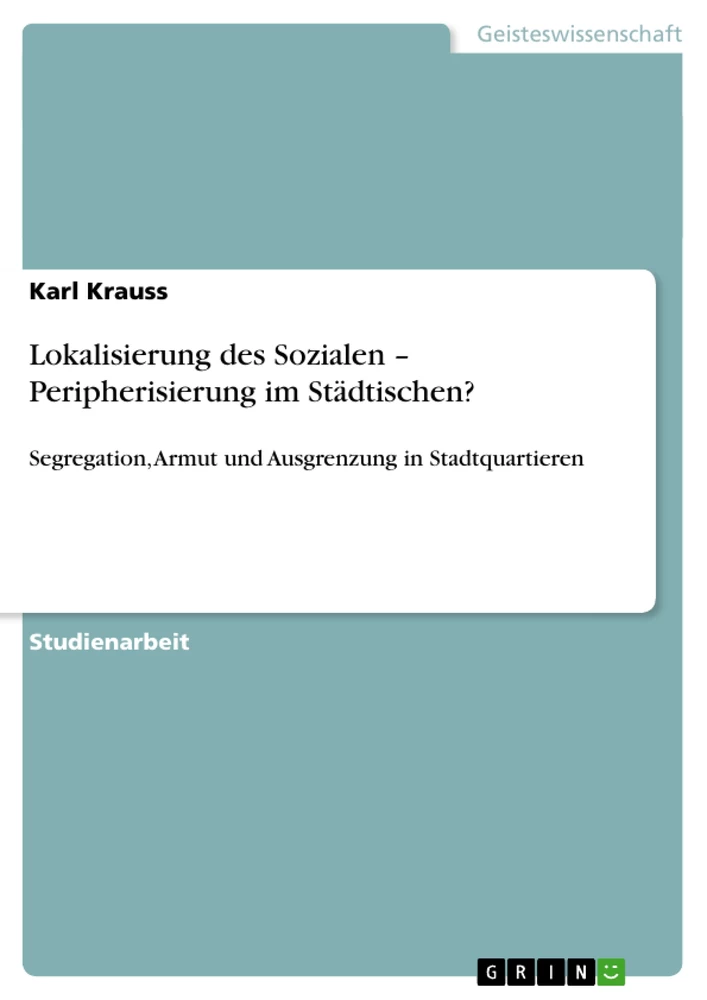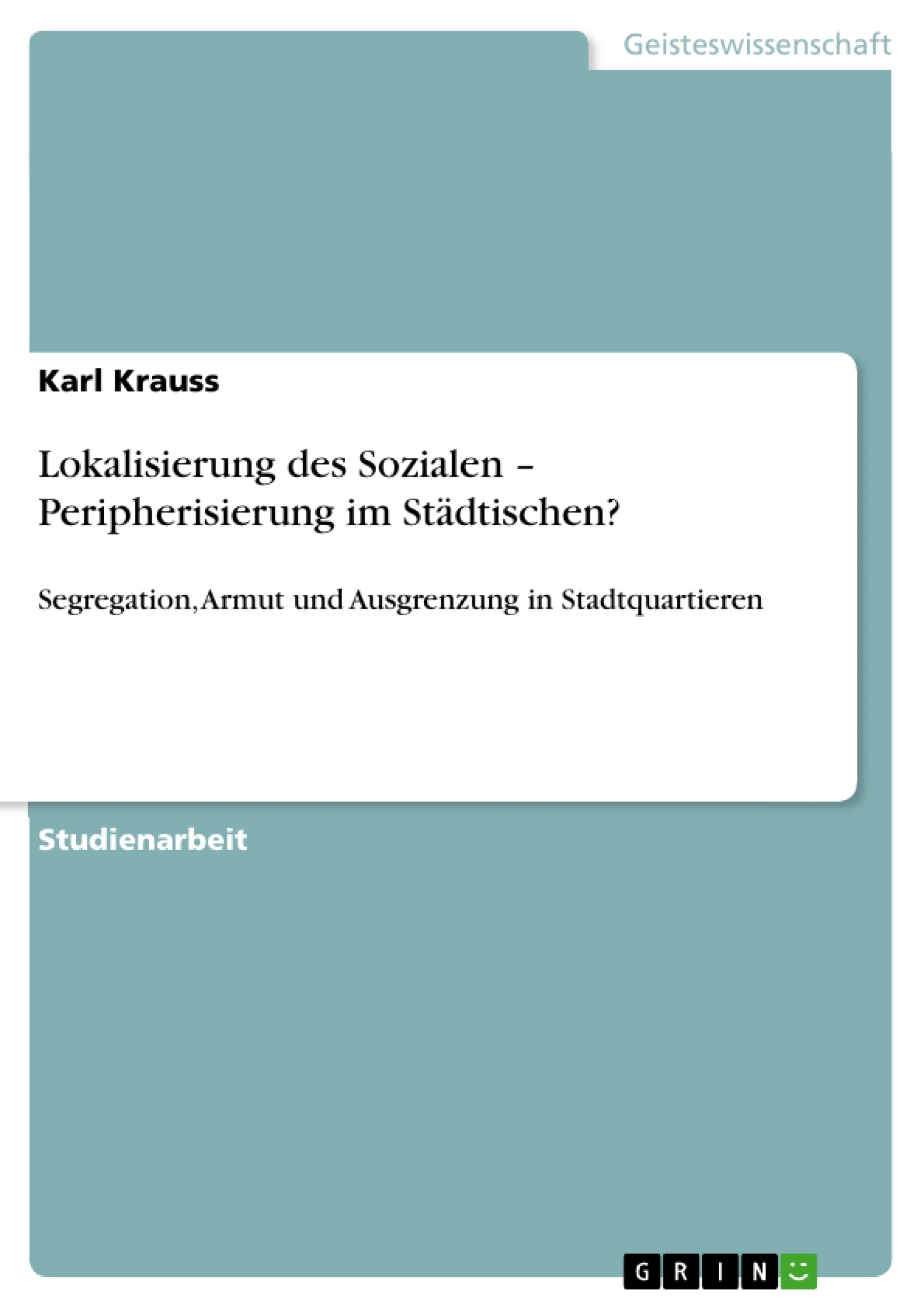Politischen und soziologischen Debatten oder Veröffentlichungen sowie Diskussionen in den Medien beschäftigen sich seit einigen Jahren wieder häufiger mit dem Thema der sozialen Ungleichheit. Dieses Phänomen ist nichts neues, allerdings stellte es in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, insbesondere in den europäischen Wohlfahrtsstaaten keine dringliche Problematik dar. Mit der zunehmenden Globalisierung und der damit einhergehenden Transformation der Arbeitsgesellschaft werden die sozialen Unterschiede wieder größer und dringen ins öffentliche Bewusstsein. Wie bei fast allen gesellschaftlichen Phänomenen sind auch die Folgen der zunehmenden sozialen Ungleichheit am häufigsten und ausgeprägtesten in Städten und Großstädten zu beobachten. Hier kommt es häufig zu Ausgrenzung und Stigmatisierung von Teilen der Bevölkerung. In Folge dessen wird von einer „neuen Unterschicht“ oder vom so genannten „Subproletariat“ gesprochen. Soziologen, vor allem Niklas Luhmann, verwendeten in diesem Zusammenhang den Begriff der Exklusion bzw. Vollexklusion. Sind dies nur soziologische Terminologien oder wird damit ein empirisch nachweisbares Phänomen urbaner Gesellschaften beschrieben?
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Modernisierung, Globalisierung, funktionale Differenzierung und Netzwerkgesellschaften
- Die europäische Stadt im Wandel
- Armut und Ausgrenzung
- Ambivalenz der Exklusion
- Räumliche Segregation benachteiligter Stadtquartiere
- Ursachen und Wirkung sozialer Exklusion im Städtischen
- Ausgrenzende Orte am Beispiel der Hamburger Stadteile St. Pauli und Mümmelmannsberg
- Slums und informelle Arbeit
- Entwicklung der Slums
- Der informelle Arbeitsmarkt
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff der Exklusion im städtischen Kontext sowohl theoretisch als auch empirisch. Sie erörtert Ursachen und Folgen der Verschärfung urbaner sozialer Ungleichheit auf nationaler und internationaler Ebene. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Modernisierung, Globalisierung und zunehmender sozialer Ungleichheit in Städten.
- Soziale Ungleichheit und Exklusion in Städten
- Der Einfluss von Modernisierung und Globalisierung auf urbane soziale Strukturen
- Räumliche Segregation und Ausgrenzung benachteiligter Stadtquartiere
- Armut und ihre Auswirkungen auf die städtische Bevölkerung
- Slums und informelle Arbeit in Entwicklungsländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der zunehmenden sozialen Ungleichheit in Städten dar und beschreibt die Ziele und den Aufbau der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet theoretische Grundlagen wie Modernisierung, Globalisierung und Netzwerkgesellschaften. Kapitel 3 untersucht den Wandel der europäischen Stadt im historischen Kontext. Kapitel 4 behandelt den Zusammenhang von Armut und Ausgrenzung. Kapitel 5 beschreibt verschiedene Dimensionen von Exklusion. Kapitel 6 analysiert räumliche Segregation anhand von Beispielen aus Hamburg (St. Pauli und Mümmelmannsberg). Kapitel 7 widmet sich Slums und informeller Arbeit in Entwicklungsländern.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Exklusion, Stadt, Urbanisierung, Modernisierung, Globalisierung, räumliche Segregation, Armut, Slums, informelle Arbeit, Hamburger Stadteile (St. Pauli, Mümmelmannsberg).
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter "Exklusion" im städtischen Raum?
Exklusion bezeichnet die soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung von Bevölkerungsteilen, die oft mit Armut und dem Verlust der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben einhergeht.
Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf die soziale Ungleichheit in Städten?
Die Globalisierung führt zu einer Transformation der Arbeitsgesellschaft, wodurch soziale Unterschiede zunehmen und räumliche Segregation in Großstädten verstärkt wird.
Welche Hamburger Stadtteile dienen in der Arbeit als Fallbeispiele?
Die Arbeit analysiert die räumliche Segregation und Ausgrenzung am Beispiel der Hamburger Stadtteile St. Pauli und Mümmelmannsberg.
Was sind Slums und welche Rolle spielt informelle Arbeit?
In Entwicklungsländern manifestiert sich Exklusion oft in Slums, wo Menschen im informellen Arbeitsmarkt ohne soziale Absicherung ums Überleben kämpfen.
Was bedeutet "räumliche Segregation"?
Segregation beschreibt die räumliche Trennung verschiedener Bevölkerungsgruppen innerhalb einer Stadt, was oft zur Entstehung benachteiligter Quartiere führt.
- Citation du texte
- Karl Krauss (Auteur), 2008, Lokalisierung des Sozialen – Peripherisierung im Städtischen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121656