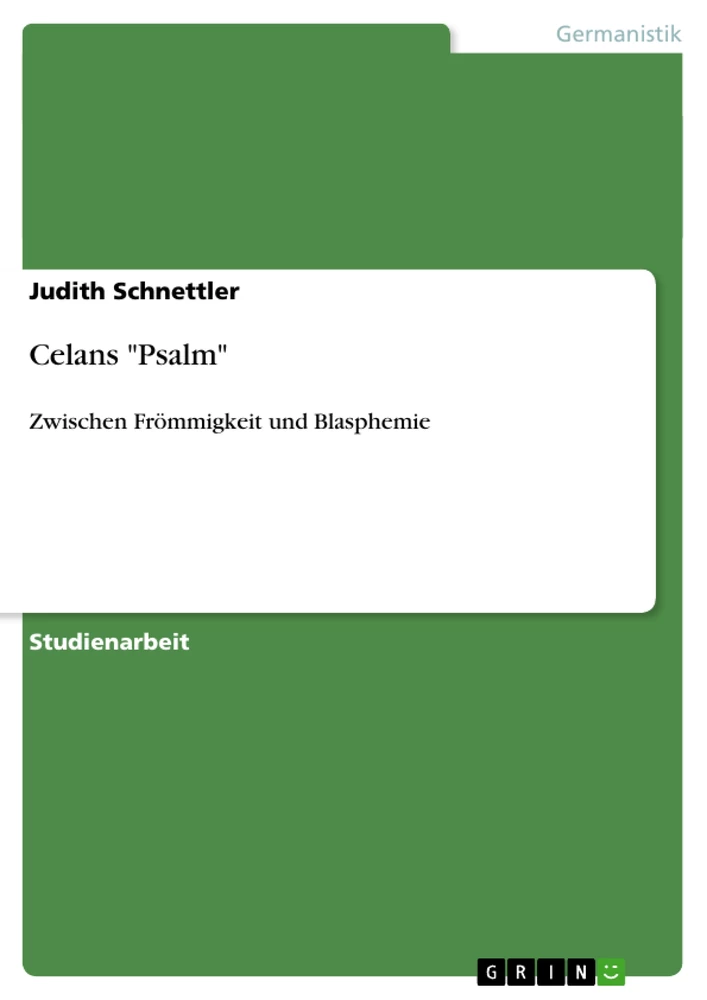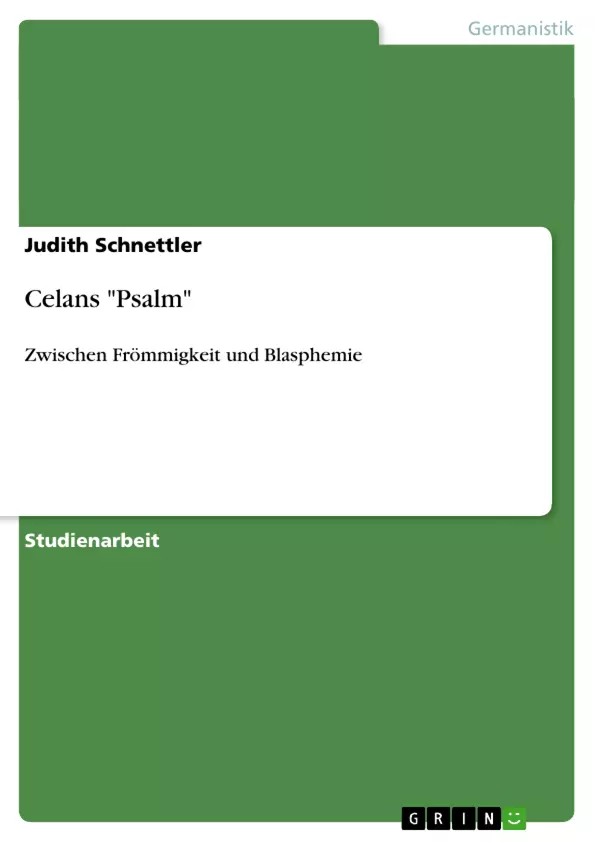1. Einleitung
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Gedicht Psalm von Paul Celan.
Psalm stammt aus dem fünften Gedichtband Celans, Die Niemandsrose, welcher 1963 erschien. Dass der Titel des gesamten Gedichtbandes aus Psalm stammt, lässt auf dessen hohe Bedeutung schließen.
Dieses Gedicht ist eins der meistinterpretierten Gedichte Celans und in der Sekundärliteratur zu Psalm gibt es viele Herangehens- und Betrachtungsweisen. Deshalb wird sich diese Arbeit– um sie in einem angemessenen Rahmen zu halten– darauf beschränken, zu ermitteln, was an Celans Gedicht „religiös“ ist und zeigen, dass es sich im Gedicht (insbesondere bei dem Ausdruck „N/niemand“) nicht um blasphemisches Sprechen handelt, wie viele Stellen im Gedicht vermuten lassen. Es wird gezeigt, dass das Gedicht für die jüdischen Toten spricht, die in der Geschichte viel Leid ertragen mussten, aber dennoch ihrem Gott ein Loblied singen. Der Aspekt „des Religiösen“ erscheint sehr interessant, da sich Celan in der Zeit, in der die Niemandsrose entstand, intensiv mit der jüdischen Religion, vor allem mit der jüdischen Mystik, beschäftigte.[1] Dieser Aspekt wird allgemein „das Religöse“ genannt, meint damit aber vor allem die im Gedicht erkennbaren Bezüge zur jüdischen Mystik und die Beziehung zwischen dem Titel und dem Inhalt des Gedichts. Da der Tiel bereits ein Wort aus dem religiösen Bereich ist und eine bestimmte Gebetsform aus dem Alten Testament beschreibt, wird untersucht, inwieweit das Gedicht selbst einem Psalm ähnelt. Denn es liegt nahe, den Titel als Gattungsbezeichnung zu übernehmen.[2] Desweiteren gibt das Titelwort Psalm „ [...] bereits einen Hinweis auf den Kontext, auf den sich viele der Gedichte in dieser Phase Celanscher Lyrik beziehen.“[3]
Die Arbeit ist so gegliedert, dass zunächst einige Erläuterungen zur jüdischen Mystik und zu der Gebetform Psalm gegeben werden. Anschließend wird während der Analyse des Gedichtes die Verbindung von Titel und Gedichtinhalt sowie die mystischen Elemente herausgearbeitet. Die Hermetik der Celanschen Lyrik im Gedicht Psalm wird im Hauptteil der Arbeit nicht behandelt, lediglich wird der Schlussteil darauf zurückkommen, wenn erläutert wird, was in der Arbeit nicht untersucht wurde.