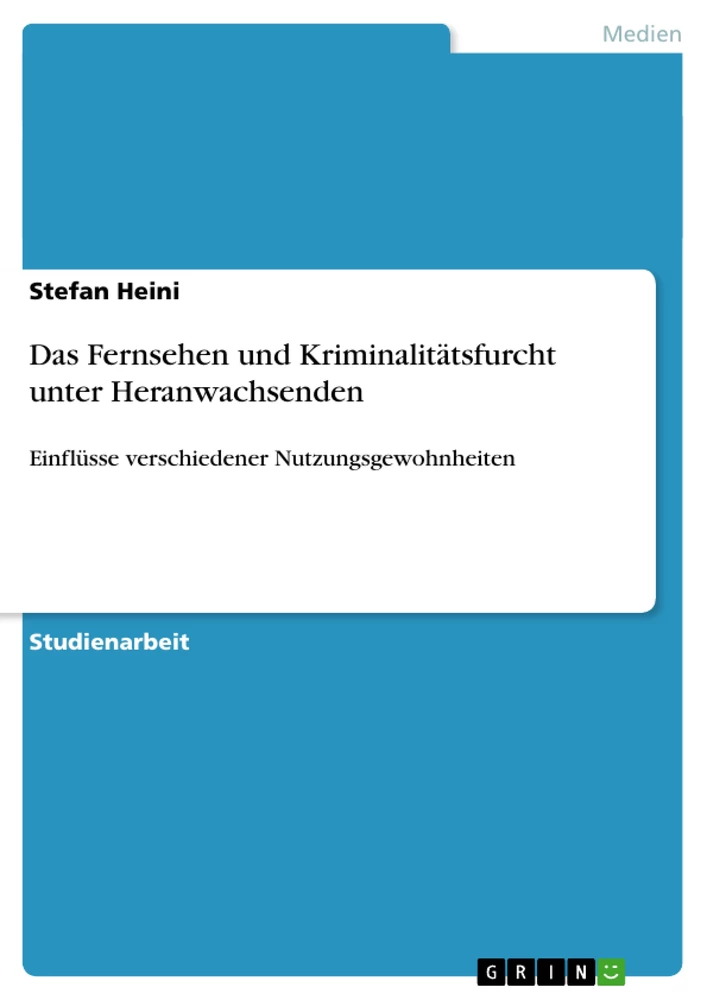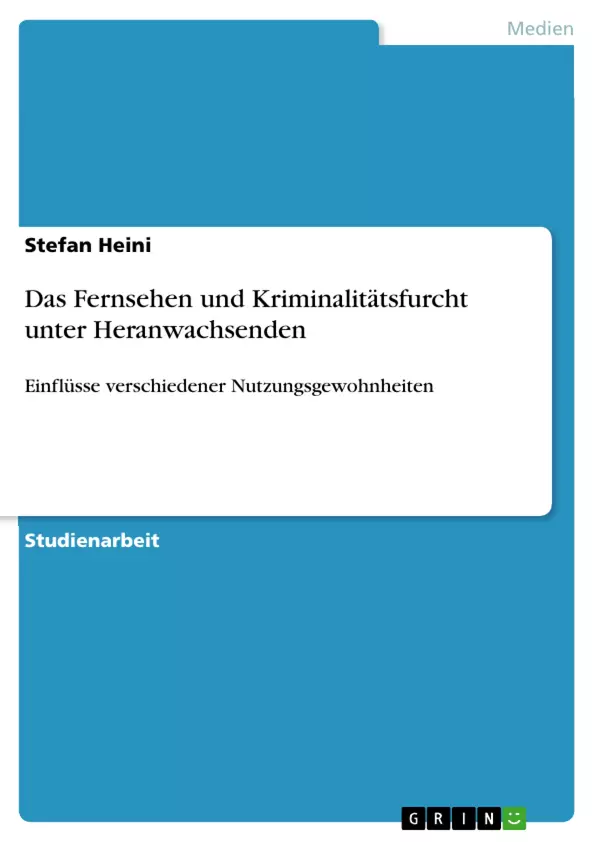Bei dieser Arbeit wurde davon ausgegangen, dass Heranwachsende, welche das Medium Fernsehen häufig nutzen, eine in Richtung TV-Realität verzerrte Wirklichkeit wahrnehmen. Für Heranwachsende, im Besonderen jene, die eine ausgeprägte Präferenz für privat-kommerzielles Fernsehen aufweisen, wurden stärkere Effekte erwartet. Die stärksten Effekte wurden für die Nachrichten oder für Sendungen wie „Aktenzeichen XY ungelöst“, „Notruf“ oder Ähnliche erwartet, da es sich um Bilder realer Gewalt oder um dokumentarische Darstellungen von Gewalt handelt.
Die Kultivierungsthese hat sich in den meisten betrachteten Studien bestätigt: Vielseher erleben eine in Richtung TV-Wirklichkeit verzerrte Realität. Der Einfluss ist am stärksten für privat-kommerzielles Fernsehen, welches von Heranwachsenden präferiert wird. Nicht eindeutig ist die Wirkungsrichtung zwischen TV-Konsum und Furcht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 Problemstellung und Erkenntnisinteresse
- 1.2 Fragestellung
- 1.3 Vorgehen
- 1.4 Schwierigkeiten
- 2. DAS ANGEBOT AN GEWALTDARSTELLUNGEN IM FERNSEHEN
- 3. DER TV-KONSUM HERANWACHSENDER
- 4. DIE WIRKUNG VON KRIMINALITÄT IM FERNSEHEN AUF HERANWACHSENDE
- 5. KULTIVIERUNGSTHESE
- 6. KRIMINALITÄTSFURCHT
- 6.1 Erwartungen aufgrund der Theorie
- 6.2 Allgemeine Thesen
- 6.2.1 Drittvariable Alter
- 6.2.2 Wirkungsrichtung
- 6.2.3 Kultivierungsthesenkritische Studien
- 6.3 Fernsehnutzungsgewohnheiten
- 7. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einfluss von Fernsehkonsum auf die Kriminalitätsfurcht bei Heranwachsenden. Sie konzentriert sich insbesondere auf die Unterschiede zwischen verschiedenen Nutzungsgewohnheiten von öffentlich-rechtlichem und kommerziell-privatwirtschaftlichem Fernsehen. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen Mediennutzung und Kriminalitätsfurcht, wobei die Komplexität dieser Beziehung und die Rolle von Drittvariablen berücksichtigt werden.
- Auswirkungen des Fernsehkonsums auf die Kriminalitätsfurcht Heranwachsender
- Unterschiede im Einfluss verschiedener Fernsehnutzungsgewohnheiten
- Relevanz der Kultivierungsthese im Kontext der Studie
- Rolle von Drittvariablen (Alter, Geschlecht etc.)
- Analyse der bestehenden Forschung zu Mediengewalt und Kriminalitätsfurcht
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein, beschreibt die Problemstellung und das Erkenntnisinteresse, formuliert die Forschungsfrage und skizziert das Vorgehen. Kapitel 2 und 3 behandeln das Angebot an Gewaltdarstellungen im Fernsehen und den Fernsehkonsum Heranwachsender. Kapitel 4 beleuchtet die Wirkung von Kriminalität im Fernsehen auf Heranwachsende. Kapitel 5 beschreibt die Kultivierungsthese. Kapitel 6 analysiert Kriminalitätsfurcht, Erwartungen aufgrund der Theorie, allgemeine Thesen und Fernsehnutzungsgewohnheiten.
Schlüsselwörter
Kriminalitätsfurcht, Heranwachsende, Fernsehen, Medienkonsum, Gewaltdarstellungen, Kultivierungsthese, Fernsehnutzungsgewohnheiten, öffentlich-rechtliches Fernsehen, kommerziell-privates Fernsehen, Drittvariablen.
- Citation du texte
- Master of Arts UZH Stefan Heini (Auteur), 2006, Das Fernsehen und Kriminalitätsfurcht unter Heranwachsenden, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121761