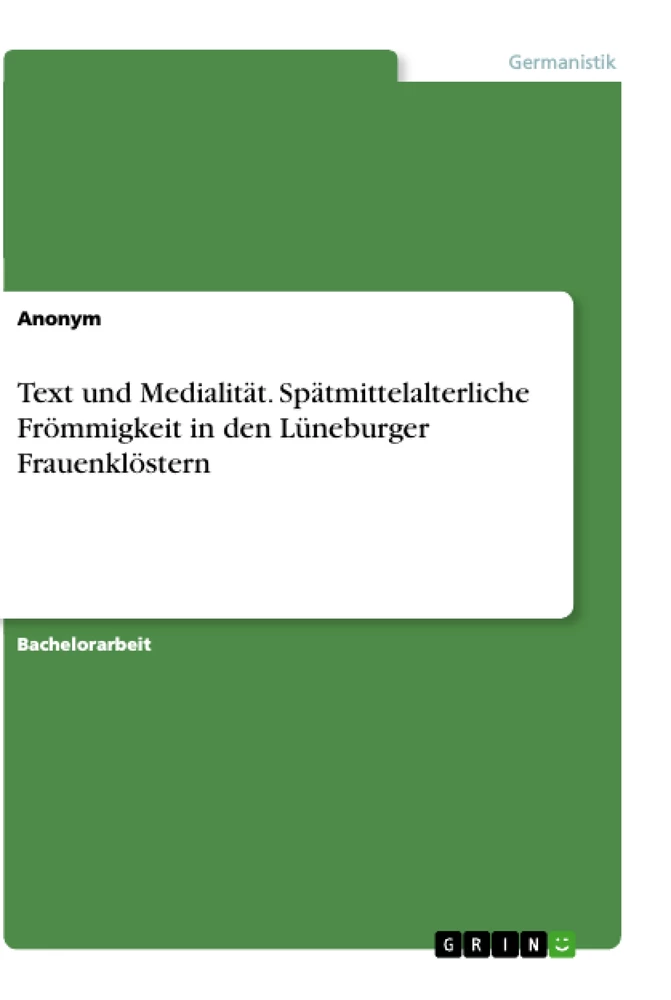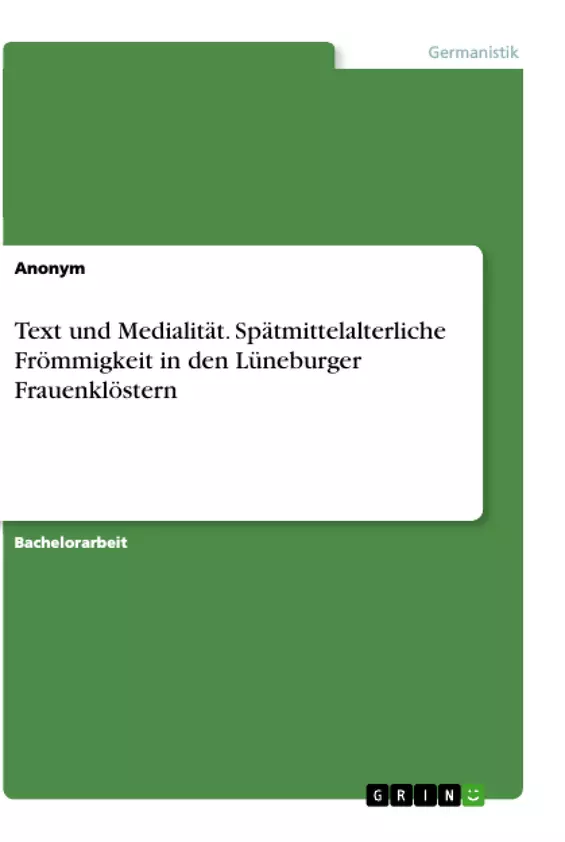Während die historische Entwicklung und das innermonastische Leben innerhalb der Frauenklöster anhand dieser Überlieferungen mittlerweile durch Werke wie Horst Appuhns „Chronik und Totenbuch des Klosters Wienhausens“ oder Ida-Christine Riggerts „Die Lüneburger Frauenklöster“ weitgehend rekonstruiert sind, bleibt das Wissen um Spiritualität und Frömmigkeit der einzelnen Nonne jedoch weitgehend unbekannt. Zentrale Fragestellungen der Arbeit sind daher, wie sich Frömmigkeit von Frauen im späten Mittelalter fassen lässt und wie die einfache Nonne in den Heideklöstern ihre Frömmigkeit außerhalb der Liturgie formte.
Die Arbeit soll versuchen, diese Fragestellungen zu beantworten und einen Einblick in die weibliche Frömmigkeit der Konvente und ihrer Nonnen im Spätmittelalter zu geben. Ziel ist es, angelehnt an June Mechams Werke Sacred Communities, Shared Devotions sowie Reading between the lines: compilation, variation, and the recovery of an authentic female voice in the Dornenkron prayer books from Wienhausen, die Schriftlichkeit der Klöster aufzuarbeiten und so darzulegen, wie Frömmigkeit überliefert und ausgedrückt wurde. Obschon die Arbeit von der Frömmigkeit innerhalb der Lüneburger Frauenklöster in ihrer Allgemeinheit handelt, werden sich die Analysen wegen der ausführlicheren Überlieferungen und ausgewählten Handschriften hauptsächlich auf die Konvente Wienhausen und Ebstorf konzentrieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Lüneburger Frauenklöster
- Die Geschichte der Klöster am Beispiel Wienhausen
- Reform und Reformation
- Die Reform im 15. Jahrhundert
- Die lutherische Reformation im 16. Jahrhundert
- Monastisches Leben
- Beziehungen zwischen den Heideklöstern
- Frömmigkeit in den Lüneburger Frauenklöstern
- Formen der Frömmigkeit
- Öffentliche Frömmigkeit
- Private Frömmigkeit
- Wandel der Frömmigkeit
- Formen der Frömmigkeit
- Passionsliteratur in den Lüneburger Frauenklöstern
- Die Dornenkron - Wienhäuser Handschrift 31
- Materialität
- Sprache
- Inhalt und Memoria passionis in Handschrift 31
- Private Frömmigkeit in Handschrift 31
- Ein Text, viele Überlieferungen – Der Ursprung von Handschrift 31
- Die fünf Wunden Christi – Ebstorfer Handschrift IV4
- Materialität
- Leidensmeditation der fünf Wunden Christi in Handschrift IV4
- Ein Text, viele Überlieferungen – Gebete zu den fünf Wunden Christi in Ebstorf
- Die Dornenkron - Wienhäuser Handschrift 31
- Kleinformatige Handschriften und ihre Funktion
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der weiblichen Frömmigkeit in den Lüneburger Frauenklöstern im Spätmittelalter. Sie untersucht, wie sich die Frömmigkeit von Frauen in dieser Zeit ausprägte und wie einzelne Nonnen ihre Frömmigkeit außerhalb der Liturgie gestalteten. Die Arbeit zielt darauf ab, die Schriftlichkeit der Klöster aufzuarbeiten und so die Überlieferung und den Ausdruck von Frömmigkeit zu beleuchten. Dabei werden die Konvente Wienhausen und Ebstorf aufgrund der ausführlicheren Überlieferungen und ausgewählten Handschriften im Fokus stehen.
- Die Geschichte der Lüneburger Frauenklöster und deren Bedeutung im Kontext von Reform und Reformation
- Die verschiedenen Formen der Frömmigkeit in den Klöstern, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich
- Die Analyse von Passionsliteratur in den Lüneburger Frauenklöstern anhand ausgewählter Handschriften aus Wienhausen und Ebstorf
- Die Bedeutung von kleinformatigen Handschriften für die private Frömmigkeit der Nonnen
- Die Herausbildung und den Ausdruck von Frömmigkeit im Kontext monastischer Reformen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik der Arbeit und die Fragestellungen, die behandelt werden. Sie stellt die Lüneburger Frauenklöster in ihren historischen Kontext und verdeutlicht die Bedeutung von Reform und Reformation für die Entwicklung der Frömmigkeit. Die Einleitung geht zudem auf die innermonastische Lebensweise und die Beziehungen zwischen den Klöstern ein.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Geschichte der Lüneburger Frauenklöster am Beispiel des Klosters Wienhausen. Es werden Gründungsgeschichte, wichtige Ereignisse und die Bedeutung der Reform und Reformation für das Kloster Wienhausen beleuchtet.
Das dritte Kapitel analysiert Formen der Frömmigkeit in den Lüneburger Frauenklöstern und setzt sich mit dem Wandel der Frömmigkeit im Laufe der Zeit auseinander.
Das vierte Kapitel widmet sich der Passionsliteratur in den Lüneburger Frauenklöstern. Es werden die Dornenkron-Handschrift aus Wienhausen und die Ebstorfer Handschrift mit dem Gebet über die fünf Wunden Christi analysiert. Die Analyse konzentriert sich auf die Materialität, die Sprache und den Inhalt der Handschriften. Darüber hinaus werden die Funktion und Bedeutung der kleinformatigen Handschriften beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der mittelalterlichen Kulturgeschichte, insbesondere mit der weiblichen Frömmigkeit in den Lüneburger Frauenklöstern. Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Spätmittelalter, Frömmigkeit, Frauenklöster, Lüneburg, Wienhausen, Ebstorf, Passionsliteratur, Handschriften, Materialität, Sprache, Inhalt, Memoria passionis, private Frömmigkeit, kleinformatige Handschriften, monastische Reformen.
Häufig gestellte Fragen
Wie lebten Nonnen in den Lüneburger Heideklöstern im Spätmittelalter?
Die Arbeit rekonstruiert das spirituelle Leben und die Frömmigkeit der Nonnen, die über die rein liturgischen Pflichten hinausgingen.
Was sind die "Dornenkron-Gebetbücher"?
Es handelt sich um kleinformatige Handschriften aus dem Kloster Wienhausen, die für die private Andacht der Nonnen genutzt wurden und Einblick in ihre "Memoria passionis" geben.
Welche Klöster stehen im Mittelpunkt der Untersuchung?
Die Analyse konzentriert sich hauptsächlich auf die Konvente Wienhausen und Ebstorf aufgrund ihrer reichhaltigen Überlieferungen.
Was änderte sich durch die Reformation in diesen Klöstern?
Die Arbeit beleuchtet den Übergang von der monastischen Reform des 15. Jahrhunderts zur lutherischen Reformation im 16. Jahrhundert und deren Einfluss auf die Frömmigkeit.
Welche Bedeutung hat die Materialität der Handschriften?
Die Größe, das Material und die Gestaltung der Bücher (z.B. kleinformatig für die Tasche) lassen Rückschlüsse auf ihre tägliche Verwendung in der privaten Frömmigkeit zu.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Text und Medialität. Spätmittelalterliche Frömmigkeit in den Lüneburger Frauenklöstern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1217877