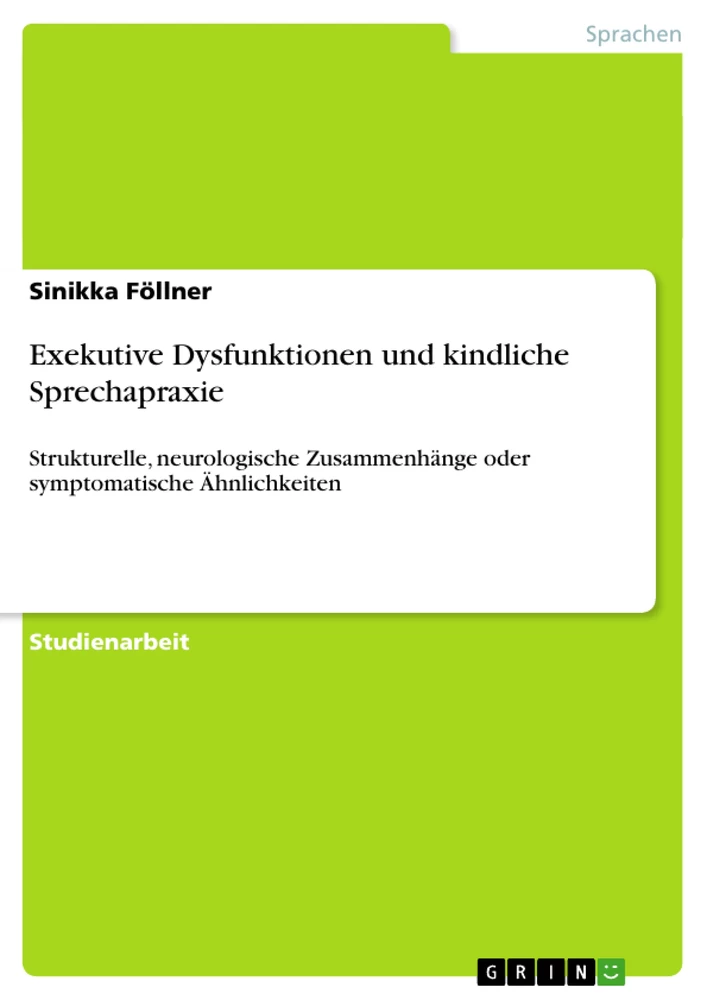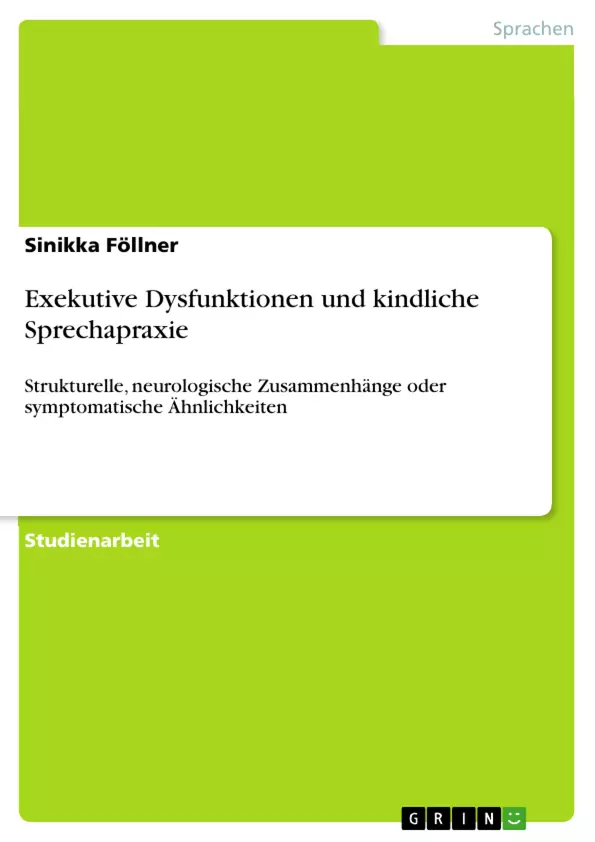Planen, Problemlösen, Handlungen programmieren und initiieren, Steuerung von Motivation und Emotionen: kognitive Prozesse die im Alltag unbewusst zur erfolgreichen Lebensbewältigung beitragen. Sie werden als exekutive Funktionen zusammengefasst.
Störungen exekutiver Funktionen, so genannte exekutive Dysfunktionen äußern sich in Störung der Sequenzierung von Handlungen, motorischer Steuerung und Programmierung, das heißt in einer Störung der Handlungsplanung und –kontrolle. Zudem können kognitive Beeinträchtigungen, Verhaltensauffälligkeiten und Persönlichkeitsveränderungen diese Symptome begleiten. Ursächlich für das Auftreten von exekutiven Dysfunktionen sind Schädigungen des Gehirns im Bereich des präfrontalen Cortexes aber auch eine Reihe psychischer Erkrankungen, wie ADS/ADHS.
Auch die Sprechapraxie im Kindes- und Erwachsenenalter wird als Planungs- und Programmierungsstörung in der sequenziellen Anordnung sprachlicher Bewegungsmuster verstanden.
In der Sprechapraxie bei Erwachsenen sind bereits klare ursächliche Faktoren bestimmt und erforscht, wobei vor allem Läsionen des Gehirns, auch im frontalen und fronto-temporalen Bereich zu erwähnen sind.
Bei der kindlichen Sprechapraxie steckt die Ursachenfindung noch in den Kinderschuhen. Es gibt diverse Vermutungen für die Pathogenese kindlicher Sprechapraxien. Neben genetischen und metabolischen Faktoren, werden auch neurologische Ursachen oder strukturelle Veränderungen im Gehirn und/ oder zentralen Nervensystem vermutet. Während die beiden erst genannten bereits schon gut erforscht und in einigen Studien der Zusammenhang zu kindlichen Sprechapraxien bestätig wurde, sind neurologische Ursachen bisher noch nicht untersucht.
In der folgenden Arbeit werden die exekutiven Funktionen, deren Funktionsweise anhand verschiedener Modelle und mögliche Beeinträchtigungen beschrieben. Anschließend wird auf die Sprechapraxie im Erwachsenen- und Kindesalter kurz eingegangen.
Zum Schluss wird diskutiert, in wiefern Sprechapraxie und exekutive Funktionen funktional und strukturell zusammenhängen können und in welcher Form sich neurologische, strukturelle Veränderungen bei kindlicher Sprechapraxie begründen ließen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Exekutive Funktionen - Versuch einer Definition
- 3. Modelle exekutiver Funktionen
- 3.1. Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley und Hitch
- 3.2. Das SAS - CS Modell von Norman & Shallice
- 4. Lokalisation Exekutiver Funktionen
- 5. Lokalisation von Sprache
- 6. Sprechapraxie
- 6.1. Begriffsklärung „Apraxie“
- 6.2. Versuch einer Definition für „Sprechapraxie“
- 6.3. Lokalisation und Ätiologie
- 6.4. Sprachapraxie vs. kindliche Entwicklungsdyspraxie
- 7. Kindliche Sprechapraxie
- 7.1. Begriffsklärung und Definition
- 7.2. Mögliche Pathogenese
- 7.3. Entwicklung der Praxie beim Kind
- 7.4. Sprachverarbeitungsmodell von Stackhouse und Wells (1997)
- 8. Vergleich und Zusammenhang Exekutiver Funktionen und kindlicher Sprechapraxie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen exekutiven Dysfunktionen und Sprechapraxie, insbesondere im Kindesalter. Es wird analysiert, ob strukturelle neurologische Zusammenhänge oder lediglich symptomatische Ähnlichkeiten bestehen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Modelle exekutiver Funktionen und die Lokalisation sowohl exekutiver Funktionen als auch von Sprachfunktionen im Gehirn.
- Definition und Modelle exekutiver Funktionen
- Lokalisation exekutiver Funktionen und Sprache im Gehirn
- Beschreibung der Sprechapraxie im Erwachsenen- und Kindesalter
- Mögliche Pathogenese der kindlichen Sprechapraxie
- Vergleich und möglicher Zusammenhang zwischen exekutiven Funktionen und kindlicher Sprechapraxie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der exekutiven Funktionen und der Sprechapraxie ein. Sie beschreibt exekutive Dysfunktionen als Störungen der Handlungsplanung und -kontrolle, die mit kognitiven Beeinträchtigungen und Verhaltensauffälligkeiten einhergehen können. Weiterhin wird die Sprechapraxie als Planungs- und Programmierungsstörung der sprachlichen Bewegungsmuster vorgestellt. Die Arbeit untersucht den möglichen Zusammenhang zwischen beiden Phänomenen, insbesondere im Hinblick auf neurologische und strukturelle Veränderungen, vor allem im Kindesalter, wo die Ursachenfindung noch in den Anfängen steckt.
2. Exekutive Funktionen – Versuch einer Definition: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition von exekutiven Funktionen. Es wird herausgestellt, dass eine umfassende Definition schwierig ist, da es sich um hochkomplexe und vielschichtige kognitive Prozesse handelt, die oft als höchste Instanz menschlichen Verhaltens beschrieben werden. Das Kapitel beschreibt verschiedene Funktionsbereiche wie Aufmerksamkeitsfokussierung, Zielformulierung, Handlungsplanung und -kontrolle. Die Abhängigkeit von exekutiven Funktionen vom Arbeitsgedächtnis wird hervorgehoben, wobei die zentralen Exekutiven nach Baddeley und Hitch (1974) und das Supervisory Attentional System (SAS) nach Norman und Shallice (1986) als wichtige Konzepte genannt werden. Der Fokus liegt auf der Beschreibung der komplexen und nicht-routinierten Prozesse, welche durch diese Funktionen ermöglicht werden.
3. Modelle exekutiver Funktionen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Modelle, die versuchen, die exekutiven Funktionen zu erklären, wie das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1986) und das SAS-CS Modell von Norman & Shallice (1980). Es wird betont, dass kein einzelnes Modell alle Aspekte der exekutiven Funktionen vollständig abdeckt und je nach Fokus des Modells unterschiedliche Therapieansätze resultieren können. Die Vielfalt der Modelle verdeutlicht die Komplexität der Thematik und die Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtungsweise.
6. Sprechapraxie: Dieses Kapitel definiert den Begriff Apraxie und Sprechapraxie. Es werden Lokalisation und Ätiologie der Sprechapraxie im Erwachsenenalter (häufig durch Hirnschädigungen im frontalen Bereich) beschrieben. Der Unterschied zwischen Sprachapraxie und kindlicher Entwicklungsdyspraxie wird thematisiert. Das Kapitel legt den Grundstein für den Vergleich mit exekutiven Funktionen, indem es die Sprechapraxie als Planungs- und Programmierungsstörung der sprachlichen Bewegungsmuster charakterisiert.
7. Kindliche Sprechapraxie: Dieses Kapitel befasst sich mit der kindlichen Sprechapraxie, beginnend mit einer Begriffsklärung und Definition. Es werden mögliche Ursachen (genetische, metabolische, neurologische Faktoren, strukturelle Veränderungen im Gehirn) diskutiert, wobei die Unsicherheiten in der Forschung hervorgehoben werden. Die Entwicklung der Praxie beim Kind und das Sprachverarbeitungsmodell von Stackhouse und Wells (1997) werden vorgestellt. Der Fokus liegt auf den noch nicht vollständig erforschten neurologischen Ursachen der kindlichen Sprechapraxie.
Schlüsselwörter
Exekutive Funktionen, exekutive Dysfunktionen, Sprechapraxie, kindliche Entwicklungsdyspraxie, Arbeitsgedächtnis, präfrontaler Kortex, Handlungsplanung, Sprachverarbeitung, Neuropsychologie, Pathogenese.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Zusammenhang Exekutiver Funktionen und Kindlicher Sprechapraxie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen exekutiven Dysfunktionen und Sprechapraxie, insbesondere im Kindesalter. Es wird analysiert, ob strukturelle neurologische Zusammenhänge oder lediglich symptomatische Ähnlichkeiten bestehen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Modelle exekutiver Funktionen und die Lokalisation sowohl exekutiver Funktionen als auch von Sprachfunktionen im Gehirn.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Definitionen und Modelle exekutiver Funktionen, die Lokalisation exekutiver Funktionen und Sprache im Gehirn, die Beschreibung der Sprechapraxie im Erwachsenen- und Kindesalter, die mögliche Pathogenese der kindlichen Sprechapraxie und den Vergleich und möglichen Zusammenhang zwischen exekutiven Funktionen und kindlicher Sprechapraxie.
Wie werden exekutive Funktionen definiert?
Exekutive Funktionen werden als hochkomplexe und vielschichtige kognitive Prozesse definiert, die oft als höchste Instanz menschlichen Verhaltens beschrieben werden. Sie umfassen Funktionsbereiche wie Aufmerksamkeitsfokussierung, Zielformulierung, Handlungsplanung und -kontrolle. Die Abhängigkeit von exekutiven Funktionen vom Arbeitsgedächtnis wird hervorgehoben.
Welche Modelle exekutiver Funktionen werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert verschiedene Modelle, darunter das Arbeitsgedächtnismodell von Baddeley (1986) und das SAS-CS Modell von Norman & Shallice (1980). Es wird betont, dass kein einzelnes Modell alle Aspekte der exekutiven Funktionen vollständig abdeckt.
Was ist Sprechapraxie?
Sprechapraxie wird als Planungs- und Programmierungsstörung der sprachlichen Bewegungsmuster definiert. Im Erwachsenenalter wird sie häufig durch Hirnschädigungen im frontalen Bereich verursacht. Die Arbeit unterscheidet zwischen Sprachapraxie und kindlicher Entwicklungsdyspraxie.
Was sind die Besonderheiten der kindlichen Sprechapraxie?
Das Kapitel zur kindlichen Sprechapraxie befasst sich mit Begriffsklärung, Definition und möglichen Ursachen (genetische, metabolische, neurologische Faktoren, strukturelle Veränderungen im Gehirn). Die Entwicklung der Praxie beim Kind und das Sprachverarbeitungsmodell von Stackhouse und Wells (1997) werden vorgestellt. Die noch nicht vollständig erforschten neurologischen Ursachen stehen im Fokus.
Wie werden exekutive Funktionen und Sprechapraxie verglichen?
Die Arbeit vergleicht exekutive Funktionen und Sprechapraxie, insbesondere im Hinblick auf neurologische und strukturelle Veränderungen, vor allem im Kindesalter. Der Fokus liegt auf der Untersuchung des möglichen Zusammenhangs zwischen beiden Phänomenen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Exekutive Funktionen, exekutive Dysfunktionen, Sprechapraxie, kindliche Entwicklungsdyspraxie, Arbeitsgedächtnis, präfrontaler Kortex, Handlungsplanung, Sprachverarbeitung, Neuropsychologie, Pathogenese.
- Citation du texte
- Sinikka Föllner (Auteur), 2008, Exekutive Dysfunktionen und kindliche Sprechapraxie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121829