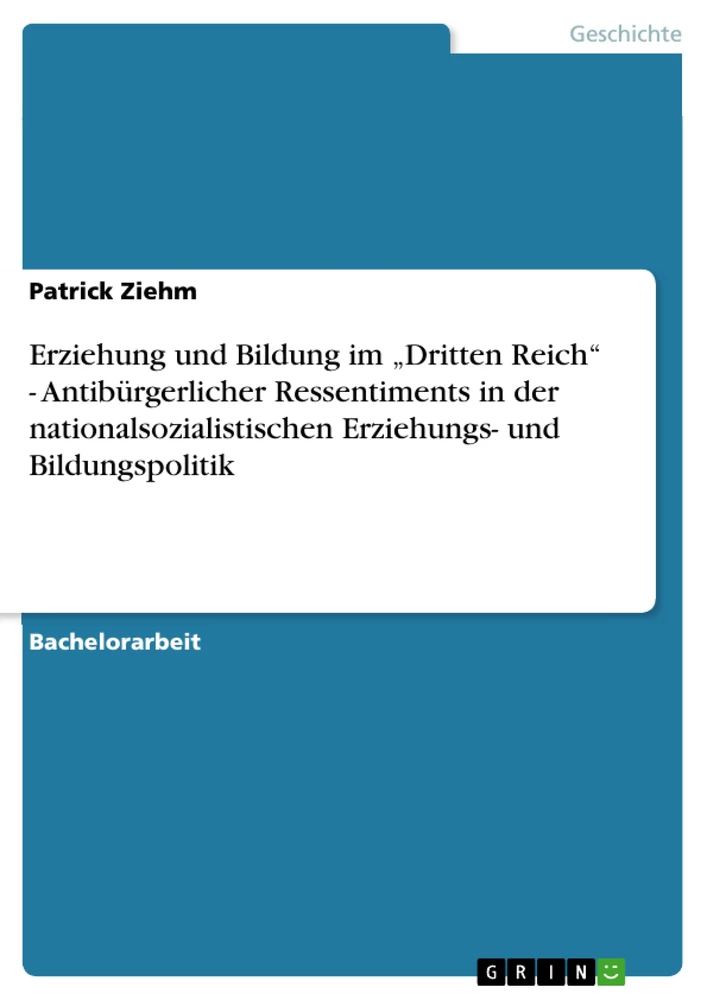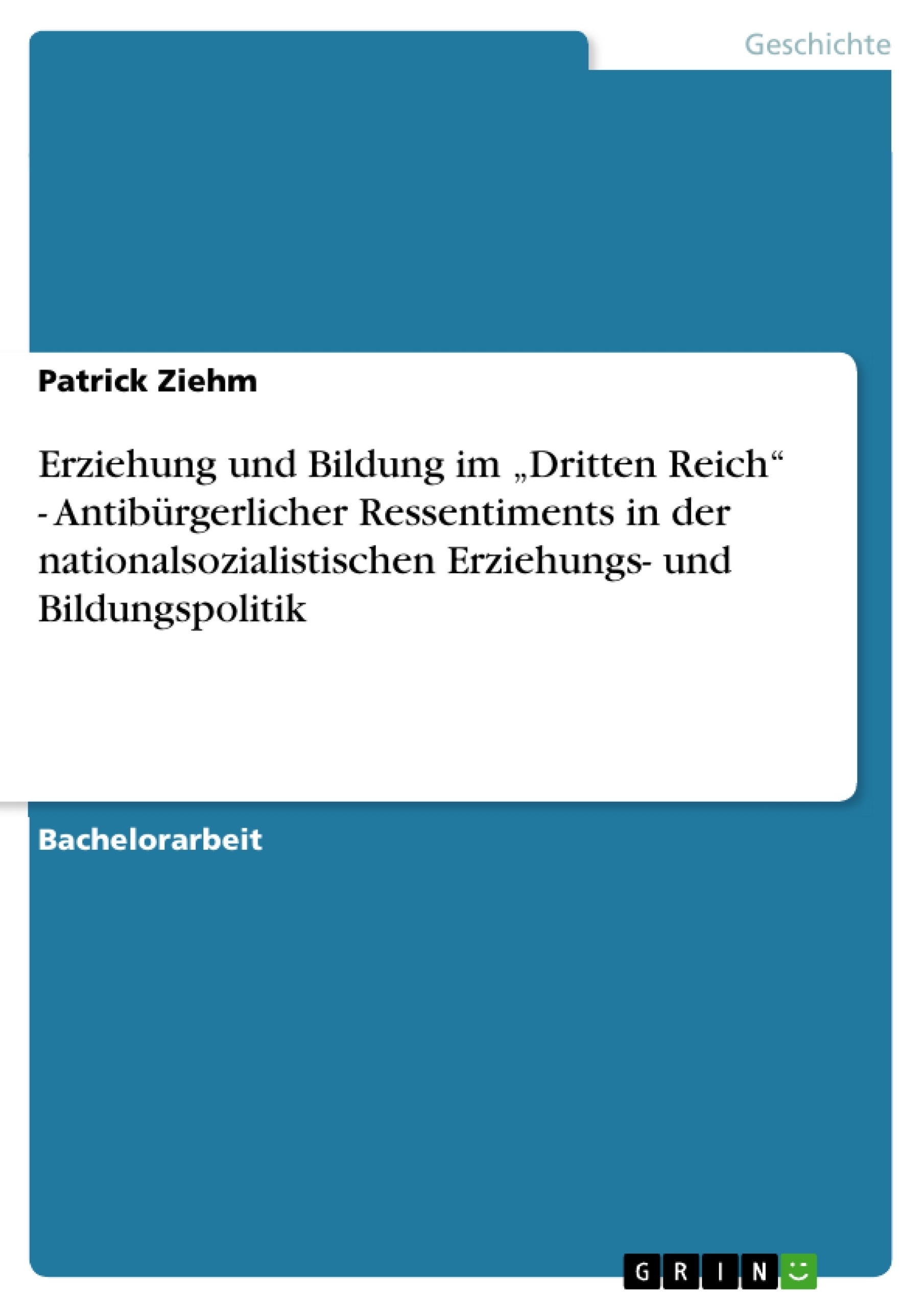Die Machtübernahme Adolf Hitlers am 30.01.1933 leitete die Deformierung der bürgerlichen Welt in Deutschland ein. In allen Bereichen des Lebens fanden Veränderungen statt, die sich zunächst eher positiv, aber später überwiegend negativ auf das Bürgertum auswirkten. Die Ambivalenz des Bürgertums führte zu einer schrittweisen Beseitigung bürgerlicher Ideale und Rechte. Durch die Bereitschaft klassische Ideale aufzugeben, erhoffte sich das Bürgertum, im neuen NS-System eine feste Stellung zu erlangen. Dem war aber nicht so, denn die antibürgerliche Haltung Hitlers kam schnell in Gesetzen und Erlassen zum Ausdruck.
Die nationalsozialistische Ideologie wirkte sich mit ihrer Lehre von der Rasse, des Volkes und der Nation auch auf die Erziehung und Bildung aus. Man versuchte die alten bürgerlichen Strukturen der Weimarer Republik zu durchbrechen. Der Individualismus wich der Bekenntnis und der Hingabe an die Ideologie im NS – Staat. Man verlangte von Millionen von Deutschen bedingungslos an den Nationalsozialismus mit seiner veränderten Weltanschauung zu glauben. Eine große Opferbereitschaft sollte sich im Zuge dessen unter dem Volk manifestieren. Damit galt auch ein selbstständiges und kritisches Denken als absolut verpönt. Historische Ereignisse, die sich nicht in den Kontext der NS-Ideologie integrieren ließen, wurden ausgeblendet.
Der Gehorsam und die absolute Treue zum Führer wurden zum höchsten pädagogischen Wert deklariert. In diesem Sinne gehörte zur bewussten Erziehungsintension des Regimes, der jungen Generation den Glauben an den Führer einzupflanzen. Der Nationalsozialismus sprach sich für eine Notwendigkeit politischer Bildung und Erziehung aus und nutze alle pädagogischen Möglichkeiten geschickt dazu, die heranwachsende Jugend zu manipulieren. Durch diese Beeinflussung sollte ein ganzes Volk stark gemacht werden, um den Kampf gegen den Feind siegreich zu beenden. Die weltanschaulich gesteuerte politische Pädagogik diente nicht dazu das Eigenbewusstsein sowie ein reflektiertes Wissen zu stärken, sondern sie unterstützte einzig und allein der Vertiefung der Führermythologie.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Bürgertum im Dritten Reich
- 2.1 Das Wirtschaftsbürgertum
- 2.2 Das Bildungsbürgertum
- 2.3 Das Kleinbürgertum
- 3 Die Bildungs- und Schulpolitik im Dritten Reich
- 3.1 Der juristisch-administrative Rahmen der Bildungspolitik und deren ausführenden Behörden und Verbände
- 3.2 Die nationalsozialistische Erziehungswissenschaft
- 3.3 Die Gliederung der Schulformen
- 3.4 Die Ausleseschulen als alternatives Bildungssystem
- 3.4.1 Die Nationalpolitischen Erziehungsanstalten
- 3.4.2 Die Adolf-Hitler-Schulen
- 3.4.3 Die Reichsschule der NSDAP Feldafing
- 3.5 Die veränderte Lehrerbildung
- 4 Die Praxis der nationalsozialistischen Bildungspolitik am Beispiel der Unterrichtsfächer Deutsch und Geschichte
- 4.1 Das Unterrichtsfach Deutsch
- 4.2 Das Unterrichtsfach Geschichte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die antibürgerlichen Ressentiments in der nationalsozialistischen Erziehungs- und Bildungspolitik. Sie untersucht, wie die nationalsozialistische Ideologie die bestehenden bürgerlichen Strukturen durchbrach und welche Elemente der Erziehungs- und Bildungspolitik gezielt gegen bürgerliche Ideale gerichtet waren. Der Fokus liegt auf der Analyse der Veränderungen im Bildungssystem und deren Auswirkungen auf das Bürgertum.
- Das Bürgertum im Dritten Reich und seine Transformation unter dem NS-Regime
- Die Bildungs- und Schulpolitik des Dritten Reichs: administrative Strukturen und ideologischer Einfluss
- Die Rolle von Ausleseschulen im nationalsozialistischen Bildungssystem
- Der Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie auf den Unterricht in Deutsch und Geschichte
- Die Auswirkungen der NS-Bildungspolitik auf die Lehrerbildung
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Machtergreifung Hitlers und die damit einhergehende Deformierung der bürgerlichen Welt. Sie betont die Ambivalenz des Bürgertums, das anfänglich auf eine positive Entwicklung hoffte, aber letztendlich die Beseitigung bürgerlicher Ideale und Rechte erlebte. Die nationalsozialistische Ideologie und ihre Auswirkungen auf Erziehung und Bildung werden als zentraler Punkt der Arbeit vorgestellt. Die Arbeit zielt darauf ab, die antibürgerlichen Ressentiments in der nationalsozialistischen Erziehungs- und Bildungspolitik zu analysieren.
2 Das Bürgertum im Dritten Reich: Dieses Kapitel beleuchtet die Sozialstruktur des Dritten Reichs, die sowohl Kontinuitäten als auch einen rasanten Wandel aufwies. Es beschreibt die bestehenden bürgerlichen Klassen (Wirtschaftsbürgertum, Bildungsbürgertum, Kleinbürgertum) und analysiert die starken Einschnitte in deren Strukturen durch die Ausgrenzung und Verfolgung jüdischer Bürger und die Entmachtung von Sozialdemokraten und Liberalen. Die traditionelle bürgerliche Hierarchie wurde in Frage gestellt, bürgerliche Prinzipien wie freie Meinungsäußerung wurden unterdrückt. Das Kapitel verdeutlicht das Ausbleiben jeglicher Gegenwehr des Bürgertums.
Schlüsselwörter
Nationalsozialismus, Bürgertum, Bildung, Erziehung, Schulpolitik, Antibürgerlichkeit, Ideologie, Ausleseschulen, Erziehungswissenschaft, Deutschunterricht, Geschichtsunterricht, Führermythologie, Rasse, Volk, Nation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der antibürgerlichen Ressentiments in der nationalsozialistischen Erziehungs- und Bildungspolitik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die antibürgerlichen Ressentiments in der nationalsozialistischen Erziehungs- und Bildungspolitik. Sie untersucht, wie die nationalsozialistische Ideologie die bestehenden bürgerlichen Strukturen durchbrach und welche Elemente der Erziehungs- und Bildungspolitik gezielt gegen bürgerliche Ideale gerichtet waren. Der Fokus liegt auf den Veränderungen im Bildungssystem und deren Auswirkungen auf das Bürgertum.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Das Bürgertum im Dritten Reich und seine Transformation unter dem NS-Regime; die Bildungs- und Schulpolitik des Dritten Reichs (administrative Strukturen und ideologischer Einfluss); die Rolle von Ausleseschulen im nationalsozialistischen Bildungssystem; den Einfluss der nationalsozialistischen Ideologie auf den Unterricht in Deutsch und Geschichte; und die Auswirkungen der NS-Bildungspolitik auf die Lehrerbildung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus mehreren Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt die Machtergreifung Hitlers und die Deformierung der bürgerlichen Welt, sowie die Ambivalenz des Bürgertums und die Ziele der Arbeit. Kapitel 2 (Das Bürgertum im Dritten Reich) beleuchtet die Sozialstruktur des Dritten Reichs, die bürgerlichen Klassen und deren Transformation unter dem NS-Regime. Kapitel 3 (Die Bildungs- und Schulpolitik im Dritten Reich) behandelt den juristisch-administrativen Rahmen, die nationalsozialistische Erziehungswissenschaft, die Schulformen, Ausleseschulen (Nationalpolitische Erziehungsanstalten, Adolf-Hitler-Schulen, Reichsschule Feldafing) und die veränderte Lehrerbildung. Kapitel 4 (Die Praxis der nationalsozialistischen Bildungspolitik...) analysiert den Deutsch- und Geschichtsunterricht unter dem NS-Regime.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Nationalsozialismus, Bürgertum, Bildung, Erziehung, Schulpolitik, Antibürgerlichkeit, Ideologie, Ausleseschulen, Erziehungswissenschaft, Deutschunterricht, Geschichtsunterricht, Führermythologie, Rasse, Volk, Nation.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die antibürgerlichen Ressentiments in der nationalsozialistischen Erziehungs- und Bildungspolitik zu analysieren und aufzuzeigen, wie das NS-Regime bürgerliche Strukturen und Ideale untergrub.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Arbeit richtet sich an Personen, die sich wissenschaftlich mit dem Nationalsozialismus, der Geschichte des deutschen Bildungssystems und der soziokulturellen Entwicklung des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen. Sie ist für akademische Zwecke konzipiert.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die genaue Methode wird nicht explizit im HTML-Snippet genannt, lässt sich aber aus dem Inhalt erschließen. Es handelt sich vermutlich um eine qualitative Analyse von Quellen, die den Einfluss des Nationalsozialismus auf das Bildungssystem beleuchten. Die Analyse stützt sich wahrscheinlich auf historische Quellen und Literatur.
- Citation du texte
- Patrick Ziehm (Auteur), 2008, Erziehung und Bildung im „Dritten Reich“ - Antibürgerlicher Ressentiments in der nationalsozialistischen Erziehungs- und Bildungspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121845