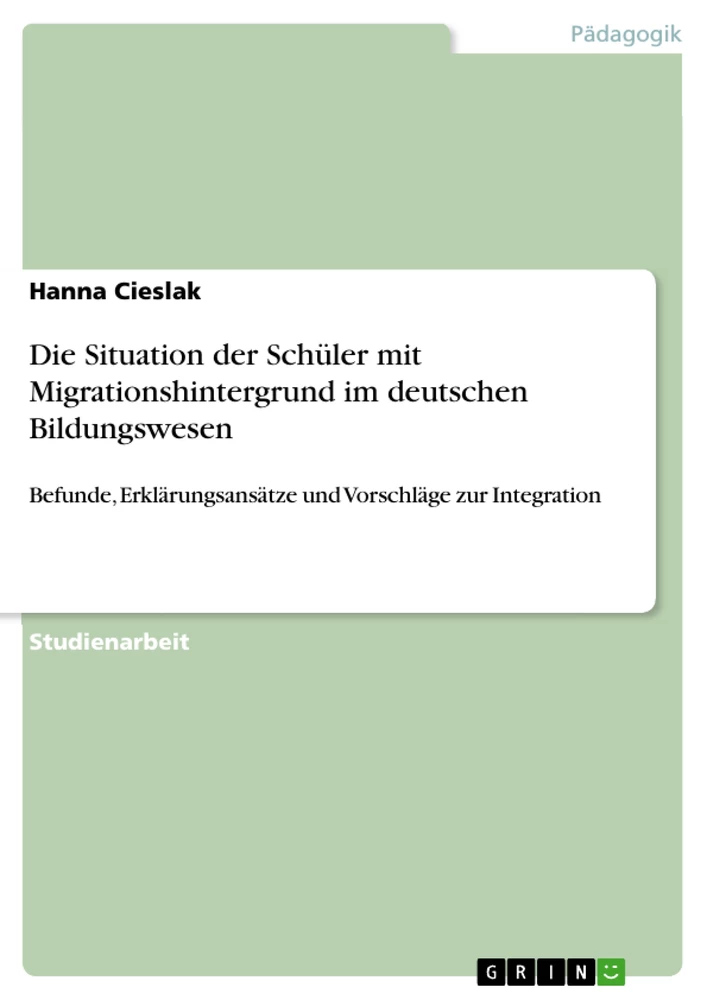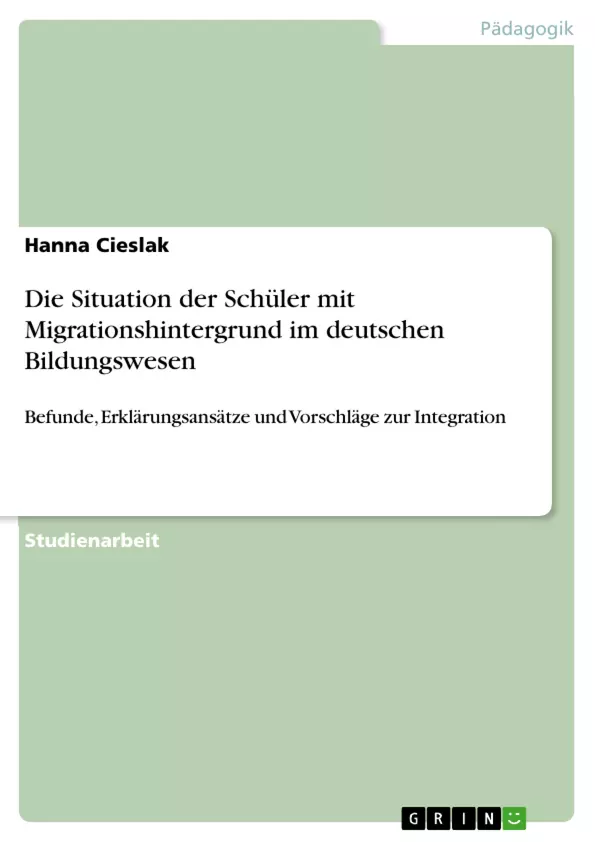„Selektiv, diskriminierend, undemokratisch – das deutsche Schulsystem bietet nicht allen Kindern die gleichen Chancen. (…) und das Recht auf Bildung wird nicht überall ausreichend umgesetzt. Dies betrifft insbesondere Migranten und sozial Schwache. Kinder aus Zuwandererfamilien werden systematisch benachteiligt. Jahre-, wenn nicht jahrzehntelang haben weder Bildungs- noch Sozialpolitiker ihre Hausaufgaben gemacht. (…) Jahrzehnte nach der Ankunft von Migranten müssten heute Tausende deutscher Kinder ausländischer Herkunft besser in das Bildungssystem und in die Gesellschaft integriert worden sein, als es hier in Deutschland der Fall ist!“
(MUÑOZ, V.. IN: BERICHT FÜR DAS RECHT AUF BILDUNG IN DEUTSCHLAND, 2006)
Mit diesen harten Worten kritisierte der UN-Sonderberichterstatter (…) das deutsche Bildungssystem und zeigte damit, dass Deutschland sieben Jahre nach dem ersten PISA-Schock International erneut in der bildungspolitischen Kritik steht. […]
Allein schon die Tatsache, dass sich viele Autoren dazu entschieden haben, über „Migranten im deutschen Schulwesen“ zu schreiben, statt über die Thematik „Deutsche Kinder im deutschen Schulwesen“, zeigt, dass in unserer Kultur spätestens seit PISA die Migranten-Thematik als ein bildungspolitisches Problem eine besondere Beachtung und Begründung verdient. (…).
Das Buch mit einer eingehenden Deskription wichtiger Fakten zur Situation der Migranten im deutschen Schulwesen, in deren Verlauf wichtige Gesichtspunkte über die Lage im Primar- und Sekundarbereich, sowie nationale Unterschiede zwischen den Migranten aufgezeigt werden. Anschließend folgt die Herausarbeitung und Skizzierung verschiedener Erklärungsansätze, die anhand von markanten Befunden und empirischen Studien wie z. B. von DIEFENBACH sowie GOMOLLA UND RADTKE versuchen, den mangelnden schulischen Erfolg von Migrantenkindern zu erklären.
Auf der Grundlage der Befunde zur Situation von Migranten im deutschen Schulwesen und der Darlegung einiger Erklärungsansätze wird abschließend versucht, Interventions- und Fördermaßnahmen herauszuarbeiten, die die Bildungsdiskrepanz in Deutschland deutlich verringern sollen. Hierbei wird das Augenmerk abschließend besonders auf die «REGIONALEN ARBEITSSTELLEN ZUR FÖRDERUNG AUSLÄNDISCHER KINDER UND JUGENDLICHEN» (Kurz: RAA) in NRW gelegt, die im Hinblick auf die Unterstützung schulischer Belange und die Verknüpfung von Schule und Jugendhilfe modellhaft Migrationsförderung betreibt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Die Lage der Migranten im deutschen Schulwesen
- 2.1 Die Situation im Vorschul- und Primarbereich
- 2.2 Die Situation im allgemein bildenden Schulwesen
- 2.3 Unterschiede nach Nationalität und Region
- 3 Erklärungsansätze für die Nachteile von Schülern mit Migrationshintergrund
- 3.1 Außerschulische Erklärungsansätze
- 3.1.1 Die kulturell-defizitäre Erklärung
- 3.1.2 Die humankapitaltheoretische Erklärung
- 3.2 Innerschulische Erklärungsansätze
- 3.2.1 Die Erklärung durch Strukturdefizite des deutschen Schulsystems
- 3.2.2 Die Erklärung durch institutionelle Diskriminierung
- 4 Intervention und Fördermaßnahmen zur Verringerung der Bildungsdiskrepanz
- 4.1 Schulinterne Maßnahmen
- 4.2 Schulexterne Maßnahmen >>Die RAA<<
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Situation von Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem. Ziel ist es, wichtige Fakten zu dieser Thematik zu beschreiben, verschiedene Erklärungsansätze für den mangelnden schulischen Erfolg dieser Schülergruppe zu beleuchten und schließlich Interventions- und Fördermaßnahmen zur Verringerung der Bildungsdiskrepanz aufzuzeigen.
- Die Lage von Migrantenkindern im deutschen Vorschul- und Schulbereich
- Unterschiede im Bildungserfolg nach Nationalität und Region
- Außerschulische und innerschulische Erklärungsansätze für die Bildungsdiskrepanz
- Analyse von Fördermaßnahmen zur Verbesserung der Bildungssituation
- Die Rolle der Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher (RAA)
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung thematisiert die aktuelle bildungspolitische Debatte um Migrantenkinder in Deutschland und begründet die Relevanz der Thematik. Kapitel 2 beschreibt die Situation von Migrantenkindern im deutschen Schulwesen, unterteilt in den Vorschul- und Primarbereich sowie den allgemein bildenden Schulbereich. Es werden statistische Daten und empirische Befunde präsentiert, um die Herausforderungen aufzuzeigen. Kapitel 3 analysiert verschiedene Erklärungsansätze für den mangelnden schulischen Erfolg von Migrantenkindern, sowohl außerschulische (kulturell-defizitär, humankapitaltheoretisch) als auch innerschulische (Strukturdefizite des Schulsystems, institutionelle Diskriminierung).
Kapitel 4 widmet sich schließlich Interventions- und Fördermaßnahmen. Hierbei wird besonders auf schulinterne Maßnahmen und die Arbeit der Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher (RAA) in NRW eingegangen.
Schlüsselwörter
Migrantenkinder, Bildungssystem, Bildungsdiskrepanz, Schulischer Erfolg, Integrationspolitik, Erklärungsansätze, Fördermaßnahmen, RAA, PISA-Studie, soziale Herkunft.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Situation von Migranten im deutschen Schulsystem bewertet?
Die Arbeit zitiert Kritik an der systematischen Benachteiligung und mangelnden Chancengleichheit für Kinder aus Zuwandererfamilien.
Was sind innerschulische Erklärungsansätze für den mangelnden Erfolg?
Dazu zählen Strukturdefizite des deutschen Schulsystems sowie Formen der institutionellen Diskriminierung.
Welche außerschulischen Theorien werden diskutiert?
Die kulturell-defizitäre Erklärung und die humankapitaltheoretische Erklärung (Ressourcen der Eltern).
Was sind die RAA in Nordrhein-Westfalen?
Regionale Arbeitsstellen zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher, die modellhaft Migrationsförderung und Schulunterstützung betreiben.
Gibt es Unterschiede im Bildungserfolg nach Nationalität?
Ja, die Arbeit zeigt auf, dass nationale Unterschiede zwischen verschiedenen Migrantengruppen bei den Bildungsergebnissen bestehen.
- Citar trabajo
- Hanna Cieslak (Autor), 2007, Die Situation der Schüler mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungswesen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/121898